Marx, Das Kapital Buch 1 (1867)
 |
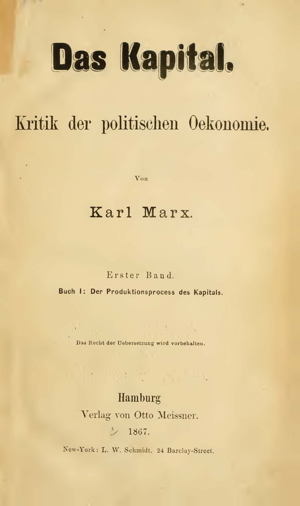 |
| Karl Marx (1818-1883) | Title Page of the 1st ed. of vol. 1 of Das Kapital (1867) |
Introduction
This is the first German edition of volume 1 of Karl Marx’s multi-volume work Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie which appeared between 1867 and 1894. Only this volume appeared in Marx’s lifetime. The others were edited and published by Friedrich Engels posthumously. A facsimile PDF of this book can be seen here.
An English translation by Friedrich Engels and Ernest Untermann of the 4th revised edition (1909) can be found here.
For further information about socialism, and Karl Marx and his work see:
- Karl Marx (1818-1883)
- Topic: Socialism and the Classical Liberal Critique
- School of Thought: Socialism
- Study Guide: Socialism
Source
Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Von Karl Marx. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. (Hamburg: Otto Meissner, 1867; New-York: L. W. Schmidt).
The original HTML source was put online by the Deutsches Textarchiv, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften under a Creative Commons License https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/marx_kapital01_1867. The HTML was designed to look as much like the original text as possible, hence the footnotes appear at the bottom of the “page.”
- Zitationshilfe: Marx, Karl: Das Kapital. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg, 1867. In: Deutsches Textarchiv https://www.deutschestextarchiv.de/marx_kapital01_1867, abgerufen am 27.06.2018.
Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. (1867)
Inhalt des ersten Bandes.
Vorwort VII
Erstes Buch. Der Produktionsprozess des Kapitals.
Erstes Kapitel. Waare und Geld 1
- 1) Die Waare 1
- 2) Der Austauschprozess der Waaren 45
-
3) Das Geld und die Waarencirkulation 55
- A. Mass der Werthe 55
- B. Cirkulationsmittel 63
- a) Die Metamorphose der Waaren 63
- b) Der Umlauf des Geldes 74
- c) Die Münze. Das Werthzeichen 85
- C. Geld 91
- a) Schatzbildung 91
- b) Zahlungsmittel 96
- c) Weltgeld 103
Zweites Kapitel. Die Verwandlung von Geld in Kapital 106
- 1) Die allgemeine Formel des Kapitals 106
- 2) Widersprüche der allgemeinen Formel 117
- 3) Kauf und Verkauf der Arbeitskraft 129
Drittes Kapitel. Die Produktion des absoluten Mehrwerths 141
- 1) Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess 141
- 2) Constantes Kapital und variables Kapital 165
- 3) Die Rate des Mehrwerths 178
- 4) Der Arbeitstag 198
- 5) Rate und Masse des Mehrwerths 281
Viertes Kapitel. Die Produktion des relativen Mehrwerths 291
- 1) Begriff des relativen Mehrwerths 291
- 2) Cooperation 302
- 3) Theilung der Arbeit und Manufaktur 318
- 4) Maschinerie und grosse Industrie 355
Fünftes Kapitel. Weitere Untersuchungen über die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerths 496
- 1) Absoluter und relativer Mehrwerth 496
-
2) Grössenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth 505
- A. Grösse des Arbeitstags und Intensivität der Arbeit constant, Produktivkraft der Arbeit variabel 506
- B. Constanter Arbeitstag, constante Produktivkraft der Arbeit, Intensivität der Arbeit variabel 510
- C. Produktivkraft und Intensivität der Arbeit constant, Arbeitstag variabel 511
- D. Gleichzeitige Variationen in Länge des Arbeitstags, Produktivkraft und Intensivität der Arbeit 513
- 3) Verschiedene Formeln für die Rate des Mehrwerths 516
-
4) Werth, resp. Preis der Arbeitskraft in der verwandelten Form des Arbeitslohns 520
- a) Die Formverwandlung 520
- b) Die beiden Grundformen des Arbeitslohns: Zeitlohn und Stücklohn 529
Sechstes Kapitel. Der Accumulationsprozess des Kapitals 551
-
1) Die kapitalistische Accumulation 552
- a) Einfache Reproduktion 552
- b) Verwandlung von Mehrwerth in Kapital 567
- c) Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Accumulation 599
- 2) Die s. g. ursprüngliche Accumulation 699
- 3) Die moderne Kolonisationstheorie 745
Anhang zu Kapitel I, 1. Die Werthform 764
Gewidmet meinem unvergesslichen Freunde, dem kühnen, treuen, edlen Vorkämpfer des Proletariats, Wilhelm Wolff. Geb. zu Tarnau, 21. Juni 1809. Gest. im Exil zu Manchester 9. Mai 1864.
Vorwort. ↑
Das Werk, dessen ersten Band ich dem Publikum übergebe, bildet die Fortsetzung meiner 1859 veröffentlichten Schrift: „ Zur Kritik der politischen Oekonomie“. Die lange Pause zwischen Anfang und Fortsetzung ist einer langjährigen Krankheit geschuldet, die meine Arbeit wieder und wieder unterbrach.
Der Inhalt jener früheren Schrift ist resümirt im ersten Kapitel dieses Bandes. Es geschah diess nicht nur des Zusammenhangs und der Vollständigkeit wegen. Die Darstellung ist verbessert. Soweit es der Sachverhalt irgendwie erlaubte, sind viele früher nur angedeutete Punkte hier weiter entwickelt, während umgekehrt dort ausführlich Entwickeltes hier nur angedeutet wird. Die Abschnitte über die Geschichte der Werthund Geldtheorie fallen jetzt natürlich ganz weg. Jedoch findet der Leser der früheren Schrift in den Noten zum ersten Kapitel neue Quellen zur Geschichte jener Theorie eröffnet.
Aller Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Das Verständniss des ersten Kapitels, namentlich des Abschnitts, der die Analyse der Waare enthält, wird daher die meiste Schwierigkeit machen. Was nun näher die Analyse der Werthsubstanz und der Werthgrösse betrifft, so habe ich
sie möglichst popularisirt(FN 1). Anders mit der Analyse der Werthform. Sie ist schwerverständlich, weil die Dialektik viel schärfer ist als in der ersten Darstellung. Ich rathe daher dem nicht durchaus in dialektisches Denken eingewohnten Leser, den Abschnitt von p. 15 (Zeile 19 von oben) bis Ende p. 34 ganz zu überschlagen, und statt dessen den dem Buch zugefügten Anhang: „ Die Werthform“ zu lesen. Dort wird versucht, die Sache so einfach und selbst so schulmeisterlich darzustellen, als ihre wissenschaftliche Fassung erlaubt. Nach Beendigung des Anhangs kann der Leser dann im Text wieder fortfahren mit p. 35.
Die Werthform, deren fertige Gestalt die Geldform, ist sehr inhaltslos und einfach. Dennoch hat der Menschengeist sie seit mehr als 2000 Jahren vergeblich zu ergründen gesucht, während andrerseits die Analyse viel inhaltsvollerer und komplicirterer Formen wenigstens annähernd gelang. Warum? Weil der ausgebildete Körper leichter zu studiren ist als die Körperzelle. Bei der Analyse der ökonomischen Formen kann ausserdem weder das Mikroskop dienen, noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muss beide ersetzen. Für die bürgerliche Gesellschaft ist aber die Waarenform des Arbeitsprodukts oder die Werthform der Waare die ökonomische Zellenform. Dem Ungebildeten scheint sich ihre Analyse in blossen Spitzfindigkeiten herumzutreiben. Es handelt sich dabei
in der That um Spitzfindigkeiten, aber nur so wie es sich in der mikrologischen Anatomie darum handelt.
Mit Ausnahme des Abschnitts über die Werthform wird man daher diess Buch nicht wegen Schwerverständlichkeit anklagen können. Ich unterstelle natürlich Leser, die etwas Neues lernen, also auch selbst denken wollen.
Der Physiker beobachtet Naturprozesse entweder dort, wo sie in der prägnantesten Form und von störenden Einflüssen mindest getrübt erscheinen, oder, wo möglich, macht er Experimente unter Bedingungen, welche den reinen Vorgang des Prozesses sichern. Was ich in diesem Werk zu erforschen habe, ist die kapitalistische Produktionsweise und die ihr entsprechenden Produktionsund Verkehrsverhältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Diess der Grund, warum es zur Hauptillustration meiner theoretischen Entwicklung dient. Sollte jedoch der deutsche Leser pharisäisch die Achseln zucken über die Zustände der englischen Industrieund Ackerbauarbeiter, oder sich optimistisch dabei beruhigen, dass in Deutschland die Sachen noch lange nicht so schlimm stehn, so muss ich ihm zurufen: De te fabula narratur!
An und für sich handelt es sich nicht um den höheren oder niedrigeren Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Antagonismen, welche aus den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringen. Es handelt sich um diese Gesetze selbst, um diese mit eherner Nothwendigkeit wirkenden und sich durchsetzenden Tendenzen. Das industriell entwickeltere Land zeigt dem minder entwickelten nur das Bild der eignen Zukunft!
Aber abgesehn hiervon. Wo die kapitalistische Produktion völlig bei uns eingebürgert ist, z. B. in den eigentlichen Fabriken, sind die Zustände viel schlechter als in England, weil das Gegengewicht der Fabrikgesetze fehlt. In allen andren Sphären quält uns, gleich dem ganzen übrigen kontinentalen Westeuropa, nicht nur die Entwicklung der kapitalistischen Produktion, sondern auch der Mangel ihrer Entwicklung. Neben den modernen Nothständen drückt uns eine ganze Reihe vererbter Nothstände, entspringend aus der Fortvegetation alterthümlicher,
überlebter Produktionsweisen mit ihrem Gefolg von zeitwidrigen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Wir leiden nicht nur von den Lebenden, sondern auch von den Todten. Le mort saisit le vif!
Im Vergleich zur englischen ist die sociale Statistik Deutschlands und des übrigen kontinentalen Westeuropa’s elend. Dennoch lüftet sie den Schleier grade genug, um hinter demselben ein Medusenhaupt ahnen zu lassen. Wir würden vor unsren eignen Zuständen erschrecken, wenn unsre Regierungen und Parlamente, wie in England, periodische Untersuchungskommissionen über die ökonomischen Verhältnisse bestallten, wenn diese Kommissionen mit derselben Machtvollkommenheit, wie in England, zur Erforschung der Wahrheit ausgerüstet würden, wenn es gelänge, zu diesem Behuf ebenso sachverständige, unparteiische und rücksichtslose Männer zu finden, wie die Fabrikinspektoren Englands sind, seine ärztlichen Berichterstatter über „Public Health“ (Oeffentliche Gesundheit), seine Untersuchungskommissäre über die Exploitation der Weiber und Kinder, über Wohnungsund Nahrungszustände u. s. w. Perseus brauchte eine Nebelkappe zur Verfolgung von Ungeheuern. Wir ziehen die Nebelkappe tief über Aug’ und Ohr, um die Existenz der Ungeheuer wegläugnen zu können.
Man muss sich nicht darüber täuschen. Wie der amerikanische Unabhängigkeitskrieg des 18. Jahrhunderts die Sturmglocke für die europäische Mittelklasse läutete, so der amerikanische Bürgerkrieg des 19. Jahrhunderts für die europäische Arbeiterklasse. In England ist der Umwälzungsprozess mit Händen greifbar. Auf einem gewissen Höhepunkt muss er auf den Kontinent rückschlagen. Dort wird er sich in brutaleren oder humaneren Formen bewegen, je nach dem Entwicklungsgrad der Arbeiterklasse selbst. Von höheren Motiven abgesehn, gebietet also den jetzt herrschenden Klassen ihr eigenstes Interesse die Wegräumung aller gesetzlich kontrolirbaren Hindernisse, welche die Entwicklung der Arbeiterklasse hemmen. Ich habe desswegen u. a. der Geschichte, dem Inhalt und den Resultaten der englischen Fabrikgesetzgebung einen so ausführlichen Platz in die-
sem Bande eingeräumt. Eine Nation soll und kann von der anderen lernen. Auch wenn eine Gesellschaft dem Naturgesetz ihrer Bewegung auf die Spur gekommen ist, — und es ist der letzte Endzweck dieses Werks das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen — kann sie naturgemässe Entwicklungsphasen weder überspringen, noch wegdekretiren. Aber sie kann die Geburtswehen abkürzen und mildern.
Zur Vermeidung möglicher Missverständnisse ein Wort. Die Gestalten von Kapitalist und Grundeigenthümer zeichne ich keineswegs in rosigem Licht. Aber es handelt sich hier um die Personen nur, soweit sie die Personifikation ökonomischer Kategorien sind, Träger von bestimmten Klassenverhältnissen und Interessen. Weniger als jeder andre kann mein Standpunkt, der die Entwicklung der ökonomischen Gesellschaftsformation als einen naturgeschichtlichen Prozess auffasst, den Einzelnen verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf er social bleibt, so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag.
Auf dem Gebiet der politischen Oekonomie begegnet die freie wissenschaftliche Forschung nicht nur demselben Feinde, wie auf allen anderen Gebieten. Die eigenthümliche Natur des Stoffes, den sie behandelt, ruft wider sie die heftigsten, kleinlichsten und gehässigsten Leidenschaften der menschlichen Brust, die Furien des Privatinteresses, auf den Kampfplatz. Die englische Hochkirche z. B. verzeiht eher den Angriff auf 30 von ihren 39 Glaubensartikeln als auf ihres Geldeinkommens. Heutzutage ist der Atheismus selbst eine culpa levis, verglichen mit der Kritik überlieferter Eigenthumsverhältnisse. Jedoch ist hier ein Fortschritt unverkennbar. Ich verweise z. B. auf das in den letzten Wochen veröffentlichte Blaubuch: „ Correspondence with Her Majesty’s Missions Abroad, regarding Industrial Questions and Trade’s Unions.“ Die auswärtigen Vertreter der englischen Krone sprechen es hier mit dürren Worten aus, dass in Deutschland, Frankreich, kurz allen Kulturstaaten des europäischen Kontinents, eine Umwandlung der be-
stehenden Verhältnisse von Kapital und Arbeit ebenso fühlbar und ebenso unvermeidlich ist als in England. Gleichzeitig erklärte jenseits des transatlantischen Oceans Herr Wade, Vicepräsident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, in öffentlichen Meetings: Nach Beseitigung der Sklaverei trete die Umwandlung der Kapitalund Grundeigenthumsverhältnisse auf die Tagesordnung! Es sind diess Zeichen der Zeit, die sich nicht verstecken lassen durch Purpurmäntel oder schwarze Kutten. Sie bedeuten nicht, dass morgen Wunder geschehn werden. Sie zeigen, wie selbst in den herrschenden Klassen die Ahnung aufdämmert, dass die jetzige Gesellschaft kein fester Krystall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständig im Prozess der Umwandlung begriffener Organismus ist.
Der zweite Band dieser Schrift wird den Cirkulationsprozess des Kapitals ( Buch II) und die Gestaltungen des Gesammtprozesses ( Buch III), der abschliessende dritte Band ( Buch IV) die Geschichte der Theorie behandeln.
Jedes Urtheil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen. Gegenüber den Vorurtheilen der s. g. öffentlichen Meinung, der ich nie Koncessionen gemacht habe, gilt mir nach wie vor der Wahlspruch des grossen Florentiners: Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
London, 25. Juli 1867.
Karl Marx.
Erstes Buch. Der Produktionsprozess des Kapitals. ↑
Erstes Kapitel. Waare und Geld.↑
1) Die Waare.↑Der Reichthum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine „ungeheure Waarensammlung“(FN 1), die einzelne Waare als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Waare.
Die Waare ist zunächst ein äusserer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgend einer Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie z. B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, ändert nichts an der Sache(FN 2). Es handelt sich hier auch nicht darum, wie die Sache das menschliche Bedürfniss befriedigt, ob unmittelbar als Lebensmittel, d. h. als Gegenstand des Genusses, oder auf einem Umweg, als Produktionsmittel.
Jedes nützliche Ding, wie Eisen, Papier u. s. w., ist unter doppeltem
Gesichtspunkt zu betrachten, nach Qualität und Quantität. Jedes solche Ding ist ein Ganzes vieler Eigenschaften und kann daher nach verschiedenen Seiten nützlich sein. Diese verschiedenen Seiten und daher die mannigfachen Gebrauchsweisen der Dinge zu entdecken, ist geschichtliche That(FN 3). So ist die Findung gesellschaftlicher Masse für die Quantität der nützlichen Dinge. Die Verschiedenheit der Waarenmasse entspringt theils aus der verschiedenen Natur der zu messenden Gegenstände, theils aus Convention.
Die Nützlichkeit eines Dings für das menschliche Leben macht es zum Gebrauchswerth(FN 4). Abkürzend nennen wir das nützliche Ding selbst oder den Waarenkörper, wie Eisen, Weizen, Diamant u. s. w., Gebrauchswerth, Gut, Artikel. Bei Betrachtung der Gebrauchswerthe wird stets quantitative Bestimmtheit vorausgesetzt, wie Dutzend Uhren, Elle Leinwand, Tonne Eisen u. s. w. Die Gebrauchswerthe der Waaren liefern das Material einer eignen Disciplin, der Waarenkunde(FN 5). Der Gebrauchswerth verwirklicht sich nur im Gebrauch oder der Consumtion. Gebrauchswerthe bilden den stofflichen Inhalt des Reichthums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns zu betrachtenden Gesellschaftsform bilden sie zugleich die stofflichen Träger des — Tauschwerths.
Der Tauschwerth erscheint zunächst als das quantitative Verhältniss, die Proportion, worin sich Gebrauchswerthe einer Art gegen
Gebrauchswerthe anderer Art austauschen(FN 6), ein Verhältniss, das beständig mit Zeit und Ort wechselt. Der Tauschwerth scheint daher etwas Zufälliges und rein Relatives, ein der Waare innerlicher, immanenter Tauschwerth (valeur intrinsèque) also eine contradictio in adjecto (FN 7). Betrachten wir die Sache näher.
Eine einzelne Waare, ein Quarter Weizen z. B. tauscht sich in den verschiedensten Proportionen mit andern Artikeln aus. Dennoch bleibt sein Tauschwerth unverändert, ob in x Stiefelwichse, y Seide, z Gold u. s. w. ausgedrückt. Er muss also von diesen seinen verschiedenen Ausdrucksweisen unterscheidbar sein.
Nehmen wir ferner zwei Waaren, z. B. Weizen und Eisen. Welches immer ihr Austauschverhältniss, es ist stets darstellbar in einer Gleichung, worin ein gegebenes Quantum Weizen irgend einem Quantum Eisen gleichgesetzt wird, z. B. 1 Quarter Weizen = a Ctr. Eisen. Was besagt diese Gleichung? Dass derselbe Werth in zwei verschiednen Dingen, in 1 Qrtr. Weizen und ebenfalls in a Ctr. Eisen existirt. Beide sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine, noch das andere ist. Jedes der beiden, soweit es Tauschwerth, muss also, unabhängig von dem andern, auf diess Dritte reducirbar sein.
Ein einfaches geometrisches Beispiel veranschauliche diess. Um den Flächeninhalt aller gradlinigen Figuren zu bestimmen und zu vergleichen, löst man sie in Dreiecke auf. Das Dreieck selbst reducirt man auf einen von seiner sichtbaren Figur ganz verschiednen Ausdruck — das halbe Produkt seiner Grundlinie mit seiner Höhe. Ebenso sind die Tauschwerthe der Waaren zu reduciren auf ein Gemeinsames, wovon sie ein Mehr oder Minder darstellen.
Dass die Substanz des Tauschwerths ein von der physisch-handgreiflichen Existenz der Waare oder ihrem Dasein als Gebrauchswerth
durchaus Verschiednes und Unabhängiges, zeigt ihr Austauschverhältniss auf den ersten Blick. Es ist charakterisirt eben durch die Abstraktion vom Gebrauchswerth. Dem Tauschwerth nach betrachtet ist nämlich eine Waare grade so gut als jede andre, wenn sie nur in richtiger Proportion vorhanden ist(FN 8).
Unabhängig von ihrem Austauschverhältniss oder von der Form, worin sie als Tausch-Werthe erscheinen, sind die Waaren daher zunächst als Werthe schlechthin zu betrachten(FN 9).
Als Gebrauchsgegenstände oder Güter sind die Waaren körperlich verschiedne Dinge. Ihr Werth sein bildet dagegen ihre Einheit. Diese Einheit entspringt nicht aus der Natur, sondern aus der Gesellschaft. Die gemeinsame gesellschaftliche Substanz, die sich in verschiednen Gebrauchswerthen nur verschieden darstellt, ist — die Arbeit.
Als Werthe sind die Waaren nichts als krystallisirte Arbeit. Die Masseinheit der Arbeit selbst ist die einfache Durchschnittsarbeit, deren Charakter zwar in verschiednen Ländern und Kulturepochen wechselt, aber in einer vorhandnen Gesellschaft gegeben ist. Komplicirtere Arbeit gilt nur als potenzirte oder vielmehr multiplicirte einfache Arbeit, so dass z. B. ein kleineres Quantum komplicirter Arbeit gleich einem grösseren Quantum einfacher Arbeit. Wie diese Reduktion geregelt wird, ist hier gleichgültig. Dass sie beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Waare mag das Produkt der komplicirtesten Arbeit sein. Ihr Werth setzt sie dem Produkt einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein bestimmtes Quantum einfacher Arbeit dar.
Ein Gebrauchswerth oder Gut hat also nur einen Werth, weil Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisirt ist. Wie nun die Grösse seines Werthes messen? Durch das Quantum der
in ihm enthaltenen „werthbildenden Substanz“, der Arbeit. Die Quantität der Arbeit selbst misst sich an ihrer Zeitdauer und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Massstab an bestimmten Zeittheilen, wie Stunde, Tag u. s. w.
Es könnte scheinen, dass wenn der Werth einer Waare durch das während ihrer Produktion verausgabte Arbeitsquantum bestimmt ist, je fauler oder ungeschickter ein Mann, desto werthvoller seine Waare, weil er desto mehr Arbeitszeit zu ihrer Verfertigung braucht. Aber nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zählt als werthbildend. Gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit ist Arbeitszeit, erheischt um irgend einen Gebrauchswerth mit den vorhandnen gesellschaftlich normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und Intensivität der Arbeit herzustellen. Nach der Einführung des Dampfwebstuhls in England z. B. genügte vielleicht halb so viel Arbeit als vorher, um ein gegebenes Quantum Garn in Gewebe zu verwandeln. Der englische Handweber brauchte zu dieser Verwandlung in der That nach wie vor dieselbe Arbeitszeit, aber das Produkt seiner individuellen Arbeitsstunde stellte jetzt nur noch eine halbe gesellschaftliche Arbeitsstunde dar und fiel daher auf die Hälfte seines früheren Werths.
Es ist also nur das Quantum gesellschaftlich nothwendiger Arbeit oder die zur Herstellung eines Gebrauchswerths gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit, welche seine Wert hgrösse bestimmt. Die einzelne Waare gilt hier überhaupt als Durchschnittsexemplar ihrer Art(FN 10). Waaren, worin gleich grosse Arbeitsquanta enthalten sind, oder die in derselben Arbeitszeit hergestellt werden können, haben daher dieselbe Werthgrösse. Der Werth einer Waare verhält sich zum Werth jeder andern Waare, wie die zur Produktion der einen nothwendige Arbeitszeit zu der für die Produktion der andern nothwendigen Arbeitszeit. „Als Werthe sind alle Waaren nur bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit“(FN 11).
Die Werthgrösse einer Waare bliebe daher constant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit constant. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter andern durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Combination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse. Dasselbe Quantum Arbeit stellt sich z. B. mit günstiger Jahreszeit in 8 Bushel Weizen dar, mit ungünstiger in nur 4. Dasselbe Quantum Arbeit liefert mehr Metalle in reichhaltigen, als in armen Minen u. s. w. Diamanten kommen selten in der Erdrinde vor und ihre Findung kostet daher im Durchschnitt viel Arbeitszeit. Folglich stellen sie in wenig Volumen viel Arbeit dar. Jacob bezweifelt, dass Gold jemals seinen vollen Werth bezahlt hat. Noch mehr gilt diess vom Diamant. Nach Eschwege hatte 1823 die achtzigjährige Gesammtausbeute der brasilischen Diamantgruben noch nicht den Werth des 1½jährigen Durchschnittsprodukts der brasilischen Zuckeroder Kaffeepflanzungen erreicht. Mit reichhaltigeren Gruben würde dasselbe Arbeitsquantum sich in mehr Diamanten darstellen und ihr Werth sinken. Gelingt es mit wenig Arbeit Kohle in Diamant zu verwandeln, so kann sein Werth unter den von Ziegelsteinen fallen. Allgemein: Je grösser die Produktivkraft der Arbeit, desto kleiner die zur Herstellung eines Artikels erheischte Arbeitszeit, desto kleiner die in ihm krystallisirte Arbeitsmasse, desto kleiner sein Werth. Umgekehrt, je kleiner die Produktivkraft der Arbeit, desto grösser die zur Herstellung eines Artikels nothwendige Arbeitszeit, desto grösser sein Werth. Die Werthgrösse einer Waare wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit.
Wir kennen jetzt die Substanz des Werths. Es ist die Arbeit. Wir kennen sein Grössenmass. Es ist die Arbeitszeit. Seine Form, die den Werth eben zum Tausch-Werth stempelt, bleibt zu analysiren. Vorher jedoch sind die bereits gefundenen Bestimmungen etwas näher zu entwickeln.
Ein Ding kann Gebrauchswerth sein, ohne Tauschwerth
zu sein. Es ist diess der Fall, wenn sein Dasein für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräulicher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz u. s. w. Ein Ding kann nützlich und Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Waare zu sein. Wer durch sein Produkt sein eignes Bedürfniss befriedigt, schafft zwar Gebrauchswerth, aber nicht Waare. Um Waare zu produciren, muss er nicht nur Gebrauchswerth produciren, sondern Gebrauchswerth für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswerth. Endlich kann kein Ding Werth sein, ohne Gebrauchsgegenstand zu sein. Ist es nutzlos, so ist auch die in ihm enthaltene Arbeit nutzlos, zählt nicht als Arbeit und bildet daher keinen Werth.
Ursprünglich erschien uns die Waare als ein Zwieschlächtiges, Gebrauchswerth und Tauschwerth. Näher betrachtet wird sich zeigen, dass auch die in der Waare enthaltene Arbeit zwieschlächtig ist. Dieser Punkt, der von mir zuerst kritisch entwickelt wurde(FN 12), ist der Springpunkt, um den sich das Verständniss der politischen Oekonomie dreht.
Nehmen wir zwei Waaren, etwa einen Rock und 10 Ellen Leinwand. Der erstere habe den zweifachen Werth der letzteren, so dass wenn 10 Ellen Leinwand = W, der Rock = 2 W.
Der Rock ist ein Gebrauchswerth, der ein besondres Bedürfniss befriedigt. Um ihn hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten Art zweckmässig produktiver Thätigkeit. Sie ist bestimmt nach Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mitteln und Resultat. Die Arbeit, deren Nützlichkeit sich so im Gebrauchswerth ihres Produkts oder darin darstellt, dass ihr Produkt ein Gebrauchswerth ist, heisse hier der Vereinfachung halber kurzweg nützliche Arbeit. Unter diesem Gesichtspunkt ist sie stets betrachtet in Bezug auf den Nutzeffekt, dessen Hervorbringung sie bezweckt.
Wie Rock und Leinwand qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe, so sind die ihr Dasein vermittelnden Arbeiten qualitativ verschieden — Schneiderarbeit und Weberei. Wären jene Dinge nicht qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe und daher Produkte qualitativ verschiedner nützlicher Arbeiten, so könnten sie sich über-
haupt nicht als Waaren gegenübertreten. Rock tauscht sich nicht aus gegen Rock, derselbe Gebrauchswerth nicht gegen denselben Gebrauchswerth.
In der Gesammtheit der verschiedenartigen Gebrauchswerthe oder Waarenkörper erscheint eine Gesammtheit eben so mannigfaltiger, nach Gattung, Art, Familie, Unterart, Varietät verschiedner nützlicher Arbeiten — eine gesellschaftliche Theilung der Arbeit. Sie ist Existenzbedingung der Waarenproduktion, obgleich Waarenproduktion nicht umgekehrt Existenzbedingung gesellschaftlicher Arbeitstheilung. In der altindischen Gemeinde ist die Arbeit gesellschaftlich getheilt, ohne dass die Produkte zu Waaren werden. Oder, ein näher liegendes Beispiel, in jeder Fabrik ist die Arbeit systematisch getheilt, aber diese Theilung nicht dadurch vermittelt, dass die Arbeiter ihre individuellen Produkte austauschen. Nur Produkte selbstständiger und von einander unabhängiger Privatarbeiten treten einander als Waaren gegenüber.
Man hat also gesehn : In dem Gebrauchswerth jeder Waare steckt eine bestimmte zweckmässig produktive Thätigkeit oder nützliche Arbeit. Gebrauchswerthe können sich nicht als Waaren gegenübertreten, wenn nicht qualitativ verschiedne nützliche Arbeiten in ihnen stecken. In einer Gesellschaft, deren Produkte allgemein die Form der Waare annehmen, d. h. in einer Gesellschaft von Waarenproducenten, entwickelt sich dieser qualitative Unterschied der nützlichen Arbeiten, welche unabhängig von einander als Privatgeschäfte selbstständiger Producenten betrieben werden, zu einem vielgliedrigen System, zu einer gesellschaftlichen Theilung der Arbeit.
Dem Rock ist es übrigens gleichgültig, ob er vom Schneider oder vom Kunden des Schneiders getragen wird. In beiden Fällen wirkt er als Gebrauchswerth. Ebensowenig ist das Verhältniss zwischen dem Rock und der ihn producirenden Arbeit an und für sich dadurch verändert, dass die Schneiderarbeit eigne Profession wird, selbstständiges Glied der gesellschaftlichen Theilung der Arbeit. Wo ihn das Kleidungsbedürfniss zwang, hat der Mensch Jahrtausende lang geschneidert, bevor aus einem Menschen ein Schneider ward. Aber das Dasein von Rock, Leinwand, jedem nicht von Natur vorhandnen Element des stofflichen Reichthums, musste immer vermittelt sein durch eine spezielle, zweckmässig produktive Thätigkeit, die besondere Naturstoffe besondern menschlichen Bedürfnissen
assimilirt. Als Bildnerin von Gebrauchswerthen, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnothwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermitteln.
Die Gebrauchswerthe Rock, Leinwand u. s. w., kurz die Waarenkörper, sind Verbindungen von zwei Elementen, Naturstoff und Arbeit. Zieht man die Gesammtsumme aller verschiedenen nützlichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand u. s. w. stecken, so bleibt stets ein materielles Substrat zurück, das ohne Zuthun des Menschen von Natur vorhanden ist. Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen der Stoffe ändern(FN 13). Noch mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig unterstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige Quelle der von ihr producirten Gebrauchswerthe, des stofflichen Reichthums. Die Arbeit ist sein Vater, wie William Petty sagt, und die Erde seine Mutter.
Gehn wir nun von der Waare, so weit sie Gebrauchsgegenstand, über zum WaarenWerth.
Nach unsrer Unterstellung hat der Rock den doppelten Werth der Leinwand. Diess ist aber nur ein quantitativer Unterschied, der uns zunächst noch nicht interessirt. Wir erinnern daher, dass wenn der Werth eines Rockes doppelt so gross als der von 10 Ellen Leinwand, 20 Ellen Leinwand dieselbe Werthgrösse haben wie ein Rock.
Als Werthe sind Rock und Leinwand Dinge von gleicher Substanz, objektive Ausdrücke gleichartiger Arbeit. Aber Schneiderarbeit und Weberei sind qualitativ verschiedne Arbeiten. Es giebt jedoch Gesellschaftszustände, worin derselbe Mensch abwechselnd schneidert und webt, diese beiden verschiednen Arbeitsweisen daher nur Modificationen der Arbeit desselben Individuums und noch nicht besondre feste Functionen verschiedner Individuen sind, ganz wie der Rock, den unser Schneider heute, und die Hosen, die er morgen macht, nur Variationen derselben individuellen Arbeit voraussetzen. Der Augenschein lehrt ferner, dass in unsrer kapitalistischen Gesellschaft, je nach der wechselnden Richtung der Arbeitsnachfrage, eine gegebene Portion menschlicher Arbeit abwechselnd in der Form von Schneiderei oder in der Form von Weberei zugeführt wird. Dieser Formwechsel der Arbeit mag nicht ohne Friction abgehn, aber er muss gehn. Sieht man ab von der Bestimmtheit der produktiven Thätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit, so bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist. Schneiderarbeit und Weberei, obgleich qualitativ verschiedne produktive Thätigkeiten, sind beide produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand u. s. w., und in diesem Sinn beide menschliche Arbeit. Es sind nur zwei verschiedne Formen, menschliche Arbeitskraft zu verausgaben. Allerdings muss die menschliche Arbeitskraft selbst mehr oder minder entwickelt sein, um in dieser oder jener Form verausgabt zu werden. Der Werth der Waaren aber stellt menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt. Wie nun in der bürgerlichen Gesellschaft ein General oder Banquier eine grosse, der Mensch schlechthin dagegen eine sehr schäbige Rolle spielt(FN 14), so steht es hier auch mit der menschlichen Arbeit. Sie ist Verausgabung einfacher Arbeitskraft, die jeder gewöhnliche Mensch, ohne besondere Entwicklung, in seinem leiblichen Organismus besitzt. Die Arbeitskraft eines Bauernknechts gelte z. B. für einfache Arbeitskraft, ihre Verausgabung daher für einfache Arbeit oder menschliche Arbeit ohne weitern Schnörkel, Schneiderarbeit dagegen für
Verausgabung höher entwickelter Arbeitskraft. Während sich der Arbeitstag des Bauernknechts daher etwa im Werthausdruck von ½ W, stellt sich der Arbeitstag des Schneiders im Werthausdrucke von W dar(FN 15). Dieser Unterschied ist jedoch nur quantitativ. Wenn der Rock das Produkt eines Arbeitstags des Schneiders, hat er denselben Werth wie das Produkt von 2 Arbeitstagen des Bauernknechts. So zählt aber die Schneiderarbeit immer nur als multiplicirte Bauernarbeit. Die verschiednen Proportionen, worin verschiedne Arbeitsarten auf einfache Arbeit als ihre Masseinheit reducirt sind, werden durch einen gesellschaftlichen Prozess hinter dem Rücken der Produzenten festgesetzt und scheinen ihnen daher durch das Herkommen gegeben. Der Vereinfachung halber gilt uns im Folgenden jede Art Arbeitskraft unmittelbar für einfache Arbeitskraft, wodurch nur die Mühe der Reduktion erspart wird.
Wie also in den Werthen Rock und Leinwand von dem Unterschied ihrer Gebrauchswerthe abstrahirt ist, so in der Arbeit, die diese Werthe darstellen, von dem Unterschied der nützlichen Formen, worin sie das einemal Schneiderarbeit ist, das andremal Weberei. Wie die Gebrauchswerthe Rock und Leinwand Verbindungen zweckbestimmter, produktiver Thätigkeiten mit Tuch und Garn sind, die Werthe Rock und Leinwand dagegen blosse gleichartige Arbeitsgallerten, so gilt auch die in diesen Werthen enthaltene Arbeit nicht durch ihr produktives Verhalten zu Tuch und Garn, sondern nur als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Bildungselemente der Gebrauchswerthe Rock und Leinwand sind Schneiderarbeit und Weberei eben durch ihre verschiednen Qualitäten, Substanz des Roc kwerths und Leinwan dwerths sind sie nur, soweit von ihrer besondern Qualität abstrahirt wird und beide gleiche Qualität besitzen, die Qualität menschlicher Arbeit.
Rock und Leinwand sind aber nicht nur Werthe überhaupt, sondern Werthe von bestimmter Grösse und nach unsrer Unterstellung ist der Rock doppelt so viel werth, als 10 Ellen Leinwand. Woher diese
Verschiedenheit ihrer Werthgrössen? Daher dass die Leinwand nur halb so viel Arbeit enthält, als der Rock, sodass zur Produktion des letztern die Arbeitskraft während doppelt soviel Zeit verausgabt werden muss, als zur Produktion der erstern.
Wenn also mit Bezug auf den Gebrauchswerth die in der Waare enthaltne Arbeit nur qualitativ gilt, gilt sie mit Bezug auf die Werthgrösse nur quantitativ, nachdem sie bereits auf menschliche Arbeit ohne weitere Qualität reducirt ist. Dort handelt es sich um das Wie und Was der Arbeit, hier um ihr Wie Viel, ihre Zeitdauer. Da die Werthgrösse einer Waare nur das Quantum der in ihr enthaltnen Arbeit misst, müssen Waaren in gewisser Proportion stets gleich grosse Werthe sein.
Bleibt die Produktivkraft sage aller zur Produktion eines Rocks erheischten nützlichen Arbeiten unverändert, so steigt die Werthgrösse der Röcke mit ihrer eignen Quantität. Wenn 1 Rock x, stellen 2 Röcke 2 x Arbeitstage dar u. s. w. Nimm aber an, die zur Produktion eines Rocks nothwendige Arbeitszeit steige auf das Doppelte oder falle um die Hälfte. Im ersten Fall hat ein Rock soviel Werth als vorher zwei Röcke, im letztern Fall haben zwei Röcke nur so viel Werth, als vorher einer, obgleich in beiden Fällen ein Rock nach wie vor dieselben Dienste leistet und die in ihm enthaltne nützliche Arbeit nach wie vor von derselben Güte bleibt. Aber das in seiner Produktion verausgabte Arbeits quantum hat sich verändert.
Ein grössres Quantum Gebrauchswerth bildet an und für sich grössern stofflichen Reichthum, zwei Röcke mehr als einer. Mit zwei Röcken kann man zwei Menschen kleiden, mit einem Rock nur einen Menschen u. s. w. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichthums ein gleichzeitiger Fall seiner Werthgrösse entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus der zwieschlächtigen Bestimmung der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit. Sie drückt in der That nur den Wirkungsgrad zweckbestimmter produktiver Thätigkeit in gegebnem Zeitraum aus. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältniss zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Werth dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Da die Produktivkraft der
konkreten nützlichen Form der Arbeit angehört, kann sie natürlich die Arbeit nicht mehr berühren, sobald von ihrer konkreten nützlichen Form abstrahirt wird. Dieselbe Arbeit stellt sich daher in denselben Zeiträumen stets in derselben Werthgrösse dar, wie immer die Produktivkraft wechsle. Aber sie liefert in demselben Zeitraum verschiedne Quanta Gebrauchswerthe, mehr wenn die Produktivkraft steigt, weniger, wenn sie sinkt. Im erstern Fall kann es geschehn, dass 2 Röcke weniger Arbeit enthalten als früher einer. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerthe vermehrt, kann also die Werthgrösse selbst der vermehrten Gesammtmasse vermindern, wenn er nämlich die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit abkürzt. Ebenso umgekehrt.
Aus dem Bisherigen folgt, dass in der Waare zwar nicht zwei verschiedene Sorten Arbeit stecken, wohl aber dieselbe Arbeit verschieden und selbst entgegengesetzt bestimmt ist, je nachdem sie auf den Gebrauchswerth der Waare als ihr Produkt oder auf den WaarenWerth als ihren bloss gegenständlichen Ausdruck bezogen wird. Wie die Waare vor allem Gebrauchsgegenstand sein muss, um Werth zu sein, so muss die Arbeit vor allem nützliche Arbeit, zweckbestimmte produktive Thätigkeit sein, um als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft und daher als menschliche Arbeit schlechthin zu zählen.
Da bisher nur noch Werthsubstanz und Werthgrösse bestimmt, wenden wir uns jetzt zur Analyse der Werthform.
Kehren wir zunächst wieder zurück zur ersten Erscheinungsform des Waaren werths.
Wir nehmen zwei Quanta Waaren, die gleichviel Arbeitszeit zu ihrer Produktion kosten, also gleiche Werthgrössen sind, und wir haben 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, oder 40 Ellen Leinwand sind zwei Röcke werth. Wir sehn, dass der Werth der Leinwand in einem bestimmten Quantum von Röcken ausgedrückt ist. Der Werth einer Waare, so dargestellt im Gebrauchswerth einer andern Waare, heisst ihr relativer Werth.
Der relative Werth einer Waare kann wechseln, obgleich ihr Werth constant bleibt. Umgekehrt kann ihr relativer Werth constant bleiben,
obgleich ihr Werth wechselt. Die Gleichung: 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke setzt nämlich voraus, dass beide Waaren gleich viel Arbeit kosten. Mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der sie hervorbringenden Arbeiten wechselt aber die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit. Betrachten wir den Einfluss solcher Wechsel auf den relativen Werth.
I. Der Werth der Leinwand wechsle, während der Rock werth constant bleibt. Verdoppelt sich die zur Produktion der Leinwand verausgabte Arbeitszeit, etwa in Folge zunehmender Unfruchtbarkeit des flachstragenden Bodens, so verdoppelt sich ihr Werth. Statt 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, hätten wir: 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke, da 2 Röcke jetzt nur halb so viel Arbeitszeit enthalten als 40 Ellen Leinwand. Nimmt dagegen die zur Produktion der Leinwand nothwendige Arbeitszeit um die Hälfte ab, etwa in Folge verbesserter Webstühle, so sinkt der Leinwan dwerth um die Hälfte. Demgemäss jetzt: 40 Ellen Leinwand = 1 Rock. Der relative Werth der Waare A, d. h. ihr Werth ausgedrückt in der Waare B, steigt und fällt also direkt wie der Werth der Waare A, bei gleichbleibendem Werth der Waare B.
II. Der Werth der Leinwand bleibe constant, während der Rock werth wechsle. Verdoppelt sich unter diesen Umständen die zur Produktion des Rockes nothwendige Arbeitszeit, etwa in Folge ungünstiger Wollschur, so haben wir statt 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke jetzt: 40 Ellen Leinwand = 1 Rock. Fällt dagegen der Werth des Rocks um die Hälfte, so 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke. Bei gleichbleibendem Werth der Waare A, fällt oder steigt daher ihr relativer, in der Waare B ausgedrückter Werth im umgekehrten Verhältniss zum Werthwechsel von B.
Vergleicht man die verschiedenen Fälle sub I und II, so ergiebt sich, dass derselbe Wechsel des relativen Werths aus ganzentgegengesetzten Ursachen entspringen kann. So wird aus 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke 1) die Gleichung 40 Ellen Leinwand = 4 Röcke, entweder weil der Werth der Leinwand sich verdoppelt oder der Werth der Röcke um die Hälfte fällt, und 2) die Gleichung 40 Ellen Leinwand = 1 Rock, entweder weil der Werth
der Leinwand um die Hälfte sinkt oder der Werth des Rockes auf das Doppelte steigt.
III. Die zur Produktion von Leinwand und Rock nothwendigen Arbeitsquanta wechseln gleichzeitig, in derselben Richtung und derselben Proportion. In diesem Falle nach wie vor 40 Ellen Leinwand = 2 Röcke, wie immer ihre Werthe verändert seien. Man entdeckt ihren Werthwechsel, sobald man sie mit einer dritten Waare vergleicht, deren Werth constant blieb. Stiegen oder fielen die Werthe aller Waaren gleichzeitig und in derselben Proportion, so blieben ihre relativen Werthe unverändert. Ihren wirklichen Werthwechsel ersähe man daraus, dass in derselben Arbeitszeit nun allgemein ein grösseres oder kleineres Waarenquantum als vorher geliefert würde.
IV. Die zur Produktion von Leinwand und Rock resp. nothwendigen Arbeitszeiten, und daher ihre Werthe, mögen gleichzeitig in derselben Richtung wechseln, aber in ungleichem Grad, oder in entgegengesetzter Richtung u. s. w. Der Einfluss aller möglichen derartigen Combinationen auf den relativen Werth einer Waare ergiebt sich einfach durch Anwendung der Fälle I., II. und III.
Wir haben eben untersucht, wie weit Wechsel in der relativen Werthgrösse einer Waare, der Leinwand, einen Wechsel ihrer eignen Werthgrösse wiederspiegelt, und überhaupt den relativen Werth nur nach seiner quantitativen Seite betrachtet. Wir wenden uns jetzt zu seiner Form. Wenn der relative Werth Darstellungsform des Werths, ist der Ausdruck der Aequivalenz zweier Waaren, wie x Waare A = y Waare B oder 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, die einfache Form desrelativen Werths.
I. Erste oder einfache Form des relativen Werths: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock. (x Waare A = y Waare B.)
Diese Form ist etwas schwierig zu analysiren, weil sie einfach ist(FN 16). Die in ihr enthaltenen unterschiedenen Bestimmungen sind verhüllt, unentwickelt, abstrakt und daher nur durch einige Anstrengung der Abstraktionskraft auseinanderund festzuhalten. So viel ergiebt sich
aber auf den ersten Blick, dass die Form dieselbe bleibt, ob 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder 20 Ellen Leinwand = x Röcke(FN 17).
Leinwand kömmt auf die Welt in Gestalt eines Gebrauchswerths oder nützlichen Dings. Ihre steifleinene Körperlichkeit oder Naturalform ist daher nicht ihre Werthform, sondern deren grades Gegentheil. Ihr eignes Werthsein zeigt sie zunächst dadurch, dass sie sich auf eine andre Waare, den Rock, als ihr Gleichesbezieht. Wäre sie nicht selbst Werth, so könnte sie sich nicht auf den Rock als Werth, als Ihresgleichen, beziehn. Qualitativ setzt sie sich den Rock gleich, indem sie sich auf ihn bezieht als Vergegenständlichung gleichartiger menschlicher Arbeit, d. h. ihrer eignen Werthsubstanz, und sie setzt sich nur einen Rock gleich statt x Röcke, weil sie nicht nur Werth überhaupt, sondern Werth von bestimmter Grösse ist, ein Rock aber grade soviel Arbeit enthält als 20 Ellen Leinwand. Durch diese Beziehung auf den Rock schlägt die Leinwand verschiedne Fliegen mit einer Klappe. Indem sie die andre Waare sich als Werth gleichsetzt, bezieht sie sich auf sich selbst als Werth. Indem sie sich auf sich selbst als Werth bezieht, unterscheidet sie sich zugleich von sich selbst als Gebrauchswerth. Indem sie ihre Werthgrösse — und Werthgrösse ist beides, Werth überhaupt und quantitativ gemessner Werth — im Rocke ausdrückt, giebt sie ihrem Werthsein eine von ihrem unmittelbaren Dasein unterschiedne Werthform. Indem sie sich so als ein in sich selbst Differenzirtes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Waare dar — nützliches Ding, das zugleich Werth ist. Soweit die Leinwand Gebrauchswerth, ist sie ein selbstständiges Ding. Ihr Werth erscheint dagegen nur im Verhältniss zu andrer Waare, dem Rocke z. B., ein Verhältniss, worin die Waarenart Rock ihr qualitativ gleichgesetzt wird und daher in bestimmter Quantität
gleichgilt, sie ersetzt, mit ihr austauschbar ist. Eigne, vom Gebrauchswerth unterschiedne Form erhält der Werth daher nur durch seine Darstellung als Tauschwerth.
Der Ausdruck des Leinwand werths im Rocke prägt dem Rocke selbst eine neue Form auf. In der That, was besagt die Werthform der Leinwand? Dass der Rock mit ihr austauschbar ist. Wie er geht oder liegt, mit Haut und Haaren, in seiner Naturalform Rock besitzt er jetzt die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andrer Waare, die Form eines austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents. Die Bestimmung des Aequivalents enthält nicht nur, dass eine Waare Werth überhaupt ist, sondern dass sie in ihrer dinglichen Gestalt, in ihrer Gebrauchsform, andrer Waare als Werth gilt und daher unmittelbar als Tauschwerth für die andre Waare da ist.
Als Werth besteht die Leinwand nur aus Arbeit, bildet eine durchsichtig krystallisirte Arbeitsgallerte. In der Wirklichkeit ist dieser Krystall jedoch sehr trüb. Soweit Arbeit in ihm zu entdecken, und nicht jeder Waarenkörper zeigt die Spur der Arbeit, ist es nicht unterschiedslose menschliche Arbeit, sondern Weberei, Spinnerei u. s. w., die auch keineswegs seine einzige Substanz bilden, vielmehr mit Naturstoffen verquickt sind. Um Leinwand als bloss dinglichen Ausdruck menschlicher Arbeit festzuhalten, muss man von allem absehn, was sie wirklich zum Ding macht. Gegenständlichkeit der menschlichen Arbeit, die selbst abstrakt ist, ohne weitere Qualität und Inhalt, ist nothwendig abstrakte Gegenständlichkeit, ein Gedankending. So wird das Flachsgewebe zum Hirngespinnst. Aber Waaren sind Sachen. Was sie sind, müssen sie sachlich sein oder in ihren eignen sachlichen Beziehungen zeigen. In der Produktion der Leinwand ist ein bestimmtes Quantum menschlicher Arbeitskraft verausgabt worden. Ihr Werth ist der bloss gegenständliche Reflex der so verausgabten Arbeit, aber er reflektirt sich nicht in ihrem Körper. Er offenbart sich, erhält sinnlichen Ausdruck durch ihr Werthverhältniss zum Rock. Indem sie ihn als Werth sich gleichsetzt, während sie sich zugleich als Gebrauchsgegenstand von ihm unterscheidet, wird der Rock die Erscheinungsform des LeinwandWerths im Gegensatz zum
LeinwandKörper, ihre Werthform im Unterschied von ihrer Naturalform(FN 18).
In dem relativen Werthausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder x Leinwand ist y Roc kwerth, gilt der Rock zwar nur als Werth oder Arbeitsgallerte, aber eben dadurch gilt die Arbeitsgallerte als Rock, der Rock als die Form, worin menschliche Arbeit gerinnt(FN 18a). Der Gebrauchswerth Rock wird nur zur Erscheinungsform des Leinwand-Werths, weil sich die Leinwand auf das Rockmaterial als unmittelbare Materiatur abstrakter menschlicher Arbeit bezieht, also Arbeit gleicher Art wie die in ihr selbst vergegenständlichte. Der Gegenstand Rock gilt ihr als sinnlich handgreifliche Gegenständlichkeit gleichartiger menschlicher Arbeit, daher als Werth in Naturalform. Da sie als Werth gleichen Wesens mit dem Rock ist, wird die Naturalform Rock so zur Erscheinungsform ihres eignen Werths. Aber die im Gebrauchswerth Rock dargestellte Arbeit ist nicht menschliche Arbeit schlechthin, sondern eine bestimmte, nützliche Arbeit, Schneiderarbeit. Menschliche Arbeit schlechthin, Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, ist zwar jeder Bestimmung fähig, aber an und für sich unbestimmt. Verwirklichen, vergegenständlichen kann sie sich nur, sobald die menschliche Arbeitskraft in bestimmter Form verausgabt wird, als bestimmte Arbeit, denn nur der bestimmten Arbeit steht ein Naturstoff gegenüber, ein äusseres Material, worin sie sich vergegenständlicht. Bloss der Hegel’sche „ Begriff“ bringt es fertig, sich ohne äussern Stoff zu objektiviren(FN 19).
Die Leinwand kann sich nicht auf den Rock als Werth oder incarnirte menschliche Arbeit beziehn, ohne sich auf Schneiderarbeit als die unmittelbare Verwirklichungsform menschlicher Arbeit zu beziehen. Was jedoch die Leinwand am Gebrauchswerth Rock interessirt, ist weder seine wollne Behäbigkeit, noch sein zugeknöpftes Wesen, noch irgend eine andre nützliche Qualität, die ihn zum Gebrauchswerth stempelt. Er dient ihr nur dazu, ihre Werthgegenständlichkeit im Unterschied von ihrer steifleinenen Gebrauchsgegenständlichkeit darzustellen. Sie hätte denselben Zweck erreicht, wenn sie ihren Werth in Assa Fötida oder Poudrette oder Stiefelwichse ausgedrückt. Die Schneiderarbeit gilt ihr daher ebenfalls nicht, sofern sie zweckmässig produktive Thätigkeit, nützliche Arbeit, sondern nur sofern sie als bestimmte Arbeit Verwirklichungsform, Vergegenständlichungsweise menschlicher Arbeit überhaupt ist. Drückte die Leinwand ihren Werth statt im Rock in Stiefelwichse aus, so gälte ihr auch statt Schneidern Wichsen als die unmittelbare Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit(FN 19a). Erscheinungsform des Werths oder Aequivalent wird ein Gebrauchswerth oder Waarenkörper also nur dadurch, dass sich eine andere Waare auf die in ihm enthaltne konkrete, nützliche Arbeitsart als die unmittelbare Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit bezieht.
Wir stehn hier bei dem Springpunkt aller Schwierigkeiten, welche das Verständniss der Werthform hindern. Es ist relativ leicht, den Werth der Waare von ihrem Gebrauchswerth zu unterscheiden, oder die den Gebrauchswerth formende Arbeit von derselben Arbeit, so weit sie bloss als Verausgabung mensehlicher Arbeitskraft im Waarenwerth berechnet wird. Betrachtet man Waare oder Arbeit in der einen Form, so nicht in der andern und vice versa. Diese abstrakten Gegensätze fallen von selbst auseinander und sind daher leicht auseinander zu halten. An-
ders mit der Werthform, die nur im Verhältniss von Waare zu Waare existirt. Der Gebrauchswerth oder Waarenkörper spielt hier eine neue Rolle. Er wird zur Erscheinungsform des Waare nwerths, also seines eignen Gegentheils. Ebenso wird die im Gebrauchswerth enthaltene konkrete nützliche Arbeit zu ihrem eignen Gegentheil, zur blossen Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit. Statt auseinanderzufallen, reflektiren sich die gegensätzlichen Bestimmungen der Waare hier in einander. So befremdlich diess auf ersten Blick, erweist es sich bei weiterem Nachdenken als nothwendig. Die Waare ist von Haus aus ein zwieschlächtig Ding, Gebrauchswerth und Werth, Produkt nützlicher Arbeit und abstrakte Arbeitsgallerte. Um sich darzustellen als das was sie ist, muss sie daher ihre Form verdoppeln. Die Form eines Gebrauchswerths besitzt sie von Natur. Es ist ihre Naturalform. Werthform erwirbt sie erst im Umgang mit andren Waaren. Aber ihre Werthform muss selbst wieder gegenständliche Form sein. Die einzigen gegenständlichen Formen der Waaren sind ihre Gebrauchsgestalten, ihre Naturalformen. Da nun die Naturalform einer Waare, der Leinwand z. B., das grade Gegentheil ihrer Werthform ist, muss sie eine andre Naturalform, die Naturalform einer andern Waare zu ihrer Werthform machen. Was sie nicht unmittelbar für sich selbst, kann sie unmittelbar für andre Waare und daher auf einem Umweg für sich selbst thun. Sie kann ihren Werth nicht in ihrem eignen Körper oder in ihrem eignen Gebrauchswerth ausdrücken, aber sie kann sich auf einen andern Gebrauchswerth oder Waarenkörper als unmittelbares Werthdasein beziehn. Sie kann sich nicht zu der in ihr selbst, wohl aber zu der in andrer Waarenart enthaltenen konkreten Arbeit als blosser Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit verhalten. Sie braucht dazu nur die andre Waare sich als Aequivalent gleichzusetzen. Der Gebrauchswerth einer Waare existirt überhaupt nur für eine andre Waare, soweit er in dieser Weise zur Erscheinungsform ihres Werths dient. Betrachtet man in dem einfachen relativen Werthausdrucke: x Waare A = y Waare B nur das quantitative Verhältniss, so findet man auch nur die oben entwickelten Gesetze über die Bewegung des relativen Werths, die alle darauf beruhn, dass die Werthgrösse der Waaren durch die zu ihrer Produktion nothwendige Arbeitszeit bestimmt ist. Betrachtet man aber das Werthverhältniss der beiden Waaren nach seiner qualitativen Seite,
so entdeckt man in jenem einfachen Werthausdruck das Geheimniss der Werthform und daher, in nuce, des Geldes(FN 20).
Unsre Analyse hat gezeigt, dass der relative Werthausdruck einer Waare zwei verschiedne Werthformen einschliesst. Die Leinwand drückt ihren Werth und ihre bestimmte Werthgrösse im Rock aus. Sie stellt ihren Werth dar im Werthverhältniss zu einer andern Waare, daher als Tauschwerth. Andrerseits die andre Waare, der Rock, worin sie ihren Werth relativ ausdrückt, erhält eben dadurch die Form eines mit ihr unmittelbar austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents. Beide Formen, relative Werthform der einen Waare, Aequivalentform der andern, sind Formen des Tauschwerths. Beide sind in der That nur Momente, wechselseitig durcheinander bedingte Bestimmungen, desselben relativen Werthausdrucks, aber polarisch vertheilt auf die zwei gleichgesetzten Waarenextreme.
Quantitative Bestimmtheit ist nicht in der Aequivalentform einer Waare eingeschlossen. Das bestimmte Verhältniss z. B., worin Rock Aequivalent von Leinwand ist, entspringt nicht aus seiner Aequivalentform, der Form seiner unmittelbaren Austauschbarkeit mit der Leinwand, sondern aus der Bestimmung der Werthgrösse durch Arbeitszeit. Die Leinwand kann ihren eignen Werth nur in Röcken darstellen, indem sie sich auf ein bestimmtes Rockquantum als gegebenes Quantum krystallisirter menschlicher Arbeit bezieht. Aendert sich der Roc kwerth, so ändert sich auch diese Beziehung. Damit sich aber der relative Werth der Leinwand ändere, muss er vorhanden sein, und er kann nur gebildet werden bei gegebenem Rockwerth. Ob die Leinwand ihren eignen Werth nun in 1, 2 oder x Röcken darstellt, hängt unter dieser Voraussetzung ganz von der Werthgrösse einer Elle Leinwand und der Ellenanzahl ab, deren Werth in Rockform dargestellt werden soll. Die Werthgrösse einer Waare kann sich nur im Gebrauchswerth einer andern Waare ausdrücken, als relativer Werth. Die Form eines
unmittelbar austauschbaren Gebrauchswerths oder Aequivalents erhält eine Waare dagegen umgekehrt nur als das Material, worin der Werth einer andern Waare ausgedrückt wird.
Diese Unterscheidung ist getrübt durch eine charakteristische Eigenthümlichkeit des relativen Werthausdrucks in seiner einfachen oder ersten Form. Die Gleichung: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, oder 20 Ellen Leinwand sind einen Rock werth, schliesst nämlich offenbar die identische Gleichung ein: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, oder 1 Rock ist 20 Ellen Leinwand werth. Der relative Werthausdruck der Leinwand, worin der Rock als Aequivalent figurirt, enthält also rückbezüglich den relativen Werthausdruck des Rocks, worin die Leinwand als Aequivalent figurirt.
Obgleich beide Bestimmungen der Werthform oder beide Darstellungsweisen des Waare nwerths als Tauschwerth nur relativ sind, scheinen beide nicht in demselben Grad relativ. Im relativen Werth der Leinwand: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, ist der Tauschwerth der Leinwand ausdrücklich als ihre Beziehung auf eine andre Waare dargestellt. Der Rock seinerseits ist zwar auch nur Aequivalent, so weit sich die Leinwand auf ihn als Erscheinungsform ihres eignen Werths und daher mit ihr unmittelbar Austauschbares bezieht. Nur innerhalb dieser Beziehung ist er Aequivalent. Aber er verhält sich passiv. Er ergreift keine Initiative. Er findet sich in Beziehung, weil sich auf ihn bezogen wird. Der Charakter, der ihm aus dem Verhältniss mit der Leinwand erwächst, erscheint daher nicht als Resultat seiner Beziehung, sondern ohne sein Zuthun vorhanden. Noch mehr. Die bestimmte Art und Weise, wie sich die Leinwand auf ihn bezieht, ist ganz dazu gemacht, es ihm „anzuthun“, wäre er auch noch so bescheiden und keineswegs das Produkt eines „tailor run mad with pride“. Die Leinwand bezieht sich nämlich auf den Rock als sinnlich existirende Materiatur der menschlichen Arbeit in abstracto und daher als vorhandnen Werthkörper. Er ist diess nur, weil und sofern sich die Leinwand in dieser bestimmten Weise auf ihn bezieht. Sein Aequivalentsein ist so zu sagen nur eine Reflexionsbestimmung der Leinwand. Aber es scheint grade umgekehrt. Einerseits giebt er sich selbst nicht die Mühe sich zu beziehn. Andrerseits bezieht sich die Leinwand auf ihn, nicht um ihn zu etwas zu machen, sondern weil er ohne sie etwas ist.
Das fertige Produkt der Beziehung der Leinwand auf den Rock, seine Aequivalentform, seine Bestimmtheit als unmittelbar austauschbarer Gebrauchswerth, scheint ihm daher auch ausserhalb der Beziehung zur Leinwand dinglich anzugehören, ganz wie etwa seine Eigenschaft warm zu halten. In der ersten oder einfachen Form des relativen Werths: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, ist dieser falsche Schein noch nicht befestigt, weil sie unmittelbar auch das Gegentheil aussagt, dass der Rock Aequivalent der Leinwand und dass jede der beiden Waaren diese Bestimmtheit nur besitzt, weil und sofern die andre sie zu ihrem relativen Werthausdruck macht(FN 21).
In der einfachen Form des relativen Werths oder dem Ausdrucke der Aequivalenz zweier Waaren, ist die Form entwicklung des Werths für beide Waaren gleichmässig, obgleich jedesmal in entgegengesetzter Richtung. Der relative Werthausdruck ist ferner mit Bezug auf jede der beiden Waaren einheitlich, denn die Leinwand stellt ihren Werth nur in einer Waare dar, dem Rocke und vice versa, aber für beide Waaren ist dieser Werthausdruck doppelt, verschieden für jede derselben. Endlich ist jede der beiden Waaren nur Aequivalent für die andre einzelne Waarenart. also nur einzelnes Aequivalent.
Solche Gleichung, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, oder zwanzig Ellen Leinwand sind einen Rock werth, drückt offenbar den Werth der Waare nur ganz beschränkt und einseitig aus. Vergleiche ich die Leinwand z. B., statt mit Röcken, mit andern Waaren, so erhalte ich auch andre relative Werthausdrücke, andre Gleichungen, wie 20 Ellen Leinwand = u Kaffee, 20 Ellen Leinwand = v Thee u. s. w. Die Leinwand hat eben so viele verschiedne relative Werthausdrücke, als es von ihr verschiedne Waaren giebt und die Zahl ihrer relativen Werthausdrücke wächst beständig mit der Zahl neu auftretender Waarenarten(FN 22).
Die erste Form 20 Ellen Leinwand = 1 Rock gab zwei relative Ausdrücke für den Werth zweier Waaren. Diese zweite Form giebt für den Werth derselben Waare die bunteste Mosaik relativer Ausdrücke. Auch scheint weder für den Ausdruck der Werth grösse irgend etwas gewonnen, denn in 20 Ellen Leinwand = 1 Rock ist die Werthgrösse der Leinwand, die ja in jedem Ausdrucke dieselbe bleibt, eben so erschöpfend dargestellt als in 20 Ellen Leinwand = u Thee u. s. w., noch für die Formbestimmung des Aequivalents, denn in 20 Ellen Leinwand = u Kaffee u. s. w., sind Kaffee u. s. w. nur einzelne Aequivalente, ganz wie es der Rock war.
Dennoch birgt diese zweite Form eine wesentliche Fortentwicklung. Es liegt darin nämlich nicht nur, dass die Leinwand ihren Werth zufällig bald in Rücken ausdrückt, bald in Kaffee u. s. w., sondern dass sie ihn sowohl in Röcken als in Kaffee u. s. w. ausdrückt, entweder in dieser Waare oder jener oder der dritten u. s. w. Die Weiterbestimmung zeigt sich, sobald diese zweite oder entfaltete Form des relativen Werthausdrucks in ihrem Zusammenhang dargestellt wird. Wir erhalten dann:
II. Zweite oder entfaltete Form des relativen Werths:
Zunächst bildet offenbar die erste Form das Grundelement der
zweiten, denn letztere besteht aus vielen einfachen relativen Werthausdrücken, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, 20 Ellen Leinwand = u Kaffee u. s. w.
In der ersten Form: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock kann es zufällige Thatsache scheinen, dass diese zwei Waaren in diesem bestimmten quantitativen Verhältnisse austauschbar sind. In der zweiten Form leuchtet dagegen sofort ein von der zufälligen Erscheinung wesentlich unterschiedner und sie bestimmender Hintergrund durch. Der Werth der Leinwand bleibt gleich gross, ob in Rock oder Kaffee oder Eisen u. s. w. dargestellt, in zahllos verschiednen Waaren, den verschiedensten Besitzern angehörig. Das zufällige Verhältniss zweier individueller Waarenbesitzer fällt fort. Es wird offenbar, dass nicht der Austausch die Werthgrösse der Waare, sondern umgekehrt die Werthgrösse der Waare ihre Austauschverhältnisse regulirt.
In dem Ausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock galt der Rock als Erscheinungsform der in der Leinwand vergegenständlichten Arbeit. So wurde die in der Leinwand enthaltene Arbeit der im Rock enthaltnen gleichgesetzt und daher als gleichartige menschliche Arbeit bestimmt. Indess trat diese Bestimmung nicht ausdrücklich hervor. Unmittelbar setzt die erste Form die in der Leinwand enthaltne Arbeit nur der Schneiderarbeit gleich. Anders die zweite Form. In der endlosen, stets verlängerbaren Reihe ihrer relativen Werthausdrücke bezieht sich die Leinwand auf alle möglichen Waarenkörper als blosse Erscheinungsformen der in ihr selbst enthaltenen Arbeit. Hier ist der Leinwand Werth daher erst wahrhaft dargestellt als Werth, d. h. Krystall menschlicher Arbeit überhaupt.
Die zweite Form besteht aus einer Summe von lauter Gleichungen der ersten Form. Jede dieser Gleichungen, wie 20 Ellen Leinwand = 1 Rock schliesst aber auch die Rückbeziehung ein: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, wo der Rock seinen Werth in der Leinwand und eben dadurch die Leinwand als Aequivalent darstellt. Da diess nun von jedem der zahllosen relativen Werthausdrücke der Leinwand gilt, erhalten wir:
III. Dritte, umgekehrte oder rückbezogene zweite Form des relativen Werths:
Der relative Werthausdruck der Waaren kehrt hier zurück in seiner ursprünglichen Gestalt: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand. Jedoch ist diese einfache Gleichung jetzt weiter entwickelt. Ursprünglich enthielt sie nur, dass der Rock werth durch seinen Ausdruck in einer andern Waare eine vom Gebrauchswerth Rock oder dem Rockkörper selbst unterschiedne und unabhängige Form erhält. Jetzt stellt dieselbe Form den Rock auch allen andern Waaren gegenüber als Werth dar und ist daher seine allgemein gültige Werthform. Nicht nur der Rock, sondern Kaffee, Eisen, Weizen, kurz alle andern Waaren drücken ihren Werth jetzt im Material Leinwand aus. Alle stellen sich so einander als dieselbe Materiatur menschlicher Arbeit dar. Sie sind nur noch quantitativ verschieden, wesswegen 1 Rock, u Kaffee, x Eisen u. s. w., d. h. verschiedne Quanta dieser verschiednen Dinge = 20 Ellen Leinwand, gleich demselben Quantum vergegenständlichter menschlicher Arbeit. Durch ihren gemeinschaftlichen Werthausdruck im Material Leinwand unterscheiden sich also alle Waaren als Tauschwerthe von ihren eignen Gebrauchswerthen und beziehn sich zugleich auf einander als Werthgrössen, setzen sich qualitativ gleich und vergleichen sich quantitativ. Erst in diesem einheitlichen relativen Werthausdruck erscheinen sie alle für einander als Werthe und erhält ihr Werth daher erst seine entsprechende Erscheinungsform als Tauschwerth. Im Unterschied zur entfalteten Form des relativen Werths (Form II), die den Werth einer Waare im Umkreis aller andern Waaren darstellt, nennen wir diesen einheitlichen Werthausdruck die allgemeine relative Werthform.
In der Form II: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = u Kaffee oder = v Thee oder = x Eisen u. s. w., worin die Leinwand ihren relativen Werthausdruck entfaltet, bezieht sie sich auf jede einzelne Waare, Rock, Kaffee u. s. w. als ein besondres Aequivalent und
auf alle zusammen als den Umkreis ihrer besondern Aequivalentformen. Ihr gegenüber gilt keine einzelne Waarenart noch als Aequivalent schlechthin, wie im einzelnen Aequivalent, sondern nur als besondres Aequivalent, wovon das eine das andre ausschliesst. In der Form III, welche die rückbezogene zweite Form und also in ihr eingeschlossen ist, erscheint die Leinwand dagegen als die Gattungsform des Aequivalents für alle andern Waaren. Es ist als ob neben und ausser Löwen, Tigern, Hasen und allen andern wirklichen Thieren, die gruppirt die verschiednen Geschlechter, Arten, Unterarten, Familien u. s. w. des Thierreichs bilden, auch noch das Thier existirte, die individuelle Incarnation des ganzen Thierreichs. Ein solches Einzelne, das in sich selbst alle wirklich vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein Allgemeines, wie Thier, Gott u. s. w. Wie die Leinwand daher einzelnes Aequivalent wurde, dadurch dass sich eine andre Waare auf sie als Erscheinungsform des Werths bezog, so wird sie als allen Waaren gemeinschaftliche Erscheinungsform des Werths das allgemeine Aequivalent, allgemeiner Werthleib, allgemeine Materiatur der abstrakten menschlichen Arbeit. Die in ihr materialisirte besondre Arbeit gilt daher jetzt als allgemeine Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, als allgemeine Arbeit.
Bei der Darstellung des Werths der Waare A in der Waare B, wodurch die Waare B einzelnes Aequivalent wird, war es gleichgültig, von welcher besondern Sorte die Waare B. Nur musste die Körperlichkeit der Waare B andrer Art sein als die der Waare A, daher auch Produkt andrer nützlicher Arbeit. Indem der Rock seinen Werth in Leinwand darstellte, bezog er sich auf Leinwand als die verwirklichte menschliche Arbeit, und eben dadurch auf Leineweberei als die Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, aber die besondre Bestimmtheit, welche Leineweberei von andern Arbeitsarten unterscheidet, war durchaus gleichgültig. Sie musste nur andrer Art sein als die Schneiderarbeit und im übrigen eine bestimmte Arbeitsart. Anders sobald die Leinwand allgemeines Aequivalent wird. Dieser Gebrauchswerth in seiner besondern Bestimmtheit, wodurch er Leinwand im Unterschied von allen andern Waarenarten, Kaffee, Eisen u. s. w., wird jetzt die allgemeine Werthform aller andern Waaren und daher allgemeines Aequivalent. Die
in ihm dargestellte besondre nützliche Arbeitsart gilt daher jetzt als allgemeine Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit, als allgemeine Arbeit, grade soweit sie Arbeit von besondrer Bestimmtheit ist, Leineweberei im Unterschied nicht nur von Schneiderarbeit, sondern von Kaffeebau, Minenarbeit und allen andern Arbeits arten. Umgekehrt gelten alle andren Arbeitsarten, im relativen Werthausdruck der Leinwand, des allgemeinen Aequivalents ( Form II), nur noch als besondre Verwirklichungsformen der menschlichen Arbeit.
Als Werthe sind die Waaren Ausdrücke derselben Einheit, der abstrakten menschlichen Arbeit. In der Form des Tauschwerths erscheinen sie einander als Werthe und beziehn sich auf einander als Werthe. Sie beziehn sich damit zugleich auf die abstrakte menschliche Arbeit als ihre gemeinsame gesellschaftliche Substanz. Ihr gesellschaftliches Verhältniss besteht ausschliesslich darin einander als nur quantitativ verschiedne, aber qualitativ gleiche und daher durch einander ersetzbare und mit einander vertauschbare Ausdrücke dieser ihrer gesellschaftlichen Substanz zu gelten. Als nützliches Ding besitzt eine Waare gesellschaftliche Bestimmtheit, soweit sie Gebrauchswerth für andre ausser ihrem Besitzer ist, also gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigt. Aber gleichgültig, auf wessen Bedürfnisse ihre nützlichen Eigenschaften sie beziehn, sie wird durch dieselben immer nur auf menschliche Bedürfnisse bezogener Gegenstand, nicht Waare für andre Waaren. Nur was blosse Gebrauchsgegenstände in Waaren verwandelt, kann sie als Waaren auf einander beziehn und daher in gesellschaftlichen Rapport setzen. Es ist diess aber ihr Werth. Die Form, worin sie sich als Werthe, als menschliche Arbeitsgallerte gelten, ist daher ihre gesellschaftliche Form. Gesellschaftliche Form der Waare und Werthform oder Form der Austauschbarkeit sind also eins und dasselbe. Ist die Naturalform einer Waare zugleich Werthform, so besitzt sie die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andern Waaren und daher unmittelbar gesellschaftliche Form.
Die einfache relative Werthform ( Form I) 1 Rock = 20 Ellen Leinwand unterscheidet sich von der allgemeinen relati
ven Werthform 1 Rock = 20 Ellen Leinwand nur dadurch, dass diese Gleichung jetzt ein Glied der Reihe bildet
Sie unterscheidet sich also in der That nur dadurch, dass die Leinwand aus einem einzelnen zum allgemeinen Aequivalent fortentwickelt ist. Wenn also im einfachen relativen Werthausdrucke nicht die Waare, die ihre Werthgrösse ausdrückt, sondern die Waare, worin Werthgrösse ausgedrückt wird, die Form unmittelbarer Austauschbarkeit, Aequivalentform, also unmittelbar gesellschaftliche Form erhält, so gilt dasselbe für den allgemeinen relativen Werthausdruck. Aber in der einfachen relativen Werthform ist dieser Unterschied nur noch formell und verschwindend. Wenn in 1 Rock = 20 Ellen Leinwand der Rock seinen Werth relativ, nämlich in Leinwand ausdrückt und die Leinwand dadurch Aequivalentform erhält, so schliesst dieselbe Gleichung unmittelbar die Rückbeziehung ein: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, worin der Rock die Aequivalentform erhält und der Werth der Leinwand relativ ausgedrückt wird. Diese gleichmässige und gegenseitige Entwicklung der Werthform beider Waaren als relativer Werth und als Aequivalent findet jetzt nicht länger statt. Wird die allgemeine relative Werthform 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, wo die Leinwand allgemeines Aequivalent, umgekehrt in 20 Ellen Leinwand = 1 Rock, so wird der Rock dadurch nicht allgemeines Aequivalent für alle andern Waaren, sondern nur ein besondres Aequivalent der Leinwand. Allgemein ist die relative Werthform des Rocks nur, weil sie zugleich die relative Werthform aller andern Waaren. Was vom Rock, gilt vom Kaffee u. s. w. Es folgt daher, dass die allgemeine relative Werthform der Waaren sie selbst von der allgemeinen Aequivalentform ausschliesst. Umgekehrt ist eine Waare, wie Leinwand, sobald sie die allgemeine Aequivalentform besitzt, von der allgemeinen relativen Werthform ausgeschlossen. Die allgemeine, mit den andern Waaren einheitliche relativc Werthform der Leinwand wäre: 20 Ellen Leinwand = 20 Ellen Leinwand. Diess ist aber eine Tautologie, welche die Werthgrösse dieser in allgemeiner Aequivalentform und daher in stets austauschbarer Form
befindlichen Waare nicht ausdrückt. Vielmehr wird die entfaltete relative Werthform: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = u Kaffee oder = v Thee oder = u. s. w. jetzt zum specifischen relativen Werthausdrucke des allgemeinen Aequivalents.
In dem allgemeinen relativen Werthausdruck der Waaren besitzt jede Waare, Rock, Kaffee, Thee u. s. w. eine von ihrer Naturalform verschiedne Werthform, nämlich die Form Leinwand. Und eben in dieser Form beziehn sie sich auf einander als Austauschbare und in quantitativ bestimmten Verhältnissen Austauschbare, denn wenn 1 Rock = 20 Ellen Leinwand, u Kaffee = 20 Ellen Leinwand u. s. w., so ist auch 1 Rock = u Kaffee u. s. w. Indem alle Waaren sich in einer und derselben Waare als Werthgrössen bespiegeln, wiederspiegeln sie sich wechselseitig als Werthgrössen. Aber die Naturalformen, die sie als Gebrauchsgegenstände besitzen, gelten ihnen wechselseitig nur auf diesem Umweg, also nicht unmittelbar als Erscheinungsformen des Werths. Sowie sie unmittelbar sind, sind sie daher nicht unmittelbar austauschbar. Sie besitzen also nicht die Form unmittelbarer Austauschbarkeit für einander oder ihre gesellschaftlich gültige Form ist eine vermittelte. Umgekehrt. Indem alle andern Waaren auf Leinwand als Erscheinungsform des Werths sich beziehen, wird die Naturalform der Leinwand die Form ihrer unmittelbaren Austauschbarkeit mit allen Waaren, daher unmittelbar ihre allgemein gesellschaftliche Form.
Eine Waare erhält nur die allgemeine Aequivalentform, weil und sofern sie allen andern Waaren zur Darstellung ihrer allgemeinen relativen, daher nicht unmittelbaren Werthform dient. Waaren müssen sich aber relative Werthform überhaupt geben, weil ihre Naturalformen nur ihre Gebrauchswerthformen, und sie müssen sich einheitliche, daher allgemeine relative Werthform geben, um sich alle als Werthe, als gleichartige Gallerten menschlicher Arbeit auf einander zu beziehen. Eine Waare befindet sich daher nur in der Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit allen andern Waaren und daher in unmittelbar gesellschaftlicher Form, weil und sofern alle andern Waaren sich nicht darin befinden, oder weil die Waare überhaupt sich von Haus aus nicht in unmittelbar austauschbarer oder gesellschaftlicher Form befindet,
indem ihre unmittelbare Form die Form ihres Gebrauchswerths, nicht ihres Werthes.
Man sieht es der Form allgemeiner unmittelbarer Austauschbarkeit in der That keineswegs an, dass sie eine gegensätzliche Waarenform ist, von der Form nicht unmittelbarer Austauschbarkeit ebenso unzertrennlich, wie die Positivität eines Magnetpols von der Negativität des andern. Man kann sich daher einbilden, man könne allen Waaren zugleich den Stempel unmittelbarer Austauschbarkeit aufdrücken, wie man sich auch einbilden kann, man könne alle Arbeiter zu Kapitalisten machen. In der That aber sind allgemeine relative Werthform und allgemeine Aequivalentform die gegensätzlichen, sich wechselweis voraussetzenden und wechselweis abstossenden Pole derselben gesellschaftlichen Form der Waaren(FN 23).
Als unmittelbar gesellschaftliche Materiatur der Arbeit ist die Leinwand, das allgemeine Aequivalent, Materiatur unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit, während die andern Waarenkörper, welche ihren Werth in Leinwand darstellen, Materiaturen nicht unmittelbar gesellschaftlicher Arbeiten sind.
In der That sind alle Gebrauchswerthe nur Waaren, weil Produkte von einander unabhängiger Privatarbeiten, Privatarbeiten, die jedoch als besondere, wenn auch verselbständigte, Glieder des naturwüchsigen Systems der Theilung der Arbeit stofflich von einander abhängen. Sie hängen so gesellschaftlich zusammen grade durch ihre Verschiedenheit, ihre besondre Nützlichkeit. Eben desswegen produciren sie qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe. Wenn
nicht, so würden diese Gebrauchswerthe nicht zu Waaren für einander. Andrerseits macht diese verschiedne nützliche Qualität Produkte noch nicht zu Waaren. Producirt eine bäuerliche Familie für ihren eignen Consum Rock und Leinwand und Weizen, so treten diese Dinge der Familie als verschiedne Produkte ihrer Familienarbeit gegenüber, aber nicht sich selbst wechselseitig als Waaren. Wäre die Arbeit unmittelbar gesellschaftliche, d. h. gemeinsame Arbeit, so erhielten die Produkte den unmittelbar gesellschaftlichen Charakter eines Gemeinprodukts für ihre Producenten, aber nicht den Charakter von Waaren für einander. Indess haben wir hier nicht weit zu suchen, worin die gesellschaftliche Form der in den Waaren enthaltenen und von einander unabhängigen Privatarbeiten besteht. Sie ergab sich bereits aus der Analyse der Waare. Ihre gesellschaftliche Form ist ihre Beziehung auf einander als gleiche Arbeit, also, da die Gleichheit toto coelo verschiedner Arbeiten nur in einer Abstraktion von ihrer Ungleichheit bestehen kann, ihre Beziehung auf einander als menschliche Arbeit überhaupt, Verausgabungen menschlicher Arbeitskraft, was alle menschlichen Arbeiten, welches immer ihr Inhalt und ihre Operationsweise, in der That sind. In jeder gesellschaftlichen Arbeitsform sind die Arbeiten der verschiednen Individuen auch als menschliche auf einander bezogen, aber hier gilt diese Beziehung selbst als die specifisch gesellschaftliche Form der Arbeiten. Nun besitzt aber keine dieser Privatarbeiten in ihrer Naturalform diese specifisch gesellschaftliche Form abstrakter menschlicher Arbeit, so wenig wie die Waare in ihrer Naturalform die gesellschaftliche Form blosser Arbeitsgallerte, oder des Werthes, besitzt. Dadurch aber dass die Naturalform einer Waare, hier der Leinwand, allgemeine Aequivalentform wird, weil sich alle andern Waaren auf dieselbe als Erscheinungsform ihres eignen Werths beziehn, wird auch die Leinweberei zur allgemeinen Verwirklichungsform abstrakter menschlicher Arbeit oder zu Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Der Massstab der „Gesellschaftlichkeit“ muss aus der Natur der jeder Produktionsweise eigenthümlichen Verhältnisse, nicht aus ihr fremden Vorstellungen entlehnt werden. Wie vorhin gezeigt ward, dass die Waare von Natur die unmittelbare Form allgemeiner Austauschbarkeit ausschliesst und die allgemeine Aequivalentform daher nur gegensätzlich entwickeln kann, so gilt dasselbe für die in den Waaren
steckenden Privatarbeiten. Da sie nicht unmittelbar gesellschaftliche Arbeit sind, so ist erstens die gesellschaftliche Form eine von den Naturalformen der wirklichen nützlichen Arbeiten unterschiedne, ihnen fremde, und abstrakte Form, und zweitens erhalten alle Arten Privatarbeit ihren gesellschaftlichen Charakter nur gegensätzlich, indem sie alle einer ausschliesslichen Art Privatarbeit, hier der Leineweberei, gleichgesetzt werden. Dadurch wird letztere die unmittelbare und allgemeine Erscheinungsform abstrakter menschlicher Arbeit und so Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Sie stellt sich daher auch unmittelbar in einem gesellschaftlich geltenden und allgemein austauschbaren Produkt dar.
Der Schein, als ob die Aequivalentform einer Waare aus ihrer eignen dinglichen Natur entspringe, statt blosser Reflex der Beziehungen der andern Waaren zu sein, befestigt sich mit der Fortbildung des einzelnen Aequivalents zum allgemeinen, weil die gegensätzlichen Momente der Werthform sich nicht mehr gleichmässig für die auf einander bezognen Waaren entwickeln, weil die allgemeine Aequivalentform eine Waare als etwas ganz apartes von allen andern Waaren scheidet und endlich weil diese ihre Form in der That nicht mehr das Produkt der Beziehung irgend einer einzelnen andern Waare ist.
Indess ist auf unserm jetzigen Standpunkt das allgemeine Aequivalent noch keineswegs verknöchert. Wie wurde in der That die Leinwand in das allgemeine Aequivalent verwandelt? Dadurch, dass sie ihren Werth erst in einer einzelnen Waare (Form I), dann in allen andern Waaren der Reihe nach relativ darstellte (Form II), und so rückbezüglich alle andern Waaren in ihr ihre Werthe relativ darstellten (Form III). Der einfache relative Werthausdruck war der Keim, woraus sich die allgemeine Aequivalentform der Leinwand entwickelte. Innerhalb dieser Entwicklung ändert sie die Rolle. Sie beginnt damit, ihre Werthgrösse in einer andern Waare darzustellen und endet damit zum Material für den Werthausdruck aller andern Waaren zu dienen. Was von der Leinwand, gilt von jeder Waare. In ihrem entfalteten relativen Werthausdrucke (Form II), der nur aus ihren vielen, einfachen Werthausdrücken besteht, figurirt die Leinwand noch nicht als allgemeines Aequivalent. Vielmehr bildet hier jeder andre Waarenkörper ihr Aequivalent, ist daher unmittelbar austauschbar mit ihr und kann also die Stelle mit ihr wechseln.
Wir erhalten daher schliesslich:
Form IV:
Aber jede dieser Gleichungen rückbezogen ergiebt Rock, Kaffee, Thee u. s. w. als allgemeines Aequivalent, daher den Werthausdruck in Rock, Kaffee, Thee u. s. w. als allgemeine relative Werthform aller andern Waaren. Die allgemeine Aequivalentform kommt immer nur einer Waare zu im Gegensatz zu allen andern Waaren; aber sie kommt jeder Waare im Gegensatz zu allen andern zu. Stellt aber jede Waare ihre eigne Naturalform allen andern Waaren gegenüber als allgemeine Aequivalentform, so schliessen alle Waaren alle von der allgemeinen Aequivalentform aus und daher sich selbst von der gesellschaftlich gültigen Darstellung ihrer Werthgrössen.
Man sieht: die Analyse der Waare ergiebt alle wesentlichen Bestimmungen der Werthform und die Werthform selbst in ihren gegensätzlichen Momenten, die allgemeine relative Werthform, die allgemeine Aequivalentform, endlich die nie abschliessende Reihe einfacher relativer Werthausdrücke, welche erst eine Durchgangsphase in der Entwicklung der Werthform bildet, um schliesslich in die specifisch relative Werthform des allgemeinen Aequivalents umzuschlagen. Aber die Analyse der Waare ergab diese Formen als Waarenformen überhaupt, die also auch jeder Waare zukommen, nur gegensätzlich, so dass wenn die Waare A sich in der einen Formbestimmung befindet, die Waaren B, C u. s. w. ihr gegenüber die andere annehmen. Das entscheidend Wichtige aber war den inneren nothwendigen Zusammenhang zwischen Wert hform, Wert hsubstanz und Wert hgrösse zu entdecken, d. h. ideell ausgedrückt, zu beweisen, dass die Wert hform aus dem Wert hbegriff entspringt(FN 24).
Eine Waare scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergiebt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voller metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Als blosser Gebrauchswerth ist sie ein sinnliches Ding, woran nichts Mysteriöses, ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, dass ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigen oder dass sie erst als Produkt menschlicher Arbeit diese Eigenschaften erhält. Es liegt absolut nichts räthselhaftes darin, dass der Mensch durch seine Thätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes z. B. wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres sinn-
liches Ding. Aber sobald er als Waare auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füssen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen andern Waaren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne(FN 25).
Der mystische Charakter der Waare entspringt also nicht aus ihrem Gebrauchswerth. Er entspringt ebensowenig aus den Werth bestimmungen, für sich selbst betrachtet. Denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Thätigkeiten sein mögen, es ist eine physiologische Wahrheit, dass sie Funktionen eines specifisch menschlichen Organismus im Unterschied von andern Organismen sind, und dass jede solche Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, Sinnesorgan u. s. w. ist. Was zweitens der Bestimmung der Werthgrösse zu Grunde liegt, die Zeitdauer jener Verausgabung oder die Quantität der Arbeit, so ist die Quantität sogar sinnfällig von der Qualität der Arbeit unterscheidbar. In allen Zuständen musste die Arbeit szeit, welche die Produktion der Lebensmittel kostet, den Menschen interessiren, obgleich nicht gleichmässig auf verschiednen Entwicklungsstufen. Endlich, sobald die Menschen in irgend einer Weise für einander arbeiten, erhält ihre Arbeit auch eine gesellschaftliche Form.
Nehmen wir den Robinson auf seiner Insel. Bescheiden, wie er von Haus aus ist, hat er doch verschiedenartige Bedürfnisse zu befriedigen und muss daher nützliche Arbeiten verschiedner Art verrichten, Werkzeuge machen, Möbel fabriciren, Lama zähmen, fischen, jagen u. s. w. Vom Beten u. dgl. sprechen wir hier nicht, da unser Robinson daran sein Vergnügen findet und derartige Thätigkeit als Erholung betrachtet. Trotz der Verschiedenheit seiner produktiven Funktionen weiss er, dass sie nur verschiedne Bethätigungsformen desselben Robinson, also nur verschiedne Weisen menschlicher Arbeit sind. Die Noth selbst zwingt ihn, seine Zeit genau zwischen seinen verschiednen Funktionen zu vertheilen. Ob die eine mehr, die andre weniger Raum in seiner Gesammtthätigkeit ein-
nimmt, hängt ab von der grössern oder geringern Schwierigkeit, die zur Erzielung des bezweckten Nutzeffekts zu überwinden ist. Die Erfahrung lehrt ihm das und unser Robinson, der Uhr, Hauptbuch, Tinte und Feder aus dem Schiffbruch gerettet, beginnt als guter Engländer bald Buch über sich selbst zu führen. Sein Inventarium enthält ein Verzeichniss der Gebrauchsgegenstände, die er besitzt, der verschiednen Verrichtungen, die zu ihrer Produktion erheischt sind, endlich der Arbeitszeit, die ihm bestimmte Quanta dieser verschiednen Produkte im Durchschnitt kosten. Alle Beziehungen zwischen Robinson und den Dingen, die seinen selbstgeschaffnen Reichthum bilden, sind hier so einfach und durchsichtig, dass selbst Herr M. Wirth sie ohne besondre Geistesanstrengung verstehn dürfte. Und dennoch sind darin alle wesentlichen Bestimmungen des Werths enthalten.
Setzen wir nun an die Stelle Robinson’s einen Verein freier Menschen, die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Alle Bestimmungen von Robinson’s Arbeit wiederholen sich, nur gesellschaftlich, statt individuell. Ein wesentlicher Unterschied tritt jedoch ein. Alle Produkte Robinson’s waren sein ausschliesslich persönliches Produkt und daher unmittelbar Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesammtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. Ein Theil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt gesellschaftlich. Aber ein anderer Theil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern verzehrt. Er muss daher unter sie vertheilt werden. Die Art dieser Vertheilung wird wechseln mit der besondern Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit der Waarenproduktion setzen wir voraus, der Antheil jedes Produzenten an den Lebensmitteln sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. Ihre gesellschaftlich planmässige Vertheilung regelt die richtige Proportion der verschiednen Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Mass des individuellen Antheils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell verzehrbaren Theil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Ar-
beitsprodukten blieben hier durchsichtig einfach, in der Produktion sowohl als in der Distribution.
Woher also der räthselhafte Charakter des Arbeitsprodukts, sobald es die Form der Waare annimmt?
Wenn die Menschen ihre Produkte auf einander als Werthe beziehn, sofern diese Sachen für bloss sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten, so liegt darin zugleich umgekehrt, dass ihre verschiednen Arbeiten nur als gleichartige menschliche Arbeit gelten in sachlicher Hülle. Sie beziehn ihre verschiednen Arbeiten auf einander als menschliche Arbeit, indem sie ihre Produkte auf einander als Werthe beziehn. Die persönliche Beziehung ist versteckt durch die sachliche Form. Es steht daher dem Werth nicht auf der Stirn geschrieben, was er ist. Um ihre Produkte auf einander als Waaren zu beziehn, sind die Menschen gezwungen, ihre verschiednen Arbeiten abstrakt menschlicher Arbeit gleichzusetzen. Sie wissen das nicht, aber sie thun es, indem sie das materielle Ding auf die Abstraktion Werth reduciren. Es ist diess eine naturwüchsige und daher bewusstlos instinktive Operation ihres Hirns, die aus der besondern Weise ihrer materiellen Produktion und den Verhältnissen, worin diese Produktion sie versetzt, nothwendig herauswächst. Erst ist ihr Verhältniss praktisch da. Zweitens aber, weil sie Menschen sind, ist ihr Verhältniss als Verhältniss für sie da. Die Art, wie es für sie da ist, oder sich in ihrem Hirn reflektirt, entspringt aus der Natur des Verhältnisses selbst. Später suchen sie durch die Wissenschaft hinter das Geheimniss ihres eignen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung eines Dings als Werth ist ihr Produkt, so gut wie die Sprache. Was nun ferner die Werthgrösse betrifft, so werden die unabhängig von einander betriebenen, aber, weil Glieder der naturwüchsigen Theilung der Arbeit, allseitig von einander abhängigen Privatarbeiten dadurch fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Mass reducirt, dass sich in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit als regelndes Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, wie etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt(FN 26).
Die Bestimmung der Werthgrösse durch die Arbeitszeit ist daher unter den erscheinenden Bewegungen der relativen Waarenwerthe verstecktes Geheimniss. Die eigne gesellschaftliche Bewegung der Produzenten besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Controle sie stehn, statt sie zu controliren. Was nun endlich die Werthform betrifft, so ist es ja grade diese Form, welche die gesellschaftlichen Beziehungen der Privatarbeiter und daher die gesellschaftlichen Bestimmtheiten der Privatarbeiten sachlich verschleiert, statt sie zu offenbaren. Wenn ich sage, Rock, Stiefel u. s. w. beziehn sich auf Leinwand als allgemeine Materiatur abstrakter menschlicher Arbeit, so springt die Verrücktheit dieses Ausdrucks ins Auge. Aber wenn die Produzenten von Rock, Stiefel u. s. w. diese Waaren auf die Leinwand als allgemeines Aequivalent beziehn, erscheint ihnen die gesellschaftliche Beziehung ihrer Privatarbeiten genau in dieser verrückten Form.
Derartige Formen bilden eben die Kategorien der bürgerlichen Oekonomie. Es sind gesellschaftlich gültige, also objektive Gedankenformen für Produktionsverhältnisse dieser historisch bestimmten gesellschaftlichen Produktionsweise.
Die Privatproduzenten treten erst in gesellschaftlichen Contakt vermittelst ihrer Privatprodukte, der Sachen. Die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Arbeiten sind und erscheinen daher nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten, sondern als sachliche Verhältnisse der Personen oder gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Die erste und allgemeinste Darstellung der Sache als eines gesellschaftlichen Dings ist aber die Verwandlung des Arbeitsprodukts in Waare.
Der Mysticismus der Waare entspringt also daraus, dass den Privatproduzenten die gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Privatarbeiten als gesellschaftliche Naturbestimmtheiten der Arbeitsprodukte, dass die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse der Personen als gesellschaftliche Verhält-
nisse der Sachen zu einander und zu den Personen erscheinen. Die Verhältnisse der Privatarbeiter zur gesellschaftlichen Gesammtarbeit vergegenständlichen sich ihnen gegenüber und existiren daher für sie in den Formen von Gegenständen. Für eine Gesellschaft von Waarenproducenten, deren allgemein gesellschaftliches Produktionsverhältniss darin besteht, sich zu ihren Produkten als Waaren, also als Werthen zu verhalten, und in dieser sachlichen Form ihre Privatarbeiten auf einander zu beziehn als gleiche menschliche Arbeit, ist das Christenthum, mit seinem Kultus des abstrakten Menschen, namentlich in seiner bürgerlichen Entwicklung, dem Protestantismus, Deismus u. s. w., die entsprechendste Religionsform. In den altasiatischen, antiken u. s. w. Produktionsweisen spielt die Verwandlung des Produkts in Waare, und daher das Dasein der Menschen als Waarenproduzenten, eine untergeordnete Rolle, die jedoch um so bedeutender wird, je mehr die Gemeinwesen in das Stadium ihres Untergangs treten. Eigentliche Handelsvölker existiren nur in den Intermundien der alten Welt, wie Epikurs Götter, oder wie Juden in den Poren der polnischen Gesellschaft. Jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen sind ausserordentlich viel einfacher und durchsichtiger als der bürgerliche, aber sie beruhen entweder auf der Unreife des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen Gattungszusammenhangs mit Andern noch nicht losgerissen hat, oder auf unmittelbaren Herrschaftsund Knechtschaftsverhältnissen. Sie sind bedingt durch eine niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit und entsprechend befangene Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher zu einander und zur Natur. Diese wirkliche Befangenheit spiegelt sich ideell wieder in den alten Naturund Volksreligionen. Der religiöse Wiederschein der wirklichen Welt kann nur verschwinden, sobald die Verhältnisse des praktischen Werkeltagslebens den Menschen tagtäglich durchsichtig vernünftige Beziehungen zu einander und zur Natur darstellen. Die Verhältnisse können sich aber nur als das darstellen, was sie sind. Die Gestalt des gesellschaftlichen Lebensprozesses, d. h. des materiellen Produktionsprozesses, streift nur ihren mystischen Nebelschleier ab, sobald sie als Produkt frei vergesellschafteter Menschen unter deren bewusster planmässiger Controle steht. Dazu ist jedoch eine materielle Grundlage der Gesellschaft erheischt oder eine Reihe materieller Existenzbedingungen,
welche selbst wieder das naturwüchsige Produkt einer langen und qualvollen Entwicklungsgeschichte sind.
Die politische Oekonomie hat nun zwar, wenn auch unvollkommen(FN 27), Werth und Werthgrösse analysirt. Sie hat niemals auch nur die Frage gestellt, warum sich die Arbeit im Werth und das Mass der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Werthgrösse darstellt? Formen, denen es auf der Stirn geschrieben steht, dass sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozess die Menschen, der Mensch noch
nicht den Produktionsprozess bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewusstsein für eben so selbstverständliche Naturnothwendigkeit als die produktive Arbeit selbst. Vorbürgerliche Formen des gesellschaftlichen Produktionsorganismus werden daher von ihr behandelt, wie etwa von den Kirchenvätern vorchristliche Religionen(FN 28).
Wie sehr ein Theil der Oekonomen von dem der Waarenwelt anklebenden Fetischismus oder dem gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Arbeitsbestimmungen getäuscht wird, beweist u. a. der langweilig abgeschmackte Zank über die Rolle der Natur in der Bildung des Tauschwerths. Da Tauschwerth eine bestimmte gesellschaft-
liche Manier ist, die auf ein Ding verwandte Arbeit auszudrücken, kann er nicht mehr Naturstoff enthalten als etwa der Wechselkurs.
Als allgemeinste und unentwickeltste Form der bürgerlichen Produktion, welche desswegen auch schon in früheren Produktionsperioden erscheint, obgleich nicht in derselben herrschenden, also charakteristischen Weise, war die Waarenform noch relativ leicht zu durchschauen. Aber konkretere Formen, wie das Kapital z. B.? Der Fetischismus der klassischen Oekonomie wird hier handgreiflich.
Um jedoch nicht vorzugreifen, genüge hier noch ein Beispiel bezüglich der Waarenform selbst. Man hat gesehn, dass in der Beziehung von Waare auf Waare, z. B. von Stiefel auf Stiefelknecht, der Gebrauchswerth des Stiefelknechts, also die Nützlichkeit seiner wirklichen dinglichen Eigenschaften dem Stiefel durchaus gleichgültig ist. Nur als Erscheinungsform ihres eignen Werths interessirt die Stiefel waare der Stiefelknecht. Könnten die Waaren also sprechen, so würden sie sagen, unser Gebrauchswerth mag den Menschen interessiren. Er kömmt uns nicht als Dingen zu. Was uns aber dinglich zukömmt, ist unser Werth. Unser eigner Verkehr als Waarendinge beweist das. Wir beziehn uns nur als Tauschwerthe auf einander. Man höre nun, wie der Oekonom aus der Waarenseele heraus spricht: „ Werth (Tauschwerth) ist Eigenschaft der Dinge, Reichthum (Gebrauchswerth) des Menschen. Werth in diesem Sinn schliesst nothwendig Austausch ein, Reichthum nicht(FN 29).“
„Reichthum (Gebrauchswerth) ist ein Attribut des Menschen, Werth ein Attribut der Waaren. Ein Mensch oder ein Gemeinwesen ist reich; eine Perle oder Diamant ist werthvoll … Eine Perle oder Diamant hat Werth als Perle oder Diamant(FN 30).“ Bisher hat noch kein Chemiker Tauschwerth in Perle oder Diamant entdeckt. Unsere Verfasser, die besondern Anspruch auf kritische Tiefe machen, finden aber, dass der Gebrauchswerth der Sachen unabhängig von ihren sachlichen Eigenschaften, dagegen ihr Tauschwerth ihnen als Sachen zukömmt. Was sie hierin bestätigt, ist der sonderbare Umstand, dass der Gebrauchswerth der Dinge sich für den Menschen ohne Austausch realisirt, also im unmittelbaren Verhältniss zwischen Ding und Mensch, ihr Werth umgekehrt nur im Austausch, d. h. in einem gesellschaftlichen Prozess. Wer erinnert sich hier nicht des guten Dogberry, der den Nachtwächter Seacoal belehrt: „Ein gut aussehender Mann zu sein, ist eine Gabe der Umstände, aber Lesen und Schreiben zu können, kömmt von Natur(FN 31)“.
Die Waare ist unmittelbare Einheit von Gebrauchswerth und Tauschwerth, also zweier Entgegengesetzten. Sie ist daher ein unmittelbarer Widerspruch. Dieser Widerspruch muss sich entwickeln, sobald sie nicht wie bisher analytisch bald unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchswerths, bald unter dem Gesichtspunkt des Tauschwerths betrachtet, sondern als ein Ganzes wirklich auf andere Waaren bezogen wird. Die wirkliche Beziehung der Waaren aufeinander ist aber ihr Austauschprozess.
Die Waaren können nicht selbst zu Markte gehn und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach ihren Hütern umsehn, den Waarenbesitzern. Die Waaren sind Dinge und daher widerstandslos gegen den Menschen. Wenn sie nicht willig, kann er Gewalt brauchen, in andern Worten sie nehmen(FN 32). Um diese Dinge als Waaren auf einander zu beziehn, müssen die Waarenhüter sich aufeinander als Personen beziehn, deren Willen ein Dasein in jenen Dingen hat, sodass Jeder nur mit seinem Willen und dem Willen des andern, beide also nur mit ihrem gemeinschaftlichen Willen sich die fremde Waare aneignen, indem sie die eigne veräussern und die eigne veräussern, um sich die fremde anzueignen. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigenthümer anerkennen. Diess Rechtsverhältniss, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist nur das Willensverhältniss, worin sich das ökonomische Verhältniss wiederspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältniss selbst gegeben(FN 33). Die Personen beziehn sich hier nur auf einander, indem sie gewisse Sachen als Waaren auf einander beziehn. Alle Bestimmungen dieser Beziehung sind also in der
Bestimmung der Sache als Waare enthalten. Der eine Mensch existirt hier nur für den andern als Repräsentant von Waare und daher als Waarenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten.
Was den Waarenbesitzer namentlich von der Waare unterscheidet, ist der Umstand, dass ihr der Gebrauchswerth jeder andern Waare nur als Erscheinungsform ihres eignen Werths gilt. Geborner Leveller und Cyniker steht sie daher stets auf dem Sprung mit jeder andern Waare, sei selbe auch ausgestattet mit mehr Unannehmlichkeiten als Maritorne, nicht nur die Seele, sondern den Leib zu wechseln. Diesen der Waare mangelnden Sinn für das Konkrete des Waare nkörpers ergänzt der Waarenbesitzer durch seine eignen fünf und mehr Sinne. Seine Waare hat für ihn keinen unmittelbaren Gebrauchswerth. Sonst führte er sie nicht zu Markt. Sie hat Gebrauchswerth für andre. Für ihn hat sie unmittelbar nur den Gebrauchswerth Träger von Tauschwerth und so Tauschmittel zu sein(FN 34). Darum will er sie veräussern für Waare, deren Gebrauchswerth ihm genüge thut. Alle Waaren sind NichtGebrauchswerthe für ihre Besitzer, Gebrauchswerthe für ihre Nicht-Besitzer. Sie müssen also allseitig die Hände wechseln. Aber dieser Händewechsel bildet ihren Austausch und ihr Austausch bezieht sie als Werthe auf einander und realisirt sie als Werthe. Die Waaren müssen sich daher als Werthe realisiren, bevor sie sich als Gebrauchswerthe realisiren können.
Andrerseits müssen sie sich als Gebrauchswerthe bewähren, bevorsie sich als Werthe realisiren können. Denn die auf
sie verausgabte menschliche Arbeit zählt nur, soweit sie in nützlicher Form verausgabt und zwar nützliche Arbeit für andre ist. Ob sie andern nützlich, ihr Produkt daher fremde Bedürfnisse befriedigt, kann aber nur ihr Austausch beweisen.
Jeder Waarenbesitzer will seine Waare nur veräussern gegen andre Waare, deren Gebrauchswerth sein Bedürfniss befriedigt. Sofern ist der Austausch für ihn nur individueller Prozess. Andrerseits will er seine Waare als Werth realisiren, also in jeder ihm beliebigen andern Waare von demselben Werth, ob seine eigne Waare nun für den Besitzer der andern Waare Gebrauchswerth habe oder nicht. Sofern ist der Austausch für ihn allgemein gesellschaftlicher Prozess. Aber derselbe Prozess kann nicht gleichzeitig für alle Waarenbesitzer nur individuell und zugleich nur allgemein gesellschaftlich sein.
Sehn wir näher zu, so gilt jedem Waarenbesitzer jede fremde Waare als besondres Aequivalent seiner Waare, seine Waare daher als allgemeines Aequivalent aller andern Waaren. Da aber alle Waarenbesitzer dasselbe thun, ist keine Waare allgemeines Aequivalent und besitzen die Waaren daher auch keine allgemeine relative Werthform, worin sie sich als Werthe gleichsetzen und als Werthgrössen vergleichen. Sie stehn sich daher überhaupt nicht gegenüber als Waaren, sondern nur als Produkte oder Gebrauchswerthe.
In ihrer Verlegenheit denken unsre Waarenbesitzer wie Faust. Im Anfang war die That. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Die Gesetze der Waarennatur bethätigen sich im Naturinstinkt der Waarenbesitzer. Sie können ihre Waaren nur als Werthe und darum nur als Waaren auf einander beziehn, indem sie dieselben gegensätzlich auf irgend eine andre Waare als allgemeines Aequivalent beziehn. Das ergab die Analyse der Waare. Aber nur die gesellschaftliche That kann eine bestimmte Waare zum allgemeinen Aequivalent machen. Die gesellschaftliche Action aller andern Waaren schliesst daher eine bestimmte Waare aus, worin sie allseitig ihre Werthe darstellen. Dadurch wird die Naturalform dieser Waare gesellschaftlich gültige Aequivalentform. Allgemeines Aequivalent zu sein wird durch den gesellschaftlichen Prozess zur specifisch gesellschaftlichen Funktion der ausgeschlossenen Waare. So wird sie — Geld. „Illi unum consilium habent et virtutem
et potestatem suam bestiae tradunt. Et ne quis possit emere aut vendere, nisi qui habet characterem aut nomen bestiae, aut numerum nominis ejus.“ (Apocalypse.)
Der Geldkrystall ist nothwendiges Produkt des Austauschprozesses der Waaren. Der immanente Widerspruch der Waare als unmittelbarer Einheit von Gebrauchswerth und Tauschwerth, als Produkt nützlicher Privatarbeit, die ein nur vereinzeltes Glied eines naturwüchsigen Gesammtsystems der nützlichen Arbeiten oder der Theilung der Arbeit bildet, und als unmittelbar gesellschaftliche Materiatur abstrakter menschlicher Arbeit — dieser Widerspruch ruht und rastet nicht, bis er sich zur Verdopplung der Waare in Waare und Geld gestaltet hat. In demselben Masse daher, worin sich die Verwandlung der Arbeitsprodukte in Waaren, vollzieht sich die Verwandlung von Waare in Geld(FN 35).
Der unmittelbare Produktenaustausch hat einerseits die Form des einfachen relativen Werthausdrucks und hat sie andrerseits noch nicht. Jene Form war: x Waare A = y Waare B. Die Form des unmittelbaren Produktenaustauschs ist: x Gebrauchsgegenstand A = y Gebrauchsgegenstand B(FN 36). Die Dinge A und B sind hier nicht Waaren vor dem Austausch, sondern werden es erst durch denselben. Die erste Weise, worin ein Gebrauchsgegenstand der Möglichkeit nach Tauschwerth ist, ist sein Dasein als Nicht-Gebrauchswerth, als die unmittelbaren Bedürfnisse seines Besitzers überschiessendes Quantum von Gebrauchswerth. Dinge sind an und für sich dem Menschen äusserlich und daher veräusserlich. Damit diese Veräusserung wechselseitig, brauchen Menschen nur stillschweigend als Privateigenthümer jener ver-
äusserlichen Dinge und eben dadurch als von einander unabhängige Personen einander gegenübertreten. Solch ein Verhältniss wechselseitiger Fremdheit existirt jedoch nicht für die Glieder eines naturwüchsigen Gemeinwesens, habe es nun die Form einer patriarchalischen Familie, einer altindischen Gemeinde, eines Inkastaates u. s. w. Der Waarenaustausch beginnt, wo die Gemeinwesen enden, an den Punkten ihres Contakts mit fremden Gemeinwesen oder Gliedern fremder Gemeinwesen. Sobald Dinge aber einmal im auswärtigen, werden sie auch rückschlagend im innern Gemeinleben zu Waaren. Ihr quantitatives Austauschverhältniss ist zunächst ganz zufällig. Austauschbar sind sie durch den Willensakt ihrer Besitzer sie wechselseitig zu veräussern. Sie erhalten daher die Form Austauschbarer, bevor sie als Werthe entwickelt sind. Indess setzt sich das Bedürfniss für fremde Gebrauchsgegenstände allmälig fest. Die beständige Wiederholung des Austauschs macht ihn zu einem regelmässigen gesellschaftlichen Prozess. Im Laufe der Zeit muss daher wenigstens ein Theil der Arbeitsprodukte absichtlich zum Behuf des Austauschs producirt werden. Von diesem Augenblick befestigt sich einerseits die Scheidung zwischen der Nützlichkeit der Dinge für den unmittelbaren Bedarf und ihrer Nützlichkeit zum Austausch. Ihr Gebrauchswerth scheidet sich von ihrem Tauschwerthe. Andrerseits wird das quantitative Verhältniss, worin sie sich austauschen, von ihrer Produktion selbst abhängig. Die Gewohnheit fixirt sie als Werth grössen.
Im unmittelbaren Produktenaustausch ist jede Waare unmittelbar Tauschmittel für ihren Besitzer, Aequivalent für ihren Nichtbesitzer, jedoch nur so weit sie Gebrauchswerth für ihn. Der Tauschartikel erhält also noch keine von seinem eignen Gebrauchswerth oder dem individuellen Bedürfniss der Austauscher unabhängige Werthform. Die Nothwendigkeit dieser Form entwickelt sich mit der wachsenden Anzahl und Mannigfaltigkeit der in den Austauschprozess eintretenden Waaren. Die Aufgabe entspringt gleichzeitig mit den Mitteln ihrer Lösung. Ein Verkehr, welcher die Waarenbesitzer treibt, ihre eigenen Artikel mit verschiedenen andern Artikeln auszutauschen und daher zu vergleichen, findet niemals statt, ohne dass verschiedene Waaren von verschiedenen Waarenbesitzern innerhalb ihres Verkehrs mit einer und derselben dritten Waarenart ausgetauscht und als Werthe verglichen werden. Solche dritte Waare, indem sie Aequivalent für verschiedene andere Waaren wird, erhält
unmittelbar, wenn auch in engen Grenzen, allgemeine oder gesellschaftliche Aequivalentform. Diese allgemeine Aequivalentform entsteht und vergeht mit dem augenblicklichen gesellschaftlichen Contakt, der sie ins Leben rief. Abwechselnd und flüchtig kommt sie dieser und jener Waare zu. Mit der Entwicklung des Waarenaustauschs heftet sie sich aber ausschliesslich fest an besondere Waarenarten, oder krystallisirt zur Geldform. An welcher Waarenart sie kleben bleibt, ist zunächst zufällig. Jedoch entscheiden im Grossen und Ganzen zwei Umstände. Die Geldform heftet sich entweder an die wichtigsten Eintauschartikel aus der Fremde, welche in der That naturwüchsige Erscheinungsformen des Tauschwerths der einheimischen Produkte sind. Oder an den Gebrauchsgegenstand, welcher das Hauptelement des einheimischen veräusserlichen Besitzthums bildet, wie Vieh z. B. Nomadenvölker entwickeln zuerst die Geldform, weil all ihr Hab und Gut sich in beweglicher, daher unmittelbar veräusserlicher Form befindet, und weil ihre Lebensweise sie beständig mit fremden Gemeinwesen in Contakt bringt, daher zum Produktenaustausch sollicitirt. Die Menschen haben oft den Menschen selbst in der Gestalt des Sklaven zum ursprünglichen Geldmaterial gemacht, aber niemals den Grund und Boden. Solche Idee konnte nur in bereits ausgebildeter bürgerlicher Gesellschaft aufkommen. Sie datirt vom letzten Drittheil des 17. Jahrhunderts und ihre Ausführung, auf nationalem Massstab, wurde erst ein Jahrhundert später in der bürgerlichen Revolution der Franzosen versucht.
In demselben Verhältniss, worin der Waarenaustausch seine nur lokalen Bande sprengt, der Waaren werth sich daher zur Materiatur menschlicher Arbeit überhaupt ausweitet, geht die Geldform auf Waaren über, die von Natur zur gesellschaftlichen Funktion eines allgemeinen Aequivalents taugen, auf die edlen Metalle.
Dass nun, „obgleich Gold und Silber nicht von Natur Geld, Geld von Natur Gold und Silber ist“(FN 37), zeigt die Congruenz ihrer Natureigenschaften mit seinen Funktionen(FN 38). Bisher kennen wir aber nur
die eine Funktion des Geldes, als Erscheinungsform des Waare nwerths zu dienen oder als das Material, worin die Werthgrössen der Waaren sich gesellschaftlich ausdrücken. Adäquate Erscheinungsform von Werth oder Materiatur abstrakter und daher gleicher menschlicher Arbeit kann nur eine Materie sein, deren sämmtliche Exemplare dieselbe gleichförmige Qualität besitzen. Andrerseits, da der Unterschied der Werthgrössen rein quantitativ ist, verschiedne Quanta geronnener Arbeitszeit ausdrückt, muss die Geldwaare rein quantitativer Unterschiede fähig, also nach Willkühr theilbar und aus ihren Theilen wieder zusammensetzbar sein. Gold und Silber besitzen aber diese Eigenschaften von Natur.
Der Gebrauchswerth der Geldwaare verdoppelt sich. Neben ihrem besondern Gebrauchswerth als Waare, wie Gold z. B. zum Ausstopfen hohler Zähne, Rohmaterial von Luxusartikeln u. s. w. dient, erhält sie einen formalen Gebrauchswerth, der aus ihren specifischen gesellschaftlichen Funktionen entspringt.
Da alle andern Waaren nur besondere Aequivalente des Geldes, das Geld ihr allgemeines Aequivalent, verhalten sie sich als besondre Waaren zum Geld als der allgemeinen Waare(FN 39).
Man hat gesehn, dass die Geldform nur der an einer Waare festhaftende Reflex der Beziehungen aller andern Waaren. Dass Geld Waare ist(FN 40), ist also nur eine Entdeckung für den, der von seiner fertigen Gestalt ausgeht, um sie hinterher zu analysiren. Der Austauschprozess giebt der Waare, die er in Geld verwandelt, nicht ihren Werth,
sondern ihre spezifische Wert hform. Die Verwechslung beider Bestimmungen verleitete dazu, den Werth von Gold und Silber für imaginär zu halten(FN 41). Weil Geld in bestimmten Funktionen durch blosse Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann, entsprang der andere Irrthum, es sei ein blosses Zeichen. Andrerseits lag darin die Ahnung, dass die Geldform des Dings ihm selbst äusserlich und blosse Erscheinungsform dahinter versteckter menschlicher Verhältnisse. In diesem Sinn wäre jede Waare ein Zeichen, weil als Werth nur sachliche Hülle der auf sie verausgabten menschlichen Arbeit(FN 42). Indem man aber die gesellschaft-
lichen Charaktere, welche Sachen oder die sachlichen Charaktere, welche gesellschaftliche Bestimmungen der Arbeit auf Grundlage einer bestimmten Produktionsweise erhalten, für blosse Zeichen, erklärt man sie zugleich für willkührliches Reflexionsprodukt der Menschen. Es war diess beliebte Aufklärungsmanier des 18. Jahrhunderts, um den räthselhaften Gestalten menschlicher Verhältnisse, deren Entstehungsprozess es noch nicht entziffern konnte, vorläufig wenigstens den Schein der Fremdheit abzustreifen.
Es ward vorhin bemerkt, dass die Aequivalentform einer Waare die quantitative Bestimmung ihrer Werth grösse nicht einschliesst. Weiss man, dass Gold Geld, daher mit allen andern Waaren unmittelbar austauschbar ist, so weiss man desswegen nicht, wie viel z. B. 10 Pfund Gold werth sind. Wie jede Waare kann das Geld seine eigne Werthgrösse nur relativ in andern Waaren ausdrücken. Sein eigner Werth ist bestimmt durch die zu seiner Produktion erheischte Arbeitszeit und drückt sich in dem Quantum jeder andern Waare aus, worin gleichviel Arbeitszeit geronnen ist(FN 43). Diese Festsetzung seiner relativen Werthgrösse findet statt an seiner Produktionsquelle in unmittelbarem Tauschhandel. Sobald es als Geld in den Austauschprozess eintritt, ist sein Werth bereits gegeben. Wenn es schon in den letzten Decennien des 17. Jahrhunderts weit überschrittener Anfang der Geldanalyse, zu wissen, dass Geld Waare ist, so aber auch nur der Anfang. Die Schwierigkeit
liegt nicht darin zu begreifen, dass Geld Waare, sondern wie, warum, wodurch Waare Geld ist(FN 44).
Wir sahen, wie schon in dem einfachsten Ausdruck des Tauschwerths: x Waare A = y Waare B, das Ding, worin die Werthgrösse eines andern Dings dargestellt wird, seine Aequivalentform unabhängig von dieser Beziehung als gesellschaftliche Natureigenschaft zu besitzen scheint. Wir verfolgten die Befestigung dieses falschen Scheins. Er ist vollendet, sobald die allgemeine Aequivalentform mit der Naturalform einer besondern Waarenart verwachsen oder zur Geldform krystallisirt ist. Eine Waare scheint nicht erst Geld zu werden, weil die andern Waaren allseitig ihre Werthe in ihr darstellen, sondern sie scheinen umgekehrt allgemein ihre Werthe in ihr darzustellen, weil sie Geldist. Die vermittelnde Bewegung verschwindet in ihrem eignen Resultat und lässt keine Spur zurück. Ohne ihr Zuthun finden die Waaren ihre eigne Werthgestalt fertig vor als einen ausser und neben ihnen existirenden Waarenkörper. Diese Dinge, Gold und Silber, wie sie aus den Eingeweiden der Erde herauskommen, sind zugleich die unmittelbare Incarnation aller menschlichen Arbeit. Daher die Magie des Geldes. Das bloss atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produktionsprozess und daher die von ihrer Controle und ihrem bewussten individuellen Thun unabhängige, sachliche Gestalt ihrer eignen Produk-
tionsverhältnisse erscheinen zunächst darin, dass ihre Arbeitsprodukte allgemein die Waarenform annehmen. Das Räthsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar gewordne, die Augen blendende Räthsel des Waarenfetischs selbst.
Ich setze überall in dieser Schrift, der Vereinfachung halber, Gold als die Geldwaare voraus.
Dadurch dass sich die Waaren in Gold ihren allgemeinen relativen Werthausdruck geben, funktionirt das Gold ihnen gegenüber als Mass der Werthe. Die Waaren werden nicht durch das Geld commensurabel. Umgekehrt. Weil alle Waaren als Werthe vergegenständlichte menschliche Arbeit, daher an und für sich commensurabel sind, können sie sich alle in irgend einer dritten Waare messen und diese dadurch in ihr gemeinschaftliches Werthmass oder Geld verwandeln. Geld als Werthmass ist aber nothwendige Erscheinungsform des immanenten Werthmasses der Waaren, der Arbeitszeit(FN 45).
Der einfache relative Werthausdruck der Waaren in Geld — x Waare A = y Geldwaare — ist ihr Preis. In ihren Preisen erscheinen die Waaren erstens als Werthe, qualitativ Gleiche,
Materiatur derselben Arbeit oder dieselbe Materiatur der Arbeit, Gold, zweitens als quantitativ bestimmte Werthgrössen, denn in der Proportion, worin sie gleich bestimmten Goldquanta, sind sie einander gleich oder stellen gleiche Arbeitsquanta vor. Andrerseits wird der entfaltete relative Werthausdruck oder die endlose Reihe relativer Werthausdrücke zur spezifisch relativen Werthform der Geldwaare. Diese Reihe ist aber jetzt schon gegeben in den Waarenpreisen. Man lese die Quotationen eines Preiscourants rückwärts und man findet die Werthgrösse des Geldes in allen möglichen Waaren dargestellt. Die Reihe hat auch neuen Sinn erhalten. Das Gold, weil Geld, besitzt bereits in seiner Naturalform die allgemeine Aequivalentform oder die Form allgemeiner unmittelbarer Austauschbarkeit unabhängig von seinen relativen Werthausdrücken. Ihre Reihe stellt jetzt daher zugleich, ausser seiner Werthgrösse, die entfaltete Welt des stofflichen Reichthums oder der Gebrauchswerthe vor, worin es unmittelbar umsetzbar ist. Geld hat dagegen keinen Preis. Um an dieser einheitlichen relativen Werthform der andern Waaren theilzunehmen, müsste es auf sich selbst als sein eignes Aequivalent bezogen werden.
Für die Bewegung der Waarenpreise gelten die früher gegebnen Gesetze des einfachen relativen Werthausdrucks. Die Waare npreise können nur allgemein steigen, bei gleichbleibendem Gel dwerth, wenn die Waare nwerthe steigen, bei gleichbleibenden Waare nwerthen, wenn der Gel dwerth fällt. Umgekehrt. Die Waare npreise können nur allgemein fallen, bei gleichbleibendem Geldwerth, wenn die Waare nwerthe fallen, bei gleichbleibenden Waarenwerthen, wenn der Gel dwerth steigt. Es folgt daher keineswegs, dass steigender Geldwerth proportionelles Sinken der Waarenpreise und fallender Geldwerth proportionelles Steigen der Waarenpreise bedingt. Diess gilt nur für Waaren von unverändertem Werth. Solche Waaren z. B., deren Werth gleichmässig und gleichzeitig steigt mit dem Geldwerth, behalten dieselben Preise. Steigt ihr Werth langsamer oder rascher als der Geldwerth, so wird der Fall oder das Steigen ihrer Preise beschränkt durch die Differenz zwischen ihrer Werthbewegung und der des Geldes u. s. w.
Die preisbestimmte Waare hat doppelte Form, reelle und vorgestellte oder ideelle. Ihre wirkliche Gestalt ist die eines Ge-
brauchsgegenstandes, eines Produkts konkreter nützlicher Arbeit, z. B. Eisen. Ihre Werthgestalt, ihre Erscheinungsform als Materiatur eines bestimmten Quantums gleichartiger menschlicher Arbeit, ist ihr Preis, ein Quantum Gold. Aber Gold ist vom Eisen verschiednes Ding und in seinem Preise bezieht das Eisen sich selbst auf Gold als ein andres Ding, das jedoch ihm WerthGleiches ist. Der Preis oder die Geldform der Waare existirt nur in dieser gleichsetzenden Beziehung, also so zu sagen nur in ihrem Kopfe, und ihr Besitzer muss seine Zunge in ihren Kopf stecken oder ihr Papierzettel anhängen, um ihren Preis für die Aussenwelt vorzustellen(FN 46). Die Form ihres Werths ist daher vorgestellte, ideelle Geldform im Unterschied zur handgreiflich reellen Körperform ihres Gebrauchswerths. Da die Waaren so ihre Werthe nur ideell im Geld ausdrücken, drücken sie dieselben auch in nur vorgestelltem oder ideellem Geld aus. Mass der Werthe ist das Geld daher nur als vorgestelltes ideelles Geld. Jeder Waarenbesitzer weiss, dass er kein wirkliches Gold verbraucht, wenn er Waaren in Gold schätzt oder dem Waare nwerth die Form des Waare npreises giebt. Obgleich nun das Geld als Werthmass nur ideell funktionirt, hängt der Preis dennoch ganz vom reellen Geldmaterial ab. Denn eine Waare, eine Tonne Eisen z. B., wird in ihrem Preise als Materiatur eines bestimmten Quantums Arbeit auf bestimmtes Quantum Geldmaterial als Materiatur desselben Quantums Arbeit bezogen, aber dasselbe Quantum Arbeit materialisirt sich in ganz verschiednen Quanta Gold, Sil-
ber oder Kupfer. Der Werth einer Tonne Eisen erhält also ganz verschiedne Preisausdrücke, je nachdem Gold, Silber oder Kupfer als Werthmass funktionirt.
Die preisbestimmten Waaren stellen sich alle dar in der Form: a Waare A = x Gold; b Waare B = z Gold, c Waare C = y Gold u. s. w., wo a, b, c bestimmte Masse der Waarenarten A, B, C, x, z, y bestimmte Masse des Goldes. Die Waare nwerthe sind daher verwandelt in vorgestellte Goldquanta von verschiedner Grösse, also, trotz der wirren Buntheit der Waarenkörper, in gleichnamige Grössen, Goldgrössen. Verschiedne Goldquanta, weil gleichnamige Grössen, vergleichen und messen sich unter einander, indem sie auf ein fixirtes Quantum Gold als ihre Masseinheit bezogen werden. Diese Masseinheit selbst wird durch weitere Eintheilung in aliquote Theile zum Massstab fortentwickelt. Solche Massstäbe besassen Gold, Silber, Kupfer bereits in ihren Metallgewichten, bevor sie Geld wurden. Ihr vorgefundener metallischer Gewichtmassstab dient daher ursprünglich auch stets in ihrer Geldfunktion.
Die Geldnamen der Metallgewichte trennen sich jedoch nach und nach von ihren ursprünglichen Gewichtnamen aus verschiedenen Gründen, darunter historisch entscheidend: 1) Einführung fremden Geldes bei minder entwickelten Völkern, wie z. B. im alten Rom Silberund Goldmünzen zuerst als ausländische Waaren circulirten. Die Namen dieses fremden Gelds sind von den einheimischen Gewichtnamen verschieden. 2) Mit der Entwicklung des Reichthums wird das minder edle Metall durch das edlere aus der Funktion des Werthmasses verdrängt, Kupfer durch Silber, Silber durch Gold, so sehr diese Reihenfolge aller poetischen Chronologie widersprechen mag(FN 46a). Pfund war nun z. B. Geldname für ein wirkliches Pfund Silber. Sobald Gold das Silber als Werthmass verdrängt, hängt sich derselbe Name vielleicht an u. s. w. Pfund Gold, je nach dem Werthverhältniss von Gold und Silber. Pfund als Geldname und als gewöhnlicher Gewichtname des Goldes sind jetzt getrennt. 3) Die Jahrhunderte lang fortgesetzte Geldfälschung der Fürsten, welche vom ursprünglichen Gewicht der Geldmünzen in der That nur den Namen zurückliess.
Diese historischen Prozesse machen die Trennung des Geldnamens der Metallgewichte von ihrem gewöhnlichen Gewichtnamen zur Volksgewohnheit. Bei definitiver Reglung des Geldmassstabs, die einerseits rein conventionell ist, andrerseits gesetzlicher Allgemeinheit und Zwangsgültigkeit bedarf, versteht es sich zuletzt von selbst, dass die Staatsautorität einen bestimmten Gewichttheil des edlen Metalls, z. B. eine Unze Gold, als Gewichteinheit fixirt und diese abtheilt in aliquote Theile, denen sie beliebige legale Taufnamen beilegt, wie Pfund, Thaler u. s. w. Solcher aliquote Theil, der dann als die eigentliche Masseinheit des Geldes gilt, wird weiter getheilt und untergetheilt in andre aliquote Theile, die ihrerseits gesetzliche Taufnamen erhalten, wie Shilling, Penny u. s. w. Nach wie vor bleiben bestimmte Metallgewichte Massstab des Metallgelds. Was sich geändert, ist Eintheilung und Namengebung.
Die Waaren verwandeln Gold in das Mass der Werthe, indem sie allseitig ihre Werthe in ihm ausdrücken. So erhalten ihre Werthgrössen die Form der Preise oder vorgestellter Goldquanta. Diese Verwandlung von Werth in Preis einmal vollbracht, wird es technisch nothwendig, das Mass der Werthe weiter zu bestimmen zum Massstab der Preise. Beide Funktionen sind durchaus verschieden. Als Massstab der Preise kann und muss ein bestimmtes Quantum Gold fixirt werden, grade wie der Massstab andrer gleichnamiger Grössen. Der Werthwechsel des Goldes ändert nichts am Werthverhältniss seiner verschiednen Gewichttheile unter einander und die gesetzlich fixirten Taufnamen dieser Theile ändern nichts an ihrem Gewicht. Der Massstab der Preise misst aber nur verschiedne Quanta Gold an einem fixirten Goldquantum, nicht den Werth eines Goldquantums durch das Gewicht des andern.
Der Werthwechsel des Goldes verhindert auch nicht seine Funktion als Werthmass. Er trifft alle Waaren gleichzeitig, lässt also, caeteris paribus, ihre wechselseitigen relativen Werthe unverändert, obgleich sie sich nun alle in höheren oder niedrigeren Goldpreisen als zuvor ausdrücken.
Die Waaren stellen ihre Werthe jetzt nicht nur gleichnamig als Gold, sondern in denselben gesellschaftlich gültigen Rechennamen des Goldmassstabs, wie Pfd. St. s. d. u. s. w., dar. Das Geld dient als Rechengeld, so oft es gilt eine Sache als Werth und daher in Geldform zu fixiren.
Der Name einer Sache ist ihrer Natur ganz äusserlich und daher erlischt auch ihre Begriffsbestimmung in ihm. Ich weiss nichts vom Menschen, wenn ich weiss, dass ein Mensch Jakobus heisst. Ebenso verschwindet in den Geldnamen Pfund, Thaler, Frank, Dukat u. s. w. jede Spur des Werthverhältnisses. Die Wirre über den Geheimsinn dieser kabbalistischen Zeichen ist um so grösser als die Geldnamen zugleich den Werth der Waaren und aliquote Theile eines Goldgewichts, des Geldmassstabs, und das eine nur darstellen, weil das andre(FN 47). Andrerseits ist es nothwendig, dass der Werth im Unterschied von den bunten Körpern der Waaren sich zu dieser begriffslos sachlichen, aber auch einfach gesellschaftlichen Form fortentwickle.
Der Preis ist der Geldname der in der Waare vergegenständlichten Arbeitszeit. Die Aequivalenz der Waare und des Geldquantums, dem ihr Preis sie gleichsetzt, ist daher eine Tautologie(FN 48), wie ja überhaupt der relative Werthausdruck einer Waare stets der Ausdruck der Aequivalenz zweier Waaren ist. Wenn aber der Preis als Exponent der Werthgrösse der Waare Exponent ihres Austauschverhältnisses mit Geld ist, so folgt nicht umgekehrt, dass der Exponent ihres Austauschverhältnisses mit Geld nothwendig der Exponent ihrer Werthgrösse ist. Gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit
von gleicher Grösse stelle sich in 1 Quarter Weizen und in 2 Pfd. St. (ungefähr ½ Unze Gold) dar. Die 2 Pfd. St. sind Geldausdrücke der Werthgrösse des Quarter Weizen, oder sein Preis. Erlauben nun die Umstände, ihn zu 3 Pfd. St., oder zwingen sie ihn zu 1 Pfd. St. zu notiren, so sind 1 Pfd. St. und 3 Pfd. St. als Ausdrücke der Wert hgrösse des Weizens zu klein oder zu gross, aber sie sind dennoch Preise desselben, denn erstens sind sie seine Werthform, Geld, und zweitens Exponente seines Austauschverhältnisses mit Geld. Bei gleichbleibenden Produktionsbedingungen oder gleichbleibender Produktivkraft der Arbeit muss nach wie vor zur Reproduktion des Quarter Weizen gleich viel gesellschaftliche Arbeitszeit verausgabt werden. Dieser Umstand hängt weder vom Willen des Weizenproduzenten noch der andern Waarenbesitzer ab. Die Werthgrösse der Waare drückt also ein nothwendiges, ihrem Bildungsprozess immanentes Verhältniss zur gesellschaftlichen Arbeitszeit aus. Mit der Verwandlung der Werthgrösse in Preis erscheint diess nothwendige Verhältniss als Austauschverhältniss der Waare mit einer andern ausser ihr existirenden Waare. Diese Form kann aber ebensowohl die Werthgrösse der Waare als das zufällige Verhältniss ausdrücken, worin sie unter gegebnen Umständen veräusserlich ist. Die Möglichkeit quantitativer Incongruenz zwischen Preis und Werthgrösse, oder der Abweichung des Preises von der Werthgrösse, ist also in der Preisform selbst gegeben. Es ist diess kein Mangel dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktionsweise, worin sich die Regel nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann.
Die Preisform lässt jedoch nicht nur die Möglichkeit quantitativer Incongruenz zwischen Werthgrösse und Preis, d. h. zwischen der Werthgrösse und ihrem eignen Geldausdruck zu, sondern kann einen qualitativen Widerspruch beherbergen, so dass der Preis überhaupt aufhört, Werthausdruck zu sein, obgleich Geld nur die Werthform der Waaren ist. Dinge, die an und für sich keine Waaren sind, z. B. Gewissen, Ehre u. s. w., können ihren Besitzern gegen Geld veräusserlich sein und so durch ihren Preis die Waarenform erhalten. Ein Ding kann daher formell einen Preis haben, ohne einen Werth zu haben. Der Preisausdruck wird hier imaginär, wie gewisse Grössen der Mathematik oder das „unendliche Urtheil“ der Logik. Wo wir jedoch für
wesentliche Produktionsverhältnisse derartige imaginäre Preisform finden, wie z. B. Preis des Grund und Bodens, obgleich der Boden, weil keine menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht ist, auch keinen Werth hat, wird die tiefere Analyse unter der imaginären Form stets ein wirkliches Werthverhältniss oder von ihm abgeleitete Beziehung verborgen finden.
Doch kehren wir zurück zum normalen Waarenpreis, der uns hier allein noch bekannt ist. Der Preis ist die nurideelle Werthgestalt der Waare. Er drückt also zugleich aus, dass sie noch nicht reelle Werthgestalt besitzt oder dass ihre Naturalform nicht ihre allgemeine Aequivalentform ist. Die ideelle Werthgestalt der Waare ist ferner Preis, d. h. nur vorgestellte oder ideelle Goldgestalt. Er drückt also aus, dass, um die Wirkung eines Tauschwerths oder allgemeinen Aequivalents auf andre Waaren auszuüben, sie ihren natürlichen Leib abstreifen, sich aus nur vorgestelltem Gold in wirkliches Gold verwandeln muss, obgleich diese Transsubstantiation ihr „saurer“ ankommen mag als dem hegel’schen „Begriff“ der Uebergang aus der Nothwendigkeit in die Freiheit oder einem Hummer das Sprengen seiner Schale, oder dem Kirchenvater Hieronymus das Abstreifen des alten Adam(FN 49). Neben ihrer reellen Gestalt, Eisen z. B., kann die Waare im Preis ideelle Werthgestalt oder vorgestellte Goldgestalt besitzen, aber sie kann nicht zugleich wirklich Eisen und wirklich Gold sein. Für ihre Preisgebung genügt es, vorgestelltes Gold ihr gleichzusetzen. Durch Gold ist sie zu ersetzen, damit sie ihrem Besitzer den Dienst eines allgemeinen Aequivalents leiste. Träte der Besitzer des Eisens z. B. dem Besitzer einer weltlustigen Waare gegenüber, und verwiese ihn auf den Eisen preis, der Geld form sei, so würde der Weltlustige antworten, wie im Himmel der heilige Petrus dem Dante, der ihm die Glaubens formeln hergesagt:
„Assai bene è trascorsa D’esta moneta già la lega e’l peso, Ma dimmi se tu l’hai nella tua borsa.“
Die Preisform schliesst die Veräusserlichkeit der Waaren gegen Geld und die Nothwendigkeit dieser Veräusserung ein. Die Preisbestimmung der Waaren hat andrerseits eine im Austauschprozess befindliche Waare, das Gold, bereits zu Geld gemacht. Im ideellen Mass der Werthe lauert daher das harte Geld.
Man sah, dass der Austauschprozess der Waaren widersprechende und einander ausschliessende Beziehungen einschloss. Die Entwicklung der Waare, die wir eben betrachtet, hebt diese Widersprüche nicht auf, aber sie schafft die Form, worin sie sich bewegen können. Diess ist überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche Widersprüche lösen. Es ist z. B. ein Widerspruch, dass ein Körper beständig in einen andern fällt und eben so beständig von ihm weg flieht. Die Ellipse ist eine der Bewegungsformen, worin dieser Widerspruch sich eben so sehr verwirklicht als löst.
Soweit der Austauschprozess der Waaren sie aus der Hand, worin sie Nicht-Gebrauchswerthe, in die Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerthe, ist er gesellschaftlicher Stoffwechsel. Das Produkt einer nützlichen Arbeitsweise ersetzt das der andern. Einmal angelangt zur Stelle, wo sie als Gebrauchswerth gilt, dient die Waare als Gebrauchsgegenstand oder fällt in die Sphäre der Consumtion aus der Sphäre des Waarenaustauschs. Letztre allein interessirt uns hier. Wir haben also den ganzen Prozess nach der Formseite zu betrachten, also nur den Formwechsel oder die Metamorphose der Waaren, welche den gesellschaftlichen Stoffwechsel vermittelt.
Die durchaus mangelhafte Auffassung dieses Formwechsels, der Funktionen des Geldes, der daraus entspringenden verschiednen Formbestimmtheiten, die das Geld aus seinen verschiednen Funktionen schöpft, ist, abgesehn von Unklarheit über den Werthbegriff selbst, dem Umstand geschuldet, dass jeder Formwechsel einer Waare sich im Austausch zweier Waaren, der Waare und der Geldwaare, darstellt. Hält man an diesem stofflichen Moment, dem Austausch von Waare und Gold, allein fest,
so übersieht man grade, was man sehn soll, nämlich was sich mit der Form zuträgt. Man übersieht, dass die Bestimmung des Goldes als Geld bereits eine Formbestimmung ist, die ihm nicht als blosser Waare gehört, dass die andern Waaren sich in ihren Preisen selbst auf das Gold als ihre eigne Geldgestalt beziehn, und dass es seinerseits nur die allgemeine unmittelbare Aequivalentform erhält, weil die Waaren überhaupt sich eine allgemeine relative Werthform geben müssen.
Die Waaren gehn zunächst unvergoldet, unverzuckert, wie der Kamm ihnen gewachsen ist, den Austauschprozess ein. Er produzirt die Verdopplung der Waare in Waare und Geld, ein äusserer Gegensatz, worin sie ihren immanenten Gegensatz von Gebrauchswerth und Tauschwerth darstellen. In diesem Gegensatz treten die Waaren als Gebrauchswerthe dem Geld als Tauschwerth gegenüber. Andrerseits sind beide Seiten des Gegensatzes Waaren, also Einheiten von Gebrauchswerth und Werth. Aber diese Einheit von Unterschieden stellt sich auf jedem der beiden Pole umgekehrt dar und stellt dadurch zugleich deren Wechselbeziehung dar. Die Waare ist reell Gebrauchswerth, ihr Werthdasein erscheint nur ideell im Preis, der sie auf das gegenüberstehende Gold als ihre reelle Werthgestalt bezieht. Umgekehrt gilt das Goldmaterial nur als Werthmateriatur Geld. Es ist reell daher all gemeines Aequivalent, Tauschwerth. Sein Gebrauchswerth erscheint nur noch ideell in der Reihe der relativen Werthausdrücke, worin es sich auf die gegenüberstehenden Waaren als den Umkreis seiner reellen Gebrauchsgestalten bezieht. Diese gegensätzlichen Formen der Waaren sind die wirklichen Bewegungsformen ihres Austauschprozesses.
Begleiten wir nun irgend einen Waarenbesitzer, unsern altbekannten Leinweber z. B., zur Scene des Austauschprozesses, dem Waare nmarkt. Seine Waare, 20 Ellen Leinwand, ist preisbestimmt. Ihr Preis ist 2 Pfd. St. Er tauscht sie aus gegen 2 Pfd. St., und, Mann von altem Schrot und Korn, tauscht die 2 Pfd. St. wieder aus gegen eine Familienbibel vom selben Preis. Die Leinwand, für ihn nur Waare, Werthträger, wird entäussert gegen Gold, ihre Werthgestalt, und aus dieser Gestalt rückveräussert gegen eine andere Waare, die Bibel, die aber als Gebrauchsgegenstand in’s Weberhaus wandern und dort Erbauungsbedürfnisse befrie-
digen soll. Der Austauschprozess der Waare vollzieht sich also in zwei entgegengesetzten und einander ergänzenden Metamorphosen — Verwandlung der Waare in Geld und ihre Rückverwandlung aus Geld in Waare(FN 50). Die Momente der Waarenmetamorphose sind zugleich Händel des Waarenbesitzers — Verkauf, Austausch der Waare mit Geld, Kauf, Austausch des Gelds mit Waare, und Einheit beider Akte: Verkaufen um zu kaufen.
Besieht sich der Leinweber nun das Endresultat des Handels, so besitzt er Bibel statt Leinwand, statt seiner ursprünglichen Waare eine andre vom selben Werth, aber verschiedner Nützlichkeit. In gleicher Weise eignet er sich seine verschiednen Lebensund Produktionsmittel an. Von seinem Standpunkt vermittelt der ganze Prozess, die Geldwerdung der Leinwand und die Waarenwerdung des Geldes, Verkauf und Kauf, nur den Austausch seines Arbeitsprodukts mit fremdem Arbeitsprodukt, den Produktenaustausch.
Der Austauschprozess der Waare vollzieht sich also in folgendem Formwechsel: Waare — Geld — Waare. W — G — W.
Nach ihrem stofflichen Inhalt ist die Bewegung W — W, Austausch von Waare gegen Waare, Stoffwechsel der gesellschaftlichen Arbeit, in dessen Resultat der Prozess selbst erlischt.
W — G. Erste Metamorphose der Waare oder Verkauf: Das Ueberspringen des Waare nwerths aus dem Waarenleib in den Goldleib ist, wie ich es anderswo bezeichnet, der salto mortale der Waare. Misslingt er, so ist zwar nicht die Waare geprellt, wohl aber der Waarenbesitzer. Die gesellschaftliche Theilung der Arbeit macht seine Arbeit ebenso einseitig als seine Bedürfnisse vielseitig. Eben desswegen dient ihm sein Produkt nur als Tauschwerth, allgemeines Aequivalent. Allgemeine, gesellschaftlich gültige Aequivalentform erhält es
aber nur im Geld und das Geld befindet sich in fremder Tasche. Um es herauszuziehn, muss die Waare vor allem Gebrauchswerth für den Geldbesitzer sein, die auf sie verausgabte Arbeit also in gesellschaftlich nützlicher Form verausgabt sein oder sich als Glied der gesellschaftlichen Theilung der Arbeit bewähren. Aber die Theilung der Arbeit ist ein naturwüchsiger Produktionsorganismus, dessen Fäden hinter dem Rücken der Waarenproducenten gewebt wurden und sich fortweben. Vielleicht ist die Waare Produkt einer neuen Arbeitsweise, die ein neu aufgekommenes Bedürfniss zu befriedigen vorgiebt oder auf eigne Faust ein Bedürfniss erst hervorrufen will. Gestern noch eine Funktion unter den vielen Funktionen eines und desselben Waarenproducenten, reisst sich eine besondre Arbeitsverrichtung heute vielleicht los von diesem Zusammenhang, verselbstständigt sich und schickt eben desswegen ihr Theilprodukt als selbstständige Waare zu Markt. Die Umstände mögen reif oder unreif sein für diesen Scheidungsprozess. Das Produkt befriedigt heute ein gesellschaftliches Bedürfniss. Morgen wird es vielleicht ganz oder theilweise von einer ähnlichen Produktenart aus seinem Platze verdrängt. Ist auch die Arbeit, wie die unsres Leinwebers, patentirtes Glied der gesellschaftlichen Arbeitstheilung, so ist damit noch keineswegs der Gebrauchswerth grade seiner 20 Ellen Leinwand garantirt. Wenn das gesellschaftliche Bedürfniss für Leinwand, und es hat sein Mass, wie alles andre, bereits durch nebenbuhlerische Leinweber gesättigt ist, wird das Produkt unsres Freundes überschüssig, überflüssig und damit nutzlos. Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul, aber er beschreitet nicht den Markt, um Präsente zu machen. Gesetzt aber der Gebrauchswerth seines Produkts bewähre sich und Geld werde daher angezogen von der Waare. Aber nun fragt sich’s, wie viel Geld? Die Antwort ist allerdings schon anticipirt im Preis der Waare, dem Exponenten ihrer Werthgrösse. Wir sehn ab von etwaigen rein subjektiven Rechenfehlern des Waarenbesitzers, die auf dem Markt sofort objectiv corrigirt werden. Er soll auf sein Produkt nur den gesellschaftlich nothwendigen Durchschnitt von Arbeitszeit verausgabt haben. Der Preis der Waare ist also nur Geldname des in ihr vergegenständlichten Quantums gesellschaftlicher Arbeit. Aber ohne Erlaubniss und hinter dem Rücken unsres Leinwebers geriethen die altverbürgten Produktionsbedingungen der Leinweberei in Gährung. Was gestern zweifelsohne gesellschaftlich nothwendige Ar-
beitszeit zur Produktion einer Elle Leinwand war, hört heute auf es zu sein, wie der Geldbesitzer eifrigst demonstrirt aus den Preisquotationen verschiedner Nebenbuhler unsres Freundes. Zu seinem Unglück giebt’s viele Weber auf der Welt. Gesetzt endlich jedes auf dem Markt vorhandne Stück Leinwand enthalte nur gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit. Trotzdem kann die Gesammtsumme dieser Stücke überflüssig verausgabte Arbeitszeit enthalten. Vermag der Marktmagen das Gesammtquantum Leinwand, zum Normalpreis von 2 Sh. per Elle, nicht zu absorbiren, so beweist das, dass ein zu grosser Theil der gesellschaftlichen Gesammtarbeitszeit in der Form der Leinweberei verausgabt wurde. Die Wirkung ist dieselbe als hätte jeder einzelne Leinweber mehr als die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit auf sein individuelles Produkt verwandt. Hier heisst’s: Mitgefangen, mitgehangen. Alle Leinwand auf dem Markt gilt nur als ein Handelsartikel, jedes Stück nur als aliquoter Theil. Und in der That ist der Werth jeder individuellen Elle ja auch nur die Materiatur desselben gesellschaftlich bestimmten Quantums gleichartiger menschlicher Arbeit.
Man sieht, die Waare liebt das Geld, aber „the course of true love runs never smooth.“ Ebenso naturwüchsig zufällig, wie die qualitative, ist die quantitative Gliederung des gesellschaftlichen Produktionsorganismus, der seine membra disjecta im System der Theilung der Arbeit darstellt. Unsere Waarenbesitzer entdecken daher, dass dieselbe Theilung der Arbeit, die sie zu unabhängigen Privatproducenten, den gesellschaftlichen Produktionsprozess und ihre Verhältnisse in diesem Prozess von ihnen selbst unabhängig macht, dass die Unabhängigkeit der Personen von einander sich in einem System allseitiger sachlicher Abhängigkeit ergänzt.
Die Theilung der Arbeit verwandelt das Arbeitsprodukt in Waare und macht dadurch seine Verwandlung in Geld nothwendig. Sie macht es zugleich zufällig, ob diese Transsubstantiation gelingt. Hier ist jedoch das Phänomen rein zu betrachten, sein normaler Vorgang also vorauszusetzen. Wenn es übrigens überhaupt vorgeht, die Waare also nicht unverkäuflich ist, findet stets ihr Formwechsel statt, obgleich abnormal in diesem Formwechsel Substanz — Werthgrösse — eingebüsst oder zugesetzt werden mag.
Dem einen Waarenbesitzer ersetzt Gold seine Waare und dem an-
dern Waare sein Gold. Das sinnfällige Phänomen ist der Händeoder Stellenwechsel von Waare und Gold, von 20 Ellen Leinwand und 2 Pfd. St., d. h. ihr Austausch. Aber womit tauscht sich die Waare aus? Mit ihrer eignen allgemeinen Werthgestalt. Und womit das Gold? Mit einer besondern Gestalt seines Gebrauchswerths. Warum tritt Gold der Leinwand als Geld gegenüber? Weil ihr Preis von 2 Pfd. St. oder ihr Geldname sie bereits auf Gold als Geld bezieht. Die Entäusserung der ursprünglichen Waarenform vollzieht sich durch die Veräusserung der Waare, d. h. in dem Augenblicke, wo ihr Gebrauchswerth das in ihrem Preis nur vorgestellte Gold wirklich anzieht. Die Realisirung des Preises oder der nur ideellen Werthform der Waare ist daher zugleich umgekehrt Realisirung des nur ideellen Gebrauchswerths des Geldes, die Verwandlung von Waare in Geld zugleich Verwandlung von Geld in Waare. Der eine Prozess ist zweiseitiger Prozess, vom Pol des Waarenbesitzers Verkauf, vom Gegenpol des Geldbesitzers Kauf. Oder Verkauf ist Kauf, W — G zugleich G — W(FN 51).
Wir kennen bisher kein andres ökonomisches Verhältniss der Menschen zu einander ausser dem von Waarenbesitzern, ein Verhältniss, worin sie fremdes Arbeitsprodukt nur aneignen, indem sie eignes entfremden. Einem Waarenbesitzer kann der andre daher nur als Geldbesitzer gegenübertreten, entweder weil sein Arbeitsprodukt von Natur die Geldform besitzt, also Geldmaterial ist, Gold u. s. w., oder weil seine eigne Waare sich bereits gehäutet und ihre ursprüngliche Gebrauchsform abgestreift hat. Um als Geld zu funktioniren, muss das Gold natürlich an irgend einem Punkt in den Waarenmarkt eintreten. Dieser Punkt liegt an seiner Produktionsquelle, wo es sich als unmittelbares Arbeitsprodukt mit anderm Arbeitsprodukt von demselben Werth austauscht. Aber von diesem Augenblick funktionirt es nur als wirkliches Geld, weil es beständig realisirter Waarenpreis ist(FN 52).
Abgesehn vom Austausch des Golds mit Waare an seiner Produktionsquelle, ist das Gold in der Hand jedes Waarenbesitzers die entäusserte Gestalt seiner veräusserten Waare, Produkt des Verkaufs oder der ersten Waarenmetamorphose W — G(FN 53). Ideelles Geld oder Werthmass wurde das Gold, weil alle Waaren ihre Werthe in ihm massen und es so vorstellungsweise zu ihrer entäusserten Gebrauchsgestalt oder Werthgestalt machten. Reelles Geld wird es, weil die Waaren durch ihre allseitige Veräusserung es zu ihrer wirklich entäusserten oder verwandelten Gebrauchsgestalt und daher zu ihrer wirklichen Werthgestalt machen. In ihrer Werthgestalt streift die Waare jede Spur ihres naturwüchsigen Gebrauchswerths und der besondern nützlichen Arbeit ab, welcher sie den Ursprung verdankt, um sich in die gleichförmige gesellschaftliche Materiatur unterschiedsloser menschlicher Arbeit zu verpuppen. Man sieht dem Geld daher nicht an, welchen Schlags die in es verwandelte Waare. Eine sieht in ihrer Geldform grade aus wie die andre. Geld mag daher Dreck sein, obgleich Dreck nicht Geld ist. Wir wollen annehmen, dass die zwei Goldfüchse, wogegen unser Leineweber seine Waare veräussert, die verwandelte Gestalt eines Quarters Weizen sind. Der Verkauf der Leinwand, W — G, ist zugleich ihr Kauf, G — W. Aber als Verkauf der Leinwand beginnt dieser Prozess eine Bewegung, die mit seinem Gegentheil endet, mit dem Kauf der Bibel; als Kauf der Leinwand endet er eine Bewegung, die mit seinem Gegentheil begann, mit dem Verkauf des Weizens. W — G (Leinwand — Geld), die erste Phase von W — G — W (Leinwand — Geld — Bibel), ist zugleich G — W (Geld — Leinwand), die letzte Phase einer andern Bewegung W — G — W (Weizen — Geld — Leinwand). Die erste Metamorphose einer Waare, ihre Verwandlung aus der Waarenform in Geld, ist stets zugleich zweite entgegengesetzte Metamorphose einer andern Waare, ihre Rückverwandlung aus der Geldform in Waare(FN 54).
G — W. Zweite oder Schlussmetamorphose der Waare. Kauf. — Weil die entäusserte Gestalt aller andern Waaren oder das Produkt ihrer allgemeinen Veräusserung, ist Geld die absolut veräusserliche Waare. Es liest alle Preise rückwärts und spiegelt sich so in allen Waarenleibern als dem hingebenden Material seiner eignen Waarenwerdung. Zugleich zeigen die Preise, die Liebesaugen, womit ihm die Waaren winken, die Schranke seiner Verwandlungsfähigkeit, nämlich seine eigne Quantität. Da die Waare in ihrer Geldwerdung verschwindet, sieht man dem Geld nicht an, wie es in die Hände seines Besitzers gelangt oder was in es verwandelt ist. Non olet, wessen Ursprungs auch immer. Als entäusserte Gestalt steht es den Waaren, ihm als der absolut veräusserlichen Waarengestalt steht die Waarenwelt gegenüber(FN 55).
G — W, der Kauf ist zugleich Verkauf, W — G, die letzte Metamorphose einer Waare daher zugleich die erste Metamorphose einer andern Waare. Für unsern Leinweber schliesst der Lebenslauf seiner Waare mit der Bibel, worin er die 2 Pfd. St. rückverwandelt hat. Aber der ursprüngliche Bibelbesitzer setzt die vom Leineweber gelösten 2 Pfd. St. in Kornbranntwein um, G — W, die Schlussphase von W — G — W (Leinwand — Geld — Bibel) ist zugleich W — G, die erste Phase von W — G — W (Bibel — Geld — Kornbranntwein). Da der Waarenproduzent nur ein einseitiges Produkt liefert, verkauft er es oft in grösseren Massen, während seine vielseitigen Bedürfnisse ihn zwingen, den realisirten Preis oder die gelöste Geldsumme beständig in zahlreiche Käufe zu zersplittern. Ein Verkauf mündet daher in viele Käufe verschiedner Waaren. Die Schlussmetamorphose einer Waare bildet so eine Summe von ersten Metamorphosen andrer Waaren.
Betrachten wir nun die Gesammtmetamorphose einer Waare, z. B. der Leinwand, so sehn wir zunächst, dass sie aus zwei entgegengesetzten und einander ergänzenden Bewegungen besteht, W — G und G — W. Die zwei entgegengesetzten Wandlungen vollziehn sich in zwei entgegengesetzten gesellschaftlichen Prozessen des Waarenbesitzers und reflektiren sich in zwei entgegengesetzten ökonomischen Charakteren dessel-
ben. Als Agent des Verkaufs wird er Verkäufer, als Agent des Kaufs Käufer. Wie aber in jeder Wandlung der Waare ihre beiden Formen, Waarenform und Geldform, gleichzeitig existiren, nur auf entgegengesetzten Polen, so steht demselben Waarenbesitzer als Verkäufer ein andrer Käufer und als Käufer ein andrer Verkäufer gegenüber. Wie dieselbe Waare die zwei umgekehrten Wandlungen successiv durchläuft, aus Waare Geld und aus Geld Waare wird, so wechselt derselbe Waarenbesitzer die Rollen von Verkäufer und Käufer. Es sind diess also keine festen, sondern im Tauschprozess der Waaren beständig die Person wechselnden Charaktere.
Die Gesammtmetamorphose einer Waare unterstellt, in ihrer einfachsten Form, vier Extreme und drei Personae dramatis. Erst tritt der Waare das Geld als ihre entäusserte Gestalt gegenüber, die jenseits, in fremder Tasche, sachlich harte Realität besitzt. So tritt dem Waarenbesitzer ein Geldbesitzer gegenüber. Sobald die Waare nun in Geld verwandelt, wird letztres zu ihrer verschwindenden Aequivalentform, deren Gebrauchswerth oder Inhalt diesseits in andern Waarenkörpern existirt. Als Endpunkt der ersten Waarenwandlung ist das Geld zugleich Ausgangspunkt der zweiten. So der Verkäufer im ersten Act Käufer im zweiten, wo ihm ein dritter Waarenbesitzer als Verkäufer gegenübertritt(FN 56).
Die beiden umgekehrten Bewegungsphasen der Waarenmetamorphose bilden einen Kreislauf: Waarenform, Abstreifung der Waarenform, Rückkehr zur Waarenform. Allerdings ist die Waare selbst hier gegensätzlich bestimmt, am Ausgangspunkt Nicht-Gebrauchswerth, am Endpunkt Gebrauchswerth für ihren Besitzer, wie das Geld die Waare erst als festen Werthkrystall darstellt, um hinterher als ihre blosse Aequivalentform zu zerrinnen.
Die zwei Metamorphosen, die den Kreislauf einer Waare, bilden zugleich die umgekehrten Theilmetamorphosen zweier andren Waaren. Dieselbe Waare (Leinwand) eröffnet die Reihe ihrer eignen Metamorphosen und schliesst die Gesammtmetamorphose einer andern Waare (des Weizens). Während ihrer ersten Wandlung, dem Verkauf, spielt
sie diese zwei Rollen in eigner Person. Als Goldchrysalide dagegen, worin sie selbst den Weg alles Fleisches wandert, endet sie zugleich die erste Metamorphose einer dritten Waare. Der Kreislauf, den die Metamorphosenreihe jeder Waare bildet, verschlingt sich also unentwirrbar mit den Kreisläufen andrer Waaren. Der Gesammtprozess stellt sich dar als Waarencirculation.
Die Waarencirculation ist nicht nur formell, sondern wesentlich vom unmittelbaren Produktenaustausch unterschieden. Man werfe nur einen Rückblick auf den Vorgang. Der Leineweber hat unbedingt Leinwand mit Bibel vertauscht, eigne Waare mit fremder. Aber diess Phänomen ist nur wahr für ihn. Der Bibelagent, der dem Kühlen Heisses vorzieht, dachte nicht daran, Leinwand für Bibel einzutauschen, wie der Leineweber nicht davon weiss, dass Weizen gegen seine Leinwand eingetauscht worden ist u. s. w. Die Waare des B ersetzt die Waare des A, aber A und B tauschen nicht wechselseitig ihre Waaren aus. Es kann in der That vorkommen, dass A und B wechselweis von einander kaufen, aber solche besondre Beziehung ist keineswegs durch die allgemeinen Verhältnisse der Waarencirculation bedingt. Einerseits sieht man hier, wie der Waarenaustausch die individuellen und lokalen Schranken des unmittelbaren Produktenaustauschs durchbricht und den Stoffwechsel der menschlichen Arbeit entwickelt. Andrerseits entwickelt sich ein ganzer Kreis von den handelnden Personen uncontrolirbarer, gesellschaftlicher Naturzusammenhänge. Der Weber kann nur Leinwand verkaufen, weil der Bauer Weizen, Heisssporn nur die Bibel, weil der Weber Leinwand, der Destillateur nur gebranntes Wasser, weil der andre das Wasser des ewigen Lebens bereits verkauft hat u. s. w.
Der Circulationsprozess erlischt desswegen auch nicht, wie der unmittelbare Produktenaustausch, in dem Stellen oder Händewechsel der Gebrauchswerthe. Das Geld verschwindet nicht, weil es schliesslich aus der Metamorphosenreihe einer Waare herausfällt. Es schlägt immer nieder auf eine durch die Waaren geräumte Circulationsstelle. Z. B. in der Gesammtmetamorphose der Leinwand: Leinwand — Geld — Bibel fällt erst die Leinwand aus der Circulation, Geld tritt an ihre Stelle, fällt dann die Bibel aus der Circulation, Geld tritt an ihre Stelle. Der Ersatz von Waare durch Waare lässt zugleich an dritter Hand die Geldwaare hängen. Die Circulation schwitzt beständig Geld aus.
Nichts kann alberner sein als das Dogma, die Waarencirculation bedinge ein nothwendiges Gleichgewicht der Verkäufe und Käufe, weil jeder Verkauf Kauf und vice versa. Meint diess, dass die Zahl der wirklich vollzognen Verkäufe gleich derselben Zahl von Käufen, so ist es platte Tautologie. Aber es soll beweisen, dass der Verkäufer seinen eignen Käufer zu Markt führt. Verkauf und Kauf sind ein identischer Act als Wechselbeziehung zweier polarisch entgegengesetzter Personen, des Waarenbesitzers und des Geldbesitzers. Sie bilden zweipolarisch entgegengesetzte Akte als Handlungen derselben Person. Die Identität von Verkauf und Kauf schliesst daher ein, dass die Waare nutzlos wird, wenn sie, in die alchymistische Retorte der Circulation geworfen, nicht als Geld herauskommt, nicht vom Waarenbesitzer verkauft, also vom Geldbesitzer gekauft wird. Jene Identität enthält ferner, dass der Prozess, wenn er gelingt, einen Ruhepunkt, einen Lebensabschnitt der Waare bildet, der länger oder kürzer währen kann. Da die erste Metamorphose der Waare zugleich Verkauf und Kauf, ist dieser Theilprozess zugleich selbstständiger Prozess. Der Käufer hat die Waare, der Verkäufer hat das Geld, d. h. eine Waare, die circulationsfähige Form bewahrt, ob sie früher oder später wieder auf dem Markt erscheine. Keiner kann verkaufen, ohne dass ein Andrer kauft. Aber keiner braucht unmittelbar zu kaufen, weil er selbst verkauft hat. Die Circulation sprengt die zeitlichen, örtlichen und individuellen Schranken des Produktenaustauschs eben dadurch, dass sie die hier vorhandne unmittelbare Identität zwischen dem Austausch des eignen und dem Eintausch des fremden Arbeitsprodukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet. Dass die selbstständig einander gegenübertretenden Prozesse eine innere Einheit bilden, heisst eben so sehr, dass ihre innere Einheit sich in äusseren Gegensätzen bewegt. Geht die äusserliche Verselbstständigung der innerlich Unselbstständigen, weil einander ergänzenden, bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch eine — Krise. Der der Waare immanente Gegensatz von Gebrauchswerth und Tauschwerth, von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muss, von besondrer konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, von Personificirung der Sache und Versachlichung der Personen — dieser immanente Widerspruch erhält in den Gegensätzen der
Waarenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen. Diese Formen schliessen daher die Möglichkeit, aber auch nur die Möglichkeit der Krisen ein. Die Entwicklung dieser Möglichkeit zur Wirklichkeit erfordert einen ganzen Umkreis von Verhältnissen, die vom Standpunkt der einfachen Waarencirculation noch gar nicht existiren(FN 57).
Als Vermittler der Waarencirculation erhält das Geld die Funktion des Circulationsmittels.
Der Formwechsel, worin sich der Stoffwechsel der Arbeitsprodukte vollzieht, W — G — W, bedingt, dass derselbe Werth als Waare den Ausgangspunkt des Prozesses bildet und zu demselben Punkt zurückkehrt als Waare. Diese Bewegung der Waaren ist daher Kreislauf. Andrerseits schliesst dieselbe Form den Kreislauf des Geldes aus. Ihr Resultat ist beständige Entfernung des Geldes von seinem Ausgangspunkt, nicht Rückkehr zu demselben. So lange der Verkäufer die verwandelte Gestalt seiner Waare festhält, das Geld, befindet sich die Waare im Stadium der ersten Metamorphose oder hat nur ihre erste Circulationshälfte zurückgelegt. Ist der Prozess, Verkaufen um zu kaufen, vervollständigt, so ist auch das Geld wieder aus der Hand ihres ursprünglichen Besitzers entfernt. Allerdings, wenn der Leinweber, nachdem er die Bibel gekauft, von neuem Leinwand verkauft, kehrt auch das
Geld in seine Hand zurück. Aber es kehrt nicht zurück durch den Circulationsprozess der ersten 20 Ellen Leinwand. Er hat es vielmehr aus den Händen des Leinwebers in die des Bibelverkäufers entfernt. Es kehrt nur zurück durch die Erneuerung oder Wiederholung desselben Circulationsprozesses für neue Waare, und endet hier wie dort mit demselben Resultat. Die dem Geld durch die Waarencirculation unmittelbar ertheilte Bewegungsform ist daher seine beständige Entfernung vom Ausgangspunkt, sein Lauf aus der Hand eines Waarenbesitzers in die eines andern, oder sein Umlauf (currency, cours de la monnaie).
Der Umlauf des Geldes zeigt beständige, eintönige Wiederholung desselben Prozesses. Die Waare steht stets auf Seite des Verkäufers, das Geld stets auf Seite des Käufers, als Kaufmittel. Es funktionirt als Kaufmittel, indem es den Preis der Waare realisirt. Indem es ihn realisirt, überträgt es die Waare aus der Hand des Verkäufers in die des Känfers, während es sich gleichzeitig aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers entfernt, um denselben Prozess mit einer andern Waare zu wiederholen. Dass diese einseitige Form der Geldbewegung aus der doppelseitigen Formbewegung der Waare entspringt, ist verhüllt. Die Natur der Waarencirculation selbst erzeugt den entgegengesetzten Schein. Die erste Metamorphose der Waare ist nicht nur als Bewegung des Geldes, sondern als ihre eigne Bewegung sichtbar, aber ihre zweite Metamorphose ist nur als Bewegung des Geldes sichtbar. In ihrer ersten Circulationshälfte wechselt die Waare den Platz mit dem Geld. Damit fällt zugleich ihre Gebrauchsgestalt aus der Circulation heraus, in die Consumtion(FN 58). Ihre Werthgestalt oder Geldlarve tritt an ihre Stelle. Die zweite Circulationshälfte durchläuft sie nicht mehr in ihrer eignen Naturalhaut, sondern in ihrer Goldhaut. Die Continuität der Bewegung fällt damit ganz auf die Seite des Geldes und dieselbe Bewegung, die für die Waare zwei entgegengesetzte Prozesse einschliesst, schliesst als eigne Bewegung des Geldes stets denselben Prozess ein, seinen Stellenwechsel mit stets andrer Waare. Das Resultat der Waarencirculation, Ersatz von Waare
durch andre Waare, erscheint daher nicht durch ihren eignen Formwechsel vermittelt, sondern durch die Funktion des Geldes als Circulationsmittel, welches die an und für sich bewegungslosen Waaren circulirt, sie aus der Hand, worin sie Nicht-Gebrauchswerthe, in die Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerthe, stets in entgegengesetzter Richtung zu seinem eignen Lauf. Es entfernt die Waaren beständig aus der Circulationssphäre, indem es beständig an ihre Circulationsstelle tritt und sich damit von seinem eignen Ausgangspunkt entfernt. Obgleich daher die Geldbewegung nur Ausdruck der Waarencirculation, erscheint umgekehrt die Waarencirculation nur als Resultat der Geldbewegung(FN 59).
Andrerseits kommt dem Geld nur die Funktion des Circulationsmittels zu, weil es die verselbstständigte Werthgestalt der Waaren ist. Seine Bewegung als Circulationsmittel ist daher in der That nur ihre eigne Formbewegung. Diese muss sich daher auch sinnlich im Umlauf des Geldes wiederspiegeln. Der doppelte Formwechsel der Waare spiegelt sich wieder im zweimaligen Stellenwechsel desselben Geldstücks, wenn wir die Gesammtmetamorphose einer Waare, in der mehrmaligen Wiederholung seines Stellenwechsels, wenn wir die Verschlingung der zahllosen Metamorphosen in einander betrachten. Dieselben Geldstücke kommen als entäusserte Gestalt der Waare in die Hand des Verkäufers und verlassen sie als absolut veräusserliche Gestalt der Waare. Das Geld wirkt in derselben Weise als Kaufmittel, jedesmal gegenüber andrer Waare, in beiden Prozessen. Aber ihr innerer Zusammenhang, oder die doppelte Formbestimmtheit, die es in beiden Prozessen für dieselbe Waare hat, erscheint in der doppelten und gegensätzlichen Bewegung, die denselben Geldstücken aufgedrückt wird. Dieselben 2 Pfd. St., die beim Verkauf der Leinwand aus der Tasche des Weizenbauers in die Tasche des Leinwebers einwandern, wandern von ihr aus beim Kauf der Bibel. Es ist doppelter Stellenwechsel, und die Leinwand oder ihren Repräsentanten als Centrum betrachtet, in entgegengesetzter Richtung, positiver bei Einnahme des Geldes, negativer bei seiner Ausgabe. Finden dagegen nur einseitige Waarenmetamorphosen statt, blosse Verkäufe oder blosse Käufe, wie man will, so wechselt das-
selbe Geld auch nur einmal den Platz. Sein zweiter Stellenwechsel drückt stets die zweite Metamorphose der Waare aus, ihre Rückverwandlung aus Geld. Es versteht sich übrigens ganz von selbst, dass alles diess nur für die hier betrachtete Form der einfachen Waarencirculation gilt.
Jede Waare, bei ihrem ersten Schritt in die Circulation, ihrem ersten Formwechsel, fällt aus der Circulation heraus, während stets neue Waare in sie eintritt. Das Geld dagegen als Circulationsmittel haust beständig in der Circulationssphäre und treibt sich beständig in ihr um. Es entsteht also die Frage, wie viel Geld diese Sphäre beständig absorbirt.
In einem Lande geht jeden Tag gleichzeitig, daher räumlich neben einander, eine ungeheure Anzahl einseitiger Waarenmetamorphosen vor, oder eine zahllose Masse zersplitterter Verkäufe, welche die von einander unabhängigen Waarenbesitzer vollziehen. In ihren Preisen sind die Waaren bereits bestimmten vorgestellten Geldquantis gleichgesetzt. Da nun die hier betrachtete, unmittelbare Circulationsform Waare und Geld einander stets leiblich gegenüberstellt, die eine auf den Pol des Verkaufs, das andre auf den Gegenpol des Kaufs, ist die für den Circulationsprozess der Waarenwelt erheischte Masse von Circulationsmitteln bereits durch die Preissumme der Waaren bestimmt. In der That stellt das Geld nur reell die in der Preissumme der Waaren bereits ideell ausgedrückte Goldsumme dar. Die Gleichheit dieser Summen versteht sich daher von selbst. Wir wissen jedoch, dass bei gleichbleibenden Werthen der Waaren ihre Preise mit dem Werthe des Goldes (des Geldmaterials) selbst wechseln, verhältnissmässig steigen, wenn er fällt, und fallen, wenn er steigt. Ob die Preissumme der Waaren so steige oder falle, die Masse des circulirenden Geldes muss gleichmässig steigen oder fallen. Der Wechsel in der Masse der Circulationsmittel entspringt hier allerdings aus dem Geld selbst, aber nicht aus seiner Funktion als Circulationsmittel, sondern aus seiner Funktion als Werthmass. Der Preis der Waaren wechselt erst umgekehrt wie der Werth des Geldes und dann wechselt die Masse der Circulationsmittel direkt wie der Preis der Waaren. Ganz dasselbe Phänomen würde sich ereignen, wenn z. B. nicht der Werth des Goldes sänke, sondern Silber es als Werthmass ersetzte, oder nicht der Werth des Silbers stiege, sondern Gold es aus der Funktion des Werthmasses verdrängte. In dem einen Fall müsste mehr Silber circuliren als vorher Gold, in dem andern weniger Gold als vorher
Silber. In beiden Fällen hätte sich der Werth des Geldmaterials verändert, d. h. der Waare, die als Mass der Werthe funktionirt, daher der Preisausdruck der Waarenwerthe, daher die Masse des circulirenden Geldes, das zur Realisirung dieser Preise dient. Man hat gesehn, dass die Circulationssphäre der Waaren ein Loch hat, wodurch Gold (Silber, kurz das Geldmaterial) in sie eintritt als Waare von gegebnem Werth. Dieser Werth ist vorausgesetzt bei der Funktion des Geldes als Werthmass, also bei der Preisbestimmung. Sinkt nun z. B. der Werth des Werthmasses selbst, so erscheint diess zunächst im Preiswechsel der Waaren, die unmittelbar an den Produktionsquellen der edlen Metalle mit ihnen als Waaren ausgetauscht werden. Namentlich in minder entwickelten Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft wird ein grosser Theil der andern Waaren noch längere Zeit in dem nun illusorisch gewordnen, veralteten Werth des Werthmasses geschätzt werden. Indess inficirt eine Waare die andre durch ihr relatives Werthverhältniss zu derselben, die Goldoder Silberpreise der Waaren gleichen sich allmählig aus in den durch ihre Werthe selbst bestimmten Proportionen, bis schliesslich alle Waarenwerthe dem neuen Werth des Geldmetalls entsprechend geschätzt werden. Dieser Ausgleichungsprozess ist begleitet von dem fortwährenden Wachsthum der edlen Metalle, welche im Ersatz für die direkt mit ihnen ausgetauschten Waaren einströmen. In demselben Mass daher, worin die berichtigte Preisgebung der Waaren sich verallgemeinert, oder ihre Werthe dem neuen, gesunkenen und bis zu einem gewissen Punkt fortsinkenden Werth des Metalls gemäss geschätzt werden, ist auch bereits seine zu ihrer Realisirung nothwendige Mehrmasse vorhanden. Einseitige Beobachtung der Thatsachen, welche der Entdeckung der neuen Goldund Silberquellen folgten, verleitete im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert zum Trugschluss, die Waarenpreise seien gestiegen, weil mehr Gold und Silber als Circulationsmittel funktionirten. Im Folgenden wird der Werth des Goldes als gegeben vorausgesetzt, wie er in der That im Augenblick der Preisschätzung gegeben ist.
Unter dieser Voraussetzung also ist die Masse der Circulationsmittel durch die zu realisirende Preissumme der Waaren bestimmt. Setzen wir nun ferner den Preis jeder Waarenart als gegeben voraus, so hängt die Preissumme der Waaren offenbar von der in Circulation befindlichen Waarenmasse ab. Es gehört wenig Kopfbrechens dazu, um
zu begreifen, dass wenn 1 Quarter Weizen 2 Pfd. St., 100 Quarter 200 Pfd. St., 200 Quarter 400 Pfd. St. u. s. w. kosten, mit der Masse des Weizens daher die Geldmasse wachsen muss, die beim Verkauf den Platz mit ihm wechselt.
Die Waarenmasse als gegeben vorausgesetzt, fluthet die Masse des circulirenden Geldes auf und ab mit den Preisschwankungen der Waaren. Sie steigt und fällt, weil die Preissumme der Waaren in Folge ihres Preiswechsels zuoder abnimmt. Dazu ist keineswegs nöthig, dass die Preise aller Waaren gleichzeitig steigen oder fallen. Die Preissteigerung einer gewissen Anzahl leitender Artikel in dem einen, oder ihre Preissenkung in dem andern Fall, reicht hin, um die zu realisirende Preissumme aller circulirenden Waaren zu erhöhn oder zu senken, also auch mehr oder weniger Geld in Circulation zu setzen. Ob der Preiswechsel der Waaren wirkliche Werthwechsel wiederspiegelt oder blosse Schwankungen der Marktpreise, die Wirkung auf die Masse der Circulationsmittel bleibt dieselbe.
Es sei gegeben eine Anzahl zusammenhangsloser, gleichzeitiger und daher räumlich neben einander fallender Verkäufe oder Theilmetamorphosen, z. B. von 2 Quarter Weizen, 20 Ellen Leinwand, 1 Bibel, 4 Gallons Kornbranntwein. Wenn der Preis jedes Artikels 2 Pfd. St., die zu realisirende Preissumme daher 8 Pfd. St., so muss eine Geldmasse von 8 Pfd. St. in die Circulation eingehn. Bilden dieselben Waaren dagegen Glieder der uns bekannten Metamorphosenreihe: 1 Quarter Weizen — 2 Pfd. St. — 20 Ellen Leinwand — 2 Pfd. St. — 1 Bibel — 2 Pfd. St. — 4 Gallons Kornbranntwein — 2 Pfd. St., so circuliren dieselben 2 Pfd. St. die verschiedenen Waaren der Reihe nach, indem sie deren Preise der Reihe nach, also auch die Preissumme von 8 Pfd. St. realisiren, um schliesslich in der Hand des Destillateurs auszuruhn. Sie vollbringen vier Umläufe. Dieser wiederholte Stellenwechsel derselben Geldstücke stellt den doppelten Formwechsel der Waare dar, ihre Bewegung durch zwei entgegengesetzte Circulationsstadien und die Verschlingung der Metamorphosen verschiedner Waaren(FN 60). Die gegensätzlichen und einander
ergänzenden Phasen, wodurch dieser Prozess verläuft, können nicht räumlich neben einander fallen, sondern nur zeitlich auf einander folgen. Zeitabschnitte bilden daher das Mass seiner Dauer, oder die Anzahl der Umläufe derselben Geldstücke in gegebner Zeit misst die Geschwindigkeit des Geldumlaufs. Der Circulationsprozess jener vier Waaren dauere z. B. einen Tag. So ist die zu realisirende Preissumme: 8 Pfd. St., die Anzahl der Umläufe desselben Geldstücks während des Tags: 4 und die Masse des circulirenden Geldes: 2 Pfd. St., oder für einen gegebnen Zeitabschnitt des Circulationsprozesses: = Masse des als Circulationsmittel funktionirenden Geldes. Dies Gesetz gilt allgemein. Der Circulationsprozess eines Landes in einem gegebnen Zeitabschnitt umfasst zwar einerseits viele zersplitterte, gleichzeitige und räumlich neben einander fallende Verkäufe (resp. Käufe) oder Theilmetamorphosen, worin dieselben Geldstücke nur einmal die Stelle wechseln oder nur einen Umlauf vollziehn, andrerseits viele theils neben einander herlaufende, theils sich in einander verschlingende mehr oder minder gliederreiche Metamorphosenreihen, worin dieselben Geldstücke mehr oder minder zahlreiche Umläufe zurücklegen. Die Gesammtzahl der Umläufe aller in Circulation befindlichen gleichnamigen Geldstücke ergiebt jedoch die Durchschnittsanzahl der Umläufe des einzelnen Geldstücks oder die Durchschnittsgeschwindigkeit des Geldumlaufs. Die Geldmasse, die bei Beginn z. B. des täglichen Circulationsprozesses in ihn hineingeworfen wird, ist natürlich bestimmt durch die Preissumme der gleichzeitig und räumlich neben einander circulirenden Waaren. Aber innerhalb des Prozesses wird ein Geldstück so zu sagen für das andre verantwortlich gemacht. Beschleunigt das eine seine Umlaufsgeschwindigkeit, so erlahmt die des andern, oder es fliegt ganz aus der Circulationssphäre heraus, da diese nur eine Goldmasse absorbiren kann, welche multiplicirt mit der mittlern Umlaufsanzahl ihres einzelnen Elements gleich der zu realisirenden Preissumme ist. Wächst daher die Anzahl der Umläufe der Geldstücke, so nimmt ihre circulirende Masse ab. Nimmt die Anzahl ihrer Umläufe ab, so wächst ihre Masse. Weil die Masse des Geldes, die als Circulationsmittel funktioniren kann, bei gegebner Durchschnittsgeschwindigkeit gegeben ist, hat man daher z. B. nur eine bestimmte
Quantität von Ein-Pfund-Noten in die Cirkulation hinein zu werfen, um eben so viele Sovereigns hinaus zu werfen, ein allen Banken wohlbekanntes Kunststück.
Wie im Geldumlauf überhaupt nur der Circulationsprozess der Waaren erscheint, so in der Geschwindigkeit des Geldumlaufs die Geschwindigkeit ihres Formwechsels, das continuirliche Ineinandergreifen der Metamorphosenreihen, die Hast des Stoffwechsels, das rasche Verschwinden der Waaren aus der Circulationssphäre und ihr ebenso rascher Ersatz durch neue Waaren. In der Geschwindigkeit des Geldumlaufs erscheint also die flüssige Einheit der entgegengesetzten und sich ergänzenden Phasen, Verwandlung der Gebrauchsgestalt in Werthgestalt und Rückverwandlung der Werthgestalt in Gebrauchsgestalt, oder der beiden Prozesse des Verkaufs und Kaufs. Umgekehrt erscheint in der Verlangsamung des Geldumlaufs die Trennung und gegensätzliche Verselbstständigung dieser Prozesse, die Stockung des Formwechsels und daher des Stoffwechsels. Woher diese Stockung entspringt, ist natürlich der Circulation selbst nicht anzusehn. Sie zeigt nur das Phänomen selbst. Der populären Anschauung, welche mit verlangsamtem Geldumlauf das Geld minder häufig auf allen Punkten der Circulationsperipherie erscheinen und verschwinden sieht, liegt es nah das Phänomen aus mangelnder Quantität der Circulationsmittel zu deuten(FN 61).
Das Gesammtquantum des in jedem Zeitabschnitt als Circulationsmittel functionirenden Geldes ist also bestimmt einerseits durch die Preissumme der circulirenden Waarenwelt, andrerseits durch den langsamern oder raschern Fluss ihrer gegensätzlichen Circulationsprozesse, von dem es abhängt, der wievielte Theil jener Preissumme durch dieselben Geldstücke realisirt werden kann. Die Preissumme der Waaren hängt aber ab sowohl von der Masse als den Preisen jeder Waarenart. Die drei Faktoren der Preisbewegung, der circulirenden Waarenmasse und endlich der Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes können aber in verschiedner Richtung und verschiednen Verhältnissen wechseln, die zu realisirende Preissumme, daher die durch sie bedingte Masse der Circulationsmittel, also sehr zahlreiche Combinationen untergehn. Wir zählen hier nur die in der Geschichte der Waarenpreise wichtigsten auf.
Bei gleichbleibenden Waarenpreisen kann die Masse der Circulationsmittel wachsen, weil die Masse der circulirenden Waaren zunimmt oder die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes abnimmt, oder beides zusammenwirkt. Die Masse der Circulationsmittel kann umgekehrt abnehmen mit abnehmender Waarenmasse oder zunehmender Circulationsgeschwindigkeit.
Bei allgemein steigenden Waarenpreisen kann die Masse der Circulationsmittel gleichbleiben, wenn die Masse der circulirenden Waaren in demselben Verhältniss abnimmt, worin ihr Preis zunimmt, oder die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes eben so rasch zunimmt als die Preiserhöhung, während die cirkulirende Waarenmasse constant bleibt.
Die Masse der Circulationsmittel kann fallen, weil die Waarenmasse rascher aboder die Umlaufsgeschwindigkeit rascher zunimmt als die Preise.
Bei allgemein fallenden Waarenpreisen kann die Masse der Circulationsmittel gleichbleiben, wenn die Waarenmasse in demselben Verhältniss wächst, worin ihr Preis fällt, oder die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes in demselben Verhältniss abnimmt wie die Preise. Sie kann wachsen, wenn die Waarenmasse rascher wächst oder die Circulationsgeschwindigkeit rascher abnimmt als die Waarenpreise fallen.
Die Variationen der verschiedenen Faktoren können sich wechselseitig compensiren, so dass ihrer beständigen Unstätigkeit zum Trotz die zu realisirende Gesammtsumme der Waarenpreise constant bleibt, also auch die circulirende Geldmasse. Man findet daher, namentlich bei Betrachtung etwas längerer Perioden, ein viel constanteres Durchschnittsniveau der in jedem Lande circulirenden Geldmasse und, mit Ausnahme starker Perturbationen, die periodisch aus den Produktionsund Handelskrisen, seltner aus einem Wechsel im Geldwerth selbst entspringen, viel geringere Abweichungen von diesem Durchschnittsniveau als man nach dem Augenschein erwarten sollte.
Das Gesetz, dass die Quantität der Circulationsmittel bestimmt ist durch die Preissumme der circulirenden Waaren und die Durchschnittsgeschwindigkeit des Geldumlaufs(FN 62), kann auch so ausgedrückt werden,
dass bei gegebner Werthsumme der Waaren und gegebner Durchschnittsgeschwindigkeit ihrer Metamorphosen, die Quantität des umlaufenden Geldes oder des Geldmaterials von seinem eignen Werth abhängt. Die Illusion, dass umgekehrt die Waarenpreise durch die Masse der Circulationsmittel und letztre ihrerseits durch die Masse des in einem Lande befindlichen Geldmaterials bestimmt werden(FN 63), wurzelt bei ihren ursprünglichen Vertretern in der abgeschmackten Hypothese, dass Waaren ohne Preis und Geld ohne Werth in den Circulationsprozess eingehn,
wo sich dann ein aliquoter Theil des Waarenbreis mit einem aliquoten Theil des Metallbergs austausche(FN 64).
Aus der Funktion des Geldes als Circulationsmittel entspringt seine
Münzgestalt. Der in dem Preise oder Geldnamen der Waaren vorgestellte Gewichtstheil Gold muss ihnen in der Circulation als gleichnamiges Goldstück oder Münze gegenübertreten. Wie die Feststellung des Massstabs der Preise, fällt das Geschäft der Münzung dem Staat anheim. In den verschiedenen Nationaluniformen, die Gold und Silber als Münzen tragen, auf dem Weltmarkt aber wieder ausziehn, erscheint die Scheidung zwischen den innern oder nationalen Sphären der Waarencirculation und ihrer allgemeinen Weltmarktssphäre.
Goldmünze und Barrengold unterscheiden sich also von Haus aus nur durch die Figur, und das Gold ist beständig aus einer Form in die andre verwandelbar(FN 65). Der Weg aus der Münze ist aber zugleich der Gang zum Schmelztiegel. Im Umlauf verschleissen nämlich die Goldmünzen, die eine mehr, die andre weniger. Goldtitel und Goldsubstanz, Nominalgehalt und Realgehalt beginnen ihren Scheidungsprozess. Gleichnamige Goldmünzen werden von ungleichem Werth, weil verschiednem Gewicht. Das Gold als Circulationsmittel weicht ab vom Gold als Massstab der Preise, und hört damit auch auf wirkliches Aequivalent der Waaren zu sein, deren Preise es realisirt. Die Geschichte dieser Wirren bildet die Münzgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit bis ins 18. Jahrhundert. Die naturwüchsige Tendenz des Cirkulationsprozesses, das Goldsein der Münze in Goldschein oder die Münze in ein Symbol ihres officiellen Metallgehalts zu verwandeln, ist selbst anerkannt durch die modernsten Gesetze
über den Grad des Metallverlustes, der ein Goldstück kursunfähig macht oder demonetisirt.
Wenn der Geldumlauf selbst den Realgehalt vom Nominalgehalt der Münze scheidet, ihr Metalldasein von ihrem funktionellen Dasein, so enthält er die Möglichkeit latent, das Metallgeld in seiner Münzfunktion durch Marken aus andrem Material oder Symbole zu ersetzen. Die technischen Hindernisse der Münzung ganz diminutiver Gewichtstheile des Goldes, resp. Silbers, und der Umstand, dass niedrigere Metalle ursprünglich statt der edleren, Silber statt des Goldes, Kupfer statt des Silbers, zum Werthmass dienen und daher als Geld circuliren im Augenblick, wo das edlere Metall sie entthront, erklären historisch die Rolle von Silberund Kupfermarken als Substitute der Goldmünze. Sie ersetzen das Gold in den Kreisen der Waarencirculation, worin die Münze am schnellsten circulirt und sich daher am schnellsten abnutzt, d. h. wo Käufe und Verkäufe unaufhörlich im kleinsten Massstab erneuert werden. Um die Festsetzung dieser Trabanten an der Stelle des Goldes selbst zu verhindern, werden gesetzlich die sehr niedrigen Proportionen bestimmt, worin sie allein an Zahlungsstatt für Gold angenommen werden müssen. Die besondern Kreise, worin die verschiednen Münzsorten umlaufen, laufen natürlich in einander. Die Scheidemünze erscheint neben dem Gold zur Zahlung von Bruchtheilen der kleinsten Goldmünze; das Gold tritt beständig in die Detailcirculation ein, wird aber durch Auswechslung mit Scheidemünze ebenso beständig herausgeworfen(FN 66).
Der Metallgehalt der Silberoder Kupfermarken ist willkührlich durch das Gesetz bestimmt. Im Umlauf verschleissen sie noch rascher als die
Goldmünze. Ihre Münzfunktion wird daher faktisch durchaus unabhängig von ihrem Gewicht, d. h. von allem Werth. Das Münzdasein des Goldes scheidet sich völlig von seiner Werthsubstanz. Relativ werthlose Dinge, Papierzettel, können also an seiner Statt als Münze funktioniren. In den metallischen Gel dmarken ist der rein symbolische Charakter noch einigermassen versteckt. Im Papiergeld tritt er augenscheinlich hervor. Man sieht: ce n’est que le premier pas qui coûte.
Es handelt sich hier nur von Staatspapiergeld mit Zwangskurs. Es wächst unmittelbar aus der metallischen Circulation heraus. Creditgeld unterstellt dagegen Verhältnisse, die uns vom Standpunkt der einfachen Waarencirculation noch durchaus unbekannt sind. Im Vorbeigehn sei jedoch bemerkt, dass, wie eigentliches Papiergeld aus der Funktion des Geldes als Circulationsmittel entspringt, das Creditgeld in der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel seine naturwüchsige Wurzel besitzt(FN 67).
Papierzettel, denen Geldnamen, wie 1 Pfd. St., 5 Pfd. St. u. s. w. aufgedruckt sind, werden vom Staat äusserlich in den Circulationsprozess hineingeworfen. Soweit sie wirklich an der Stelle der gleichnamigen Goldsumme circuliren, spiegeln sich in ihrer Bewegung nur die Gesetze des
Geldumlaufs selbst wieder. Ein spezifisches Gesetz der Papiercirculation kann nur aus ihrem Repräsentationsverhältniss zum Gold entspringen. Und diess Gesetz ist einfach diess, dass die Ausgabe des Papiergelds auf die Quantität zu beschränken ist, worin das von ihm symbolisch dargestellte Gold (resp. Silber) wirklich circuliren müsste. Nun schwankt zwar das Goldquantum, welches die Circulationssphäre absorbiren kann, beständig über oder unter ein gewisses Durchschnittsniveau. Jedoch sinkt die Mass des circulirenden Mediums in einem gegebnen Land nie unter ein gewisses Minimum, das sich erfahrungsmässig feststellt. Dass diese Minimalmasse fortwährend ihre Bestandtheile wechselt, d. h. aus stets andern Goldstücken besteht, ändert natürlich nichts an ihrem Umfang und ihrem constanten Umtrieb in der Circulationssphäre. Sie kann daher durch Papiersymbole ersetzt werden. Werden dagegen heute alle Circulationskanäle zum vollen Grad ihrer Geldabsorptionsfähigkeit mit Papiergeld gefüllt, so können sie in Folge der Schwankungen der Waarencirculation morgen übervoll sein. Alles Mass geht verloren. Ueberschreitet aber das Papier sein Mass, d. h. die Quantität von Goldmünze gleicher Denomination, welche circuliren könnte, so stellt es, von der Gefahr allgemeiner Discreditirung abgesehn, innerhalb der Waarenwelt dennoch nur die durch ihre immanenten Gesetze bestimmte, also auch allein repräsentirbare Goldquantität vor. Stellt die Papierzettelmasse z. B. je 2 Unzen Gold, statt je 1 Unze dar, so werden ihre Geldnamen faktisch, sage etwa von 1 Pfd. St. per ¼ Unze, zu Namen von ⅛ Unzen herabgesetzt. Die Wirkung ist dieselbe, als wäre das Gold in seiner Funktion als Mass der Preise verändert worden. Dieselben Werthe, die sich daher vorher im Preise von 1 Pfd. St., drücken sich jetzt im Preise von 2 Pfd. St. aus.
Das Papiergeld ist Goldzeichen oder Geldzeichen. Sein Verhältniss zu den Waaren werthen besteht nur darin, dass sie ideell in denselben Goldquanta ausgedrückt sind, welche vom Papier symbolisch sinnlich dargestellt werden. Nur sofern das Papiergeld Goldquanta repräsentirt, die, wie alle andern Waarenquanta, auch Werthquanta, ist es Werthzeichen.
Es fragt sich schliesslich, warum das Gold durch blosse werthlose Zeichen seiner selbst ersetzt werden kann? Es ist aber, wie man gesehn, nur so ersetzbar, soweit es in seiner Funktion als Münze oder Circulationsmittel isolirt oder verselbstständigt wird. Nun findet die Verselbststän-
digung dieser Funktion zwar nicht für die einzelnen Goldmünzen statt, obgleich sie in dem Fortcirculiren verschlissener Goldstücke erscheint. Blosse Münze oder Circulationsmittel sind die Goldstücke grade nur so lang sie sich wirklich im Umlauf befinden. Was aber nicht für die einzelne Goldmünze, gilt für die vom Papiergeld ersetzbare Minimalmasse Gold. Sie haust beständig in der Circulationssphäre, funktionirt fortwährend als Circulationsmittel und existirt daher ausschliesslich als Träger dieser Funktion. Ihre Bewegung stellt also nur das fortwährende Ineinanderumschlagen der entgegengesetzten Prozesse der Waarenmetamorphose W — G — W dar, worin der Waare ihre Werthgestalt nur gegenübertritt, um sofort wieder zu verschwinden. Die selbstständige Darstellung des Tauschwerths der Waare ist hier nur flüchtiges Moment. Sofort wird sie wieder durch andere Waare ersetzt. Daher genügt auch die bloss symbolische Existenz des Geldes in einem Prozess, der es beständig aus einer Hand in die andre entfernt. Sein funktionelles Dasein absorbirt so zu sagen sein materielles. Verschwindend objektivirter Reflex der Waarenpreise funktionirt es nur noch als Zeichen seiner selbst und kann daher auch durch Zeichen ersetzt werden(FN 68). Nur bedarf das Zeichen des Geldes seiner eignen objektiv gesellschaftlichen Gültigkeit und diese erhält das Papiersymbol durch den Zwangskurs. Nur innerhalb der von den Grenzen eines Gemeinwesens umschriebnen oder innern Circulationssphäre gilt dieser Staatszwang, aber auch nur hier geht das Geld völlig auf in seine Funktion als Circulationsmittel oder Münze, und kann daher im Papiergeld eine von seiner Metallsubstanz äusserlich getrennte und bloss funktionelle Existenzweise erhalten.
Die Waare, welche als Werthmass und daher auch, persönlich oder durch Stellvertreter, als Circulationsmittel funktionirt, ist Geld. Gold (resp. Silber) ist daher Geld. Als Geld funktionirt es, einerseits wo es in seiner goldnen (resp. silbernen) Leiblichkeit erscheinen muss, daher als Geldwaare, also weder bloss ideell, wie im Werthmass, noch repräsentationsfähig, wie im Circulationsmittel; andrerseits, wo seine Funktion, ob es selbe nun in eigner Person oder durch Stellvertreter vollziehe, es als alleinige Werthgestalt oder allein adäquates Dasein des Tauschwerths allen andern Waaren als blossen Gebrauchswerthen gegenüber fixirt.
Der continuirliche Kreislauf der zwei entgegengesetzten Waarenmetamorphosen oder der flüssige Umschlag von Verkauf und Kauf erscheint im rastlosen Umlauf des Geldes oder seiner Funktion als perpetuum mobile der Circulation. Es wird immobilisirt, oder verwandelt sich, wie Boisguillebert sagt, aus meuble in immeuble, aus Münze in Geld, sobald die Metamorphosenreihe unterbrochen, der Verkauf nicht durch nachfolgenden Kauf ergänzt wird.
Mit der ersten Entwicklung der Waarencirculation selbst entwickelt sich die Nothwendigkeit und die Leidenschaft, das Produkt der ersten Metamorphose, die verwandelte Gestalt der Waare oder ihre Goldpuppe festzuhalten(FN 69). Waare wird verkauft, nicht um Waare zu kaufen, sondern um Waarenform durch Geldform zu ersetzen. Aus blosser Vermittlung des Stoffwechsels wird dieser Formwechsel zum Selbstzweck. Die entäusserte Gestalt der Waare wird verhindert als ihre absolut veräusserliche Gestalt oder nur verschwindende Geldform zu funktioniren. Das Geld versteinert damit zum Schatz, und der Waarenverkäufer wird Schatzbildner.
Grade in den Anfängen der Waarencirculation verwandelt sich nur der Ueberschuss an Gebrauchswerthen in Geld. Gold und Silber werden so von selbst zu gesellschaftlichen Ausdrücken des Ueberflusses oder des
Reichthums. Diese naive Form der Schatzbildung verewigt sich bei Völkern, wo der traditionellen und auf Selbstbedarf gerichteten Produktionsweise ein fest abgeschlossner Kreis von Bedürfnissen entspricht. So bei den Asiaten, namentlich den Indern. Vanderlint, der die Waarenpreise durch die Masse des in einem Land befindlichen Goldes und Silbers bestimmt wähnt, fragt sich, warum die indischen Waaren so wohlfeil? Antwort: Weil die Inder das Geld vergraben. Von 1602—1734, bemerkt er, vergruben sie 150 Millionen Pfd. St. Silber, die ursprünglich von Amerika nach Europa kamen(FN 70). Von 1856—1866, also in 10 Jahren, exportirte England nach Indien und China (das nach China exportirte Metall fliesst grossentheils wieder nach Indien) 120 Millionen Pfd. St. in Silber, welches vorher gegen australisches Gold eingewechselt wurde.
Mit mehr entwickelter Waarenproduktion muss jeder Waarenproducent sich den nexus rerum, das „gesellschaftliche Faustpfand“ sichern(FN 71). Seine Bedürfnisse erneuern sich unaufhörlich und gebieten unaufhörlichen Kauf fremder Waare, während Produktion und Verkauf seiner eignen Waare Zeit kosten und von Zufällen abhängen. Um zu kaufen, ohne zu verkaufen, muss er vorher verkauft haben, ohne zu kaufen. Diese Operation, auf allgemeiner Stufenleiter ausgeführt, scheint sich selbst zu widersprechen. An ihren Produktionsquellen jedoch tauschen sich die edlen Metalle direkt mit andern Waaren aus. Es findet hier Verkauf (auf Seite der Waarenbesitzer) ohne Kauf (auf Seite der Goldund Silberbesitzer) statt(FN 72). Und spätere Verkäufe ohne nachfolgende Käufe vermitteln bloss die weitere Vertheilung der edlen Metalle unter alle Waarenbesitzer. So entstehn auf allen Punkten des Verkehrs Goldund Silberschätze vom verschiedensten Umfang. Mit der Möglichkeit, die Waare als Tauschwerth oder den Tauschwerth als Waare festzuhalten, erwacht die Goldgier. Mit der Ausdehnung der Waarencirculation wächst die Macht des Geldes, der stets schlagfertigen, absolut gesellschaftlichen Form des Reichthums. „Gold ist ein wunderbares Ding! Wer dasselbe besitzt, ist Herr von
allem, was er wünscht. Durch Gold kann man sogar Seelen in das Paradies gelangen lassen.“ ( Columbus, im Brief aus Jamaica, 1503). Da dem Geld nicht anzusehn, was in es verwandelt ist, verwandelt sich alles, Waare oder nicht, in Geld. Alles wird verkäuflich und kaufbar. Die Circulation wird die grosse gesellschaftliche Retorte, worin alles hineinfliegt, um als Geldkrystall wieder herauszukommen. Dieser Alchymie widerstehen nicht einmal Heiligenknochen und noch viel weniger minder grobe res sacrosanctae, extra commercium hominum(FN 73). Wie im Geld aller qualitative Unterschied der Waaren ausgelöscht ist, löscht es seinerseits als radikaler Leveller alle Unterschiede aus(FN 74). Das Geld ist aber selbst Waare, ein äusserlich Ding, das Privateigenthum eines Jeden werden kann. Die gesellschaftliche Macht wird so zur Privatmacht der Privatperson. Die antike Gesellschaft denuncirt es daher als die Scheidemünze ihrer ökonomischen und sittlichen Ordnung(FN 75). Die moderne Gesellschaft, die
schon in ihren Kinderjahren den Plutus an den Haaren aus den Eingeweiden der Erde herauszieht(FN 76), begrüsst im Goldgral die glänzende Incarnation ihres eigensten Lebensprinzips.
Die Waare als Gebrauchswerth befriedigt ein besondres Bedürfniss und bildet ein besondres Element des stofflichen Reichthums. Aber der Werth der Waare misst den Grad ihrer Attraktionskraft auf alle Elemente des stofflichen Reichthums, daher den gesellschaftlichen Reichthum ihres Besitzers. Dem barbarisch einfachen Waarenbesitzer, selbst einem westeuropäischen Bauer, ist der Werth unzertrennlich von der Werthform, Vermehrung des Goldund Silberschatzes daher Werthvermehrung. Allerdings wechselt der Werth des Geldes, sei es in Folge seines eignen Werthwechsels, sei es des Werthwechsels der Waaren. Diess verhindert aber einerseits nicht, dass 200 Unzen Gold nach wie vor mehr Werth enthalten als 100, 300 mehr als 200 u. s. w., noch andrerseits dass die metallne Naturalform dieses Dings die allgemeine Aequivalentform aller Waaren bleibt, die unmittelbar gesellschaftliche Incarnation aller menschlichen Arbeit. Der Trieb der Schatzbildung ist von Natur masslos. Qualitativ oder seiner Form nach ist das Geld schrankenlos, d. h. allgemeiner Repräsentant des stofflichen Reichthums, weil in jede Waare unmittelbar umsetzbar. Aber zugleich ist jede wirkliche Geldsumme quantitativ beschränkt, daher auch nur Kaufmittel von beschränkter Wirkung. Dieser Widerspruch zwischen der quantitativen Schranke und der qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes treibt den Schatzbildner stets zurück zur Sisyphusarbeit der Accumulation. Es geht ihm wie dem Welteroberer, der mit jedem neuen Land nur eine neue Grenze erobert.
Um das Gold als Geld festzuhalten und daher als Element der Schatzbildung, muss es verhindert werden zu circuliren oder als Kaufmittel sich in Genussmittel aufzulösen. Der Schatzbildner opfert daher dem Goldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem Evangelium der Entsagung. Andrerseits kann er der Circulation nur in Geld entziehn, was er ihr in Waare giebt. Je mehr er producirt, desto mehr kann er verkaufen. Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Geiz bilden daher seine Kar-
dinaltugenden, viel verkaufen, wenig kaufen, die Summe seiner politischen Oekonomie(FN 77).
Neben der unmittelbaren Form des Schatzes läuft seine ästhetische Form, der Besitz von Goldund Silberwaaren. Er wächst mit dem Reichthum der bürgerlichen Gesellschaft. „Soyons riches ou paraissons riches.“ (Diderot.) Es bildet sich so theils ein stets ausgedehnterer Markt für Gold und Silber, unabhängig von ihren Geldfunktionen, theils eine latente Zufuhrquelle des Geldes, die namentlich in gesellschaftlichen Sturmperioden fliesst.
Die Schatzbildung erfüllt verschiedne Funktionen in der Oekonomie der metallischen Circulation. Die nächste Funktion entspringt aus den Umlaufsbedingungen der Goldoder Silbermünze. Man hat gesehn, wie mit den beständigen Schwankungen der Waarencirculation in Umfang, Preisen und Geschwindigkeit die Umlaufsmasse des Geldes rastlos ebbt und fluthet. Sie muss also der Contraktion und Expansion fähig sein. Bald muss Geld als Münze attrahirt, bald Münze als Geld repellirt werden. Damit die wirklich umlaufende Geldmasse dem Sättigungsgrad der Circulationssphäre stets entspreche, muss das in einem Lande befindliche Goldoder Silberquantum grösser sein als das in Münzfunktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform des Geldes. Die Schatzreservoirs dienen zugleich als Abfuhrund Zufuhrkanäle des cirkulirenden Geldes, welches seine Umlaufskanäle daher nie überfüllt(FN 78).
In der bisher betrachteten unmittelbaren Form der Waarencirkulation war dieselbe Werthgrösse stets doppelt vorhanden, Waare auf dem einen Pol, Geld auf dem Gegenpol. Die Waarenbesitzer traten daher nur in Contakt als Repräsentanten wechselseitig vorhandner Aequivalente. Mit der Entwicklung der Waarencirkulation entwickeln sich jedoch Verhältnisse, wodurch die Veräusserung der Waare von der Realisirung ihres Preises zeitlich getrennt wird. Es genügt die einfachsten dieser Verhältnisse hier anzudeuten. Die eine Waarenart erheischt längere, die andere kürzere Zeitdauer zu ihrer Produktion. Die Produktion verschiedner Waaren ist an verschiedne Jahreszeiten geknüpft. Die eine Waare wird auf ihrem Marktplatz geboren, die andre muss zu entferntem Markt reisen. Der eine Waarenbesitzer kann daher als Verkäufer auftreten, bevor der andre als Käufer. Bei steter Wiederkehr derselben Transactionen unter denselben Personen regeln sich die Verkaufsbedingungen der Waaren nach ihren Produktionsbedingungen. Der eine Waarenbesitzer verkauft vorhandne Waare, der andre kauft als blosser Repräsentant von Geld oder als Repräsentant von künftigem Gelde. Der Verkäufer wird Gläubiger, der Käufer Schuldner. Da die Metamorphose der Waare oder die Entwicklung ihrer Werthform sich hier verändert, erhält auch das Gold eine andre Funktion. Es wird Zahlungsmittel(FN 79).
Der Charakter von Gläubiger oder Schuldner entspringt hier aus der einfachen Waarencirkulation. Ihre Formveränderung drückt dem Verkäufer und Käufer diese neuen Stempel auf. Zunächst also sind es ebenso verschwindende und wechselweis von denselben Cirkulationsagenten gespielte Rollen wie die von Verkäufer und Käufer. Jedoch sieht der Gegensatz jetzt von Haus aus minder gemüthlich aus und ist grösserer
Krystallisation fähig(FN 80). Dieselben Charaktere können aber auch von der Waarencirculation unabhängig auftreten. Der Klassenkampf der antiken Welt z. B. bewegt sich hauptsächlich in der Form eines Kampfes zwischen Gläubiger und Schuldner, und endet in Rom mit dem Untergang des plebejischen Schuldners, der durch den Sklaven ersetzt wird. Im Mittelalter endet der Kampf mit dem Untergang des feudalen Schuldners, der seine politische Macht mit ihrer ökonomischen Basis einbüsst. Indess spiegelt die Geldform — und das Verhältniss von Gläubiger und Schuldner besitzt die Form eines Geldverhältnisses — hier nur den Antagonismus tiefer liegender ökonomischer Lebensbedingungen wieder.
Kehren wir zur Sphäre der Waarencirculation zurück. Die gleichzeitige Erscheinung der Aequivalente Waare und Geld auf den beiden Polen des Verkaufsprozesses hat aufgehört. Das Geld funktionirt jetzt erstens als Werthmass in der Preisbestimmung der verkauften Waare. Ihr kontraktlich festgesetzter Preis misst die Obligation des Käufers, d. h. die Geldsumme, die er an bestimmtem Zeittermin schuldet. Es funktionirt zweitens als ideelles Kaufmittel. Obgleich es nur im Geldversprechen des Käufers existirt, bewirkt es den Händewechsel der Waare. Erst am fälligen Zahlungstermin tritt das Zahlungsmittel wirklich in Circulation, d. h. geht aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers über. Das Circulationsmittel verwandelte sich in Schatz, weil der Circulationsprozess mit der ersten Phase abbrach oder die verwandelte Gestalt der Waare der Circulation entzogen wurde. Das Zahlungsmittel tritt in die Circulation hinein, aber nachdem die Waare bereits aus ihr ausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr den Prozess. Es schliesst ihn selbstständig ab, als absolutes Dasein des Tauschwerths oder allgemeine Waare. Der Verkäufer verwandelte Waare in Geld, um ein Bedürfniss durch das Geld zu befriedigen, der Schatzbildner, um die Waare in Geldform zu präserviren, der schuldige Käufer, um zahlen zu können. Zahlt er nicht, so finden Zwangsverkäufe seiner Habe statt. Die Werthgestalt
der Waare, Geld, wird also jetzt zum Selbstzweck des Verkaufs durch eine den Verhältnissen des Circulationsprozesses selbst entspringende, gesellschaftliche Nothwendigkeit.
Der Käufer verwandelt Geld zurück in Waare, bevor er Waare in Geld verwandelt hat, oder vollzieht die zweite Waarenmetamorphose vor der ersten. Die Waare des Verkäufers circulirt, realisirt ihren Preis aber nur in einem privatrechtlichen Titel auf Geld. Sie verwandelt sich in Gebrauchswerth, bevor sie sich in Geld verwandelt hat. Die Vollziehung ihrer ersten Metamorphose folgt erst nachträglich.
In jedem bestimmten Zeitabschnitt des Circulationsprozesses repräsentiren die fälligen Obligationen die Preissumme der Waaren, deren Verkauf sie hervorrief. Die zur Realisirung dieser Preissumme nöthige Geldmasse hängt zunächst ab von der Umlaufsgeschwindigkeit der Zahlungsmittel. Sie ist bedingt durch zwei Umstände: die Verkettung der Verhältnisse von Gläubiger und Schuldner, so dass A, der Geld von seinem Schuldner B erhält, es an seinen Gläubiger C fortzahlt u. s. w. — und die Zeitlänge zwischen den verschiednen Zahlungsterminen. Die prozessirende Kette von Zahlungen oder nachträglichen ersten Metamorphosen unterscheidet sich wesentlich von der früher betrachteten Verschlingung der Metamorphosenreihen. Im Umlauf des Circulationsmittels wird der Zusammenhang zwischen Verkäufern und Käufern nicht nur ausgedrückt. Der Zusammenhang selbst entsteht erst in und mit dem Geldumlauf. Dagegen drückt die Bewegung des Zahlungsmittels einen schon vor ihr fertig vorhandnen gesellschaftlichen Zusammenhang aus.
Gleichzeitigkeit und Nebeneinander der Verkäufe beschränken den Ersatz der Münzmasse durch Umlaufsgeschwindigkeit. Sie bilden umgekehrt einen neuen Hebel in der Oekonomie der Zahlungsmittel. Mit der Concentration der Zahlungen an demselben Platz entwickeln sich naturwüchsig eigne Anstalten und Methoden ihrer Ausgleichung. So z. B. die virements im mittelaltrigen Lyon. Die Schuldforderungen von A an B, B an C, C an A u. s. w. brauchen bloss confrontirt zu werden, um sich wechselseitig bis zu einem gewissen Belauf als positive und negative Grössen aufzuheben. So bleibt nur eine Schuldbilanz zu saldiren. Je massenhafter die Concentration der Zahlungen, desto kleiner relativ die Bilanz, also die Masse der circulirenden Zahlungsmittel.
Die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel schliesst einen unvermittelten Widerspruch ein. So weit sich die Zahlungen ausgleichen, funktionirt es nur ideell als Rechengeld oder Mass der Werthe. Soweit wirkliche Zahlung zu verrichten, tritt es nicht als Circulationsmittel auf, als nur verschwindende und vermittelnde Form des Stoffwechsels, sondern als die individuelle Incarnation der gesellschaftlichen Arbeit, selbstständiges Dasein des Tauschwerths, absolute Waare. Dieser Widerspruch eklatirt in dem Moment der Produktionsund Handelskrisen, der Geldkrise heisst(FN 81). Sie ereignet sich nur, wo die prozessirende Kette der Zahlungen und ein künstliches System ihrer Ausgleichung völlig entwickelt sind. Mit allgemeineren Störungen dieses Mechanismus, woher sie immer entspringen mögen, schlägt das Geld plötzlich und unvermittelt aus der nur ideellen Gestalt des Rechengeldes in hartes Geld um. Es wird unersetzlich durch profane Waaren. Der Gebrauchswerth der Waare wird werthlos und ihr Werth verschwindet vor seiner eignen Werthform. Eben noch erklärte der Bürger in prosperitätstrunknem Aufklärungsdünkel das Geld für leeren Wahn. Nur die Waare ist Geld. Nur das Geld ist Waare! gellt’s jetzt über den Weltmarkt. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit seine Seele nach Geld, dem einzigen Reichthum(FN 82). In der Krise wird der Gegensatz zwischen der Waare und ihrer Werthgestalt, dem Geld, bis zum absoluten Widerspruch gesteigert. Die Erscheinungsform des Geldes ist hier daher auch gleichgültig. Die Geldhungersnoth
bleibt dieselbe, ob in Gold oder Creditgeld, Banknoten etwa, zu zahlen ist(FN 83).
Betrachten wir nun die Gesammtsumme des in einem gegebenen Zeitabschnitt umlaufenden Geldes, so ist sie, bei gegebener Umlaufsgeschwindigkeit der Cirkulationsund Zahlungsmittel, gleich der Summe der zu realisirenden Waarenpreise plus der Summe der fälligen Zahlungen minus der sich ausgleichenden Zahlungen. Selbst Preise, Geschwindigkeit des Geldumlaufs, und Oekonomie der Zahlungen gegeben, decken sich daher nicht länger die während einer Periode, eines Tags z. B., umlaufende Geldmasse und cirkulirende Waarenmasse. Es läuft Geld um, das der Cirkulation längst entzogne Waaren repräsentirt. Es laufen Waaren um, deren Geldäquivalent erst in der Zukunft erscheint. Andrerseits sind die jeden Tag contrahirten und die denselben Tag fälligen Zahlungen durchaus incommensurable Grössen(FN 84).
Das Creditgeld entspringt unmittelbar aus der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, indem Schuldcertificate für die verkauften Waaren selbst wieder zur Uebertragung der Schuldforderungen cirkuliren. Andrerseits, wie sich das Creditwesen ausdehnt, so die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel. Als solches erhält es eigne Existenzformen, worin es die Sphäre der grossen Handelstransaktionen behaust, während die Goldoder Silbermünze hauptsächlich in die Sphäre des Kleinhandels zurückgedrängt wird(FN 85).
Bei gewissem Höhegrad und Umfang der Waarenproduktion greift die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel über die Sphäre der Waarencirculation hinaus. Es wird die allgemeine Waare der Contrakte(FN 86). Renten, Steuern u. s. w. verwandeln sich aus Naturallieferungen in Geldzahlungen. Wie sehr diese Umwandlung durch die Gesammtgestalt des Produktionsprozesses bedingt wird, beweist z. B. der zweimal gescheiterte
Versuch des römischen Kaiserreichs alle Abgaben in Geld zu erheben. Das ungeheure Elend des französischen Landvolks unter Ludwig XIV., das Boisguillebert, Marschall Vauban u. s. w. so beredt denunciren, war nicht nur der Steuerhöhe geschuldet, sondern auch der Verwandlung von Naturalsteuer in Geldsteuer(FN 87). Wenn andrerseits die Naturalform der Grundrente, in Asien zugleich das Hauptelement der Staatssteuer, dort auf Produktionsverhältnissen beruht, welche sich mit der Unwandelbarkeit von Naturverhältnissen reproduciren, erhält jene Zahlungsform rückwirkend die alte Produktionsform. Sie bildet eines der Selbsterhaltungsgeheimnisse des türkischen Reichs. Zieht der durch Europa aufoctroyirte auswärtige Handel in Japan die Verwandlung von Naturalrente in Geldrente nach sich, so ist es um seine musterhafte Agrikultur geschehn. Ihre engen ökonomischen Existenzbedingungen werden sich auflösen.
In jedem Land setzen sich gewisse allgemeine Zahlungstermine fest. Sie beruhn theilweis, von andern Cirkelläufen der Reproduktion abgesehn, auf den an Wechsel der Jahreszeit gebundnen Naturbedingungen der Produktion. Sie regeln ebenso Zahlungen, die nicht direkt der Waarencirculation entspringen, wie Steuern, Renten u. s. w. Die Geldmasse, die zu diesen über die ganze Oberfläche der Gesellschaft zersplitterten Zahlungen an gewissen Tagen des Jahres erheischt ist, verursacht periodische, aber ganz oberflächliche Perturbationen in der Oekonomie der Zahlungsmittel(FN 88). Aus dem Gesetz über die Umlaufsgeschwin-
digkeit der Zahlungsmittel folgt, dass für alle periodischen Zahlungen, welches immer ihre Quelle, die nothwendige Masse der Zahlungsmittel in umgekehrtem Verhältniss zur Länge der Zahlungsperioden steht(FN 89).
Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel ernöthigt Geldaccumulationen für die Verfallstermine der geschuldeten Summen. Während die Schatzbildung als selbstständige Bereicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt der bürgerlichen Gesellschaft, wächst sie umgekehrt mit demselben in der Form von Reservefonds der Zahlungsmittel.
Mit dem Austritt aus der innern Circulationssphäre streift das Geld die dort aufschiessenden Lokalformen vom Massstab der Preise, Münze, Scheidemünze und Werthzeichen wieder ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle zurück. Im Welthandel entfalten die Waaren ihren Werth universell. Ihre selbstständige Werthgestalt tritt ihnen daher hier auch gegenüber als Weltgeld. Erst auf dem Weltmarkt funktio-
nirt das Geld in vollem Umfang als die Waare, deren Naturalform zugleich unmittelbar gesellschaftliche Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit in abstracto ist. Seine Daseinsweise wird seinem Begriff adäquat.
In der innern Cirkulationssphäre kann nur eine Waare zum Werthmass und daher als Geld dienen. Auf dem Weltmarkt herrscht doppeltes Werthmass, Gold und Silber(FN 90).
Das Weltgeld funktionirt als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Kaufmittel und absolut gesellschaftliche Materiatur des Reichthums überhaupt ( universal wealth). Die Funktion als Zahlungsmittel, zur Ausgleichung internationaler Bilanzen, herrscht vor. Daher das Losungswort des Merkantilsystems — Handelsbilanz(FN 91)! Zum internationalen Kaufmittel dienen Gold und Silber wesentlich, so oft das herkömmliche Gleichgewicht des Stoff-
wechsels zwischen verschiednen Nationen plötzlich gestört wird. Endlich als absolut gesellschaftliche Materiatur des Reichthums, wo es sich weder um Kauf noch Zahlung handelt, sondern um Uebertragung des Reichthums von einem Land zum andern, und wo diese Uebertragung in Waarenform entweder durch die Conjunkturen des Waarenmarkts oder den zu erfüllenden Zweck selbst ausgeschlossen wird(FN 92).
Wie für seine innere Circulation, braucht jedes Land für die Weltmarktscirculation einen Reservefonds. Die Funktionen der Schätze entspringen also theils aus der Funktion des Geldes als inneres Circulationsund Zahlungsmittel, theils seiner Funktion als Weltgeld. In der letzteren Rolle ist stets die wirkliche Geldwaare, leibhaftes Gold und Silber erheischt, wesswegen James Steuart Gold und Silber, im Unterschied von ihren nur lokalen Stellvertretern, ausdrücklich als money of the world charakterisirt.
Die Bewegung des Goldund Silberstroms ist eine doppelte. Einerseits wälzt er sich von seinen Quellen über den ganzen Weltmarkt, wo er von den verschiednen nationalen Circulationssphären in verschiednem Umfang abgefangen wird, um in die inneren Umlaufskanäle einzugehn, verschlissene Goldund Silbermünzen zu ersetzen, das Material von Luxuswaaren zu liefern und zu Schätzen zu erstarren(FN 93). Diese erste Bewegung ist vermittelt durch direkten Austausch der in Waare realisirten Nationalarbeiten mit der in edlen Metallen realishten Arbeit der Gold und Silber producirenden Länder. Andrerseits laufen Gold und Silber fortwährend hin und her zwischen den verschiednen nationalen Circulationssphären, eine Bewegung, die den unaufhörlichen Oscillationen des Wechselkurses folgt(FN 94).
Länder entwickelter bürgerlicher Produktion beschränken die in Bankreservoirs massenhaft concentrirten Schätze auf das zu ihren spezifischen Funktionen erheischte Minimum(FN 95). Mit gewisser Ausnahme zeigt auffallendes Ueberfüllen der Schatzreservoirs über ihr Durchschnittsniveau Stockung der Waarencirculation an oder unterbrochenen Fluss der Waarenmetamorphose(FN 96).
Zweites Kapitel. Die Verwandlung von Geld in Kapital.↑
1) Die allgemeine Formel des Kapitals.↑Die Waarencirculation ist der Ausgangspunkt des Kapitals. Waarenproduktion, Waarencirculation und entwickelte Waarencirculation, Handel, bilden daher stets die historischen Voraussetzungen, unter denen das Kapital entsteht. Von der Schöpfung des modernen Welthandels und
Weltmarkts im 16. Jahrhundert datirt die moderne Lebensgeschichte des Kapitals.
Sehn wir ab vom stofflichen Inhalt der Waarencirculation, vom Austausch der verschiednen Gebrauchswerthe, und betrachten wir nur die ökonomischen Formen, die dieser Prozess erzeugt, so finden wir als sein letztes Produkt das Geld. Diess letzte Produkt der Waarencirculation ist die erste Erscheinungsform des Kapitals.
Historisch tritt das Kapital dem Grundeigenthum überall zunächst in der Form von Geld gegenüber, von Geldvermögen, Kaufmannskapital und Wucherkapital(FN 1). Jedoch bedarf es nicht des Rückblicks auf die Entstehungsgeschichte des Kapitals, um das Geld als seine erste Erscheinungsform zu erkennen. Dieselbe Geschichte spielt täglich vor unsern Augen. Jedes neue Kapital betritt in erster Instanz die Bühne, d. h. den Markt, Waarenmarkt, Arbeitsmarkt, oder Geldmarkt, immer noch als Geld, Geld, das sich durch bestimmte Prozesse in Kapital verwandeln soll.
Geld als Geld und Geld als Kapital unterscheiden sich zunächst nur durch ihre verschiedene Circulationsform.
Die unmittelbare Form der Waarencirculation ist W — G — W, Verwandlung von Waare in Geld und Rückverwandlung von Geld in Waare, verkaufen um zu kaufen. Neben dieser Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unterschiedene vor, die Form G — W — G, Verwandlung von Geld in Waare und Rückverwandlung von Waare in Geld, kaufen um zu verkaufen. Geld, das in seiner Bewegung diese letztre Circulationsform beschreibt, verwandelt sich in Kapital, wird Kapital und ist schon an sich, d. h. seiner Bestimmung nach, Kapital.
Sehn wir uns die Circulation G — W — G näher an. Es ist ein Prozess, der gleich dem der einfachen Waarencirculation, zwei entgegengesetzte Phasen durchläuft und ihre Einheit bildet. In der ersten Phase, G — W, Kauf, wird das Geld in Waare verwandelt. In der zweiten Phase, W — G, Verkauf, wird die Waare in Geld rückverwandelt. Die Einheit beider Phasen aber, die Gesammtbewegung, stellt sich
dar als Austausch von Geld gegen Waare und Wiederaustausch derselben Waare gegen Geld, Waare kaufen um sie zu verkaufen, oder, wenn man die formellen Unterschiede von Kauf und Verkauf übersieht, mit dem Geld Waare und mit der Waare Geld kaufen(FN 2). Was aber das Resultat des Prozesses angeht, so erlischt er im Austausch von Geld gegen Geld, G — G. Wenn ich für 100 Pfd. St. 2000 Pfund Baumwolle kaufe und die 2000 Pfund Baumwolle wieder für 110 Pfd. St. verkaufe, so habe ich schliesslich 100 Pfd. St. gegen 110 Pfd. St. ausgetauscht, Geld gegen Geld.
Es ist nun zwar augenscheinlich, dass der Circulationsprozess G — W — G abgeschmackt und inhaltslos wäre, wollte man vermittelst seines Umwegs denselben Geldwerth gegen denselben Geldwerth, also z. B. 100 Pfd. St. gegen 100 Pfd. St. austauschen. Ungleich einfacher und sichrer wäre die Methode des Schatzbildners, der die 100 Pfd. St. festhält, statt sie der Circulationsgefahr preiszugeben. Andrerseits, ob der Kaufmann die mit 100 Pfd. St. gekaufte Baumwolle wieder verkauft zu 110 Pfd. St., oder ob er sie zu 100 Pfd. St. und selbst zu 50 Pfd. St. losschlagen muss, unter allen Umständen hat sein Geld eine eigenthümliche und originelle Bewegung beschrieben, durchaus verschieden von der, die es in der einfachen Waarencirculation beschreibt, z. B. in der Hand des Bauern, der Korn verkauft und mit dem so gelösten Geld Kleider kauft. Es gilt also zunächst die Charakteristik der Formunterschiede zwischen den Kreisläufen G — W — G und W — G — W. Damit wird sich zugleich der inhaltliche Unterschied ergeben, der hinter diesen Formunterschieden lauert.
Sehn wir zunächst, was beiden Formen gemeinsam.
Beide Kreisläufe zerfallen in dieselben zwei entgegengesetzten Phasen, W — G, Verkauf, und G — W, Kauf.. Jede dieser Phasen für sich betrachtet, ist kein Unterschied zu erkennen. Die den Prozess eingehenden Elemente sind in beiden Formen dieselben, Waare und Geld. In jedem Abschnitt der beiden Kreisläufe stehn sich dieselben ökonomischen Charaktermasken gegenüber, Käufer und Verkäufer. In beiden Prozessen treten
drei Contrahenten auf, so dass aber stets nur ein Contrahent abwechselnd als Käufer und Verkäufer figurirt, während von den beiden andern Contrahenten der eine nur verkauft und der andre nur kauft. Beide Kreisläufe endlich sind Einheiten derselben entgegengesetzten Phasen.
Der Formunterschied zwischen den Prozessen W — G — W und G — W — G springt erst in’s Auge, sobald man, statt der zwei Phasen, worin beide zerfallen, ihre Gesammtverläufe vergleicht. Was sie von vorn herein scheidet, ist die umgekehrte Reihenfolge derselben entgegengesetzten Circulationsphasen. Die einfache Waarencirculation beginnt mit dem Verkauf und endet mit dem Kauf, die Circulation des Geldes als Kapital beginnt mit dem Kauf und endet mit dem Verkauf. Dort bildet die Waare, hier das Geld den Ausgangspunkt und Schlusspunkt der Bewegung. In der ersten Form funktionirt das Geld, in der andern umgekehrt die Waare als Mittler des Gesammtverlaufs.
In der Circulation W — G — W wird das Geld schliesslich in Waare verwandelt, die als Gebrauchswerth dient. Das Geld ist also definitiv ausgegeben. In der umgekehrten Form G — W — G giebt der Käufer dagegen Geld aus, um als Verkäufer Geld einzunehmen. Er wirft Geld beim Kauf der Waare in die Circulation, um es ihr durch den Verkauf derselben Waare wieder zu entziehn. Er entlässt das Geld nur mit der hinterlistigen Absicht seiner wieder habhaft zu werden. Es wird daher nur vorgeschossen(FN 3).
In der Form W — G — W wechselt dasselbe Geldstück zweimal die Stelle. Der Verkäufer erhält es vom Käufer und zahlt es weg an einen andern Verkäufer. Mit der Weggabe von Geld für Waare schliesst der Gesammtprozess ab, wie er mit der Einnahme von Geld für Waare begann. Umgekehrt in der Form G — W — G. Nicht dasselbe Geldstück, sondern dieselbe Waare wechselt hier zweimal die Stelle. Der Käufer erhält sie aus der Hand des Verkäufers und giebt sie weg in die Hand eines andern Käufers. Wie in der einfachen Waarencirculation durch den zweimaligen Stellenwechsel dessel
ben Geldstücks sein definitives Uebergehn aus einer Hand in die andre bedingt ist, so hier durch den zweimaligen Stellenwechsel derselben Waare der Rückfluss des Geldes zu seinem ersten Ausgangspunkt.
Der Rückfluss des Geldes zu seinem Ausgangspunkt hängt nicht davon ab, ob oder ob nicht die Waare theurer verkauft wird als sie gekauft war. Dieser Umstand beeinflusst nur die Grösse der rückfliessenden Geldsumme. Das Phänomen des Rückflusses selbst findet statt, sobald die gekaufte Waare wieder verkauft, also der Kreislauf G — W — G vollständig beschrieben wird. Es ist diess also ein sinnlich wahrnehmbarer Unterschied zwischen der Circulation des Geldes als Kapital und seiner Circulation als blossem Geld.
Allerdings kann auch in W — G — W Rückfluss des Geldes zu seinem Ausgangspunkt stattfinden, aber nur durch die Erneuerung oder Wiederholung des Gesammtprozesses, nicht durch den Verlauf seiner eignen Momente. Wenn ich ein Quarter Korn verkaufe für 3 Pfd. St. und mit diesen 3 Pfd. St. Kleider kaufe, sind die 3 Pfd. St. für mich definitiv verausgabt. Ich habe nichts mehr mit ihnen zu schaffen. Sie sind des Kleiderhändlers. Verkaufe ich nun ein zweites Quarter Korn, so fliesst Geld zu mir zurück, aber nicht in Folge der ersten Transaktion, sondern nur in Folge ihrer Wiederholung. Es entfernt sich wieder von mir, sobald ich die zweite Transaktion zu Ende führe und von neuem kaufe. In der Circulation W — G — W hat also die Verausgabung des Geldes nichts mit seinem Rückfluss zu schaffen. In G — W — G dagegen ist der Rückfluss des Geldes durch die Art seiner Verausgabung selbst bedingt. Ohne diesen Rückfluss ist die Operation missglückt oder der Prozess unterbrochen und noch nicht fertig, weil seine zweite Phase, der den Kauf ergänzende und abschliessende Verkauf fehlt.
Der Kreislauf W — G — W geht aus von dem Extrem einer Waare und schliesst ab mit dem Extrem einer andern Waare, die aus der Circulation heraus und der Consumtion anheim fällt. Consumtion, Befriedigung von Bedürfnissen, mit einem Wort, Gebrauchswerth ist daher sein Endzweck. Der Kreislauf G — W — G geht dagegen aus von dem Extrem des Geldes und bewegt sich fort zu demselben Extrem als seinem Schluss. Sein treibendes Motiv und bestimmender Zweck ist daher der Tauschwerth selbst.
In der einfachen Waarencirculation haben beide Extreme dieselbe
ökonomische Formbestimmtheit. Sie sind beide Waaren. Sie sind auch Waaren von derselben Werthgrösse. Aber sie sind zugleich qualitativ verschiedne Gebrauchswerthe, z. B. Korn und Kleider. Der Produktenaustausch, der Wechsel der verschiednen Stoffe, worin sich die gesellschaftliche Arbeit darstellt, bildet hier den Inhalt der Bewegung. Anders in der Circulation G — W — G. Sie scheint auf den ersten Blick inhaltlos, weil tautologisch. Beide Extreme haben dieselbe ökonomische Formbestimmtheit. Sie sind beide Geld. Sie unterscheiden sich auch nicht qualitativ als Gebrauchswerthe, denn Geld ist eben die verwandelte Gestalt der Waaren, worin ihre besondern Gebrauchswerthe ausgelöscht sind. Erst 100 Pfd. St. gegen Baumwolle und dann wieder dieselbe Baumwolle gegen 100 Pfd. St. austauschen, also auf einem Umweg Geld gegen Geld, dasselbe gegen dasselbe, scheint eine ebenso zwecklose als abgeschmackte Operation(FN 4). Eine Geldsumme kann sich von der
andern Geldsumme überhaupt nur durch ihre Grösse unterscheiden. Der Prozess G — W — G schuldet seinen Inhalt daher keinem qualitativen Unterschied seiner Extreme, denn sie sind beide Geld, sondern nur ihrer quantitativen Verschiedenheit. Schliesslich wird der Circulation mehr Geld entzogen als Anfangs hineingeworfen ward. Die zu 100 Pfd. St. gekaufte Baumwolle wird z. B. wieder verkauft zu 100 + 10 Pfd. St. oder 110 Pfd. St. Die vollständige Form dieses Prozesses ist daher G — W — G', wo G' = G + ∆ G, d. h. gleich der ursprünglich vorgeschossenen Geldsumme plus einem Increment. Diess Increment oder den Ueberschuss über den ursprünglichen Werth nenne ich Mehrwerth ( surplus value). Der ursprünglich vorgeschossene Werth erhält sich daher nicht nur in der Circulation, sondern in ihr verändert er seine Werthgrösse, setzt einen Mehrwerth zu, oder verwerthet sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital.
Es ist zwar auch möglich, dass in W — G — W die beiden Extreme W, W, z. B. Korn und Kleider, quantitativ verschiedne Werthgrössen sind. Der Bauer kann sein Korn über dem Werth verkauft oder die Kleider unter ihrem Werth gekauft haben. Er kann seinerseits vom Kleiderhändler geprellt werden. Solche Werthverschiedenheit bleibt jedoch für diese Circulationsform selbst rein zufällig. Sinn und Verstand verliert sie nicht schier, wie der Prozess G — W — G, wenn die beiden Extreme, Korn und Kleider z. B., Aequivalente sind. Ihr Gleichwerth ist hier vielmehr Bedingung des normalen Verlaufs.
Die Wiederholung oder Erneurung des Verkaufs um zu kaufen findet, wie dieser Prozess selbst, Mass und Ziel an einem ausser ihm liegenden Endzwecke, der Consumtion, der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse. Im Kauf für den Verkauf dagegen sind Anfang und Ende dasselbe, Geld, Tauschwerth, und schon dadurch ist die Bewegung endlos. Allerdings ist aus G, G + ∆ G geworden, aus den 100 Pfd. St., 100 + 10. Aber blos die Form betrachtet, sind 110 Pfd. St. dasselbe wie 100 Pfd. St., nämlich Geld. Und die Werthgrösse betrachtet, sind 110 Pfd. eine beschränkte Werthsumme wie 100 Pfd. St. Würden die 110 Pfd. St. als Geld verausgabt, so fielen sie aus ihrer Rolle. Sie hörten auf Kapital zu sein. Der Circulation entzogen, versteinern sie zum Schatz und kein Farthing wächst ihnen an, ob sie bis
zum jüngsten Tag fortlagern. Handelt es sich also einmal um die Werthgrösse als solche, um Verwerthung des Werths, so besteht dasselbe Bedürfniss für die Verwerthung von 110 Pfd. St. wie für die von 100 Pfd. St., da beide beschränkte Ausdrücke des Tauschwerths sind, beide also denselben Beruf haben sich dem Reichthum schlechthin durch Grössenausdehnung anzunähern. Allerdings unterscheidet sich für einen Augenblick der ursprünglich vorgeschossene Werth 100 Pfd. St. von dem in der Circulation ihm zuwachsenden Mehrwerth von 10 Pfd. St., aber dieser Unterschied zerfliesst sofort wieder. Es kommt am Ende des Prozesses nicht auf der einen Seite der Originalwerth von 100 Pfd. St. und auf der andern Seite der Mehrwerth von 10 Pfd. St. heraus. Was herauskommt ist Ein Werth von 110 Pfd. St., der sich ganz in derselben entsprechenden Form befindet, um den Verwerthungsprozess zu beginnen, wie die ursprünglichen 100 Pfd. St. Geld kommt am Ende der Bewegung wieder als ihr Anfang heraus(FN 5). Wenn die einfache Waarencirculation daher im Gebrauchswerth eine ihr von aussen gesetzte Schranke hat, ist die Bewegung des Kapitals dagegen masslos, indem sie in ihrem Abschluss das Prinzip und den Trieb ihrer Wiedererneuerung findet, und ihr Ziel, die Verwerthung des Werths, am Ende des Prozesses eben so wenig erreicht ist als am Anfang(FN 6).
Als bewusster Träger dieses Prozesses wird der Geldbesitzer Kapitalist. Seine Person, oder vielmehr seine Tasche, ist der Ausgangspunkt
und der Rückkehrpunkt des Geldes. Der objektive Inhalt jenes Prozesses — Verwerthung des Werths — ist sein subjektiver Zweck, und nur soweit wachsende Aneignung des abstrakten Reichthums das allein treibende Motiv seiner Operationen, funktionirt er als Kapitalist oder personificirtes, mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Der Gebrauchswerth ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten zu behandeln(FN 7). Auch nicht der einzelne Gewinn, sondern nur die rastlose Bewegung des Gewinnens(FN 8). Dieser absolute Bereicherungstrieb, diese
leidenschaftliche Jagd auf den Tauschwerth(FN 9) ist dem Kapitalisten mit dem Schatzbildner gemein, aber während der Schatzbildner nur der verrückte Kapitalist, ist der Kapitalist der rationelle Schatzbildner. Die Unvergänglichkeit des Tauschwerths, die der Schatzbildner anstrebt, indem er das Geld vor der Circulation zu retten sucht(FN 10), erreicht der klügere Kapitalist, indem er es stets von neuem der Circulation preisgiebt(FN 10a).
In der einfachen Circulation entwickeln die Waaren ihren Werth zu verschiednen ihrem Gebrauchswerth gegenübertretenden selbstständigen Formen, d. h. zu Geldformen, die den Austausch vermitteln und in seinem Endresultat verschwinden. In der Circulation G — W — G funktioniren beide, Waare und Geld, nur als verschiedne Existenzweisen des Werths selbst, das Geld seine allgemeine, die Waare seine besondre, so zu sagen nur verkleidete Existenzweise(FN 11). Er geht beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren und verwandelt sich so in ein automatisches, in sich selbst prozessirendes Subjekt. Fixirt man eine der besondern Erscheinungsformen, worin er sich abwechselnd darstellt, so erhält man die Erklärungen: Kapitalist Geld, Kapitalist Waare(FN 12). In der That aber wird
der Werth hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Waare, seine Grösse selbst verändert, sich als Mehrwerth von sich selbst als ursprünglichem Werth abstösst, sich selbst verwerthet. Denn die Bewegung, worin er Mehrwerth zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwerthung ist also Selbstverwerthung. Er hat die occulte Qualität erhalten, Werth zu setzen, weil er Werth ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier.
Als das übergreifende Subjekt eines solchen Prozesses, worin er Geldform und Waarenform bald annimmt, bald abstösst, sich aber in diesem Wechsel erhält und ausreckt, bedarf der Werth natürlich vor allem einer selbsstständigen Form, wodurch seine Identität mit sich selbst konstatirt werden kann. Und diese Form besitzt er nur im Gelde. Diess bildet daher Ausgangspunkt und Schlusspunkt jeden Verwerthungsprozesses. Er war 100 Pfd. St., er ist jetzt 110 Pfd. St. u. s. w. Aber das Geld selbst gilt hier nur als eine Form des Werths, denn er hat deren zwei. Und die Annahme der Waarenform bildet grade das vermittelnde Moment seiner Bewegung. Das Geld tritt hier also nicht polemisch gegen die Waare auf, wie in der Schatzbildung. Der Kapitalist weiss, dass alle Waaren, wie lumpig sie immer aussehn oder wie schlecht sie immer riechen mögen, im Glauben und in der Wahrheit Geld, innerlich verschnittene Juden sind. G — G', geldheckendes Geld — ( money which begets money lautet die Beschreibung des Kapitals im Munde seiner ersten Dolmetscher, der Mercantilisten), — ist in der That nur die unmittelbare Erscheinungsform des Werth setzenden Werths, des sich selbst verwerthenden Werths.
Wenn der Tauschwerth in der Waarencirculation höchstens zur selbstständigen Form gegenüber dem Gebrauchswerth der Waare heranreift, so stellt er sich hier plötzlich dar als eine prozessirende, sich selbst bewegende Substanz, für welche Waare und Geld beide blosse Formen. Aber noch mehr. Statt Waarenverhältnisse darzustellen, tritt er jetzt so zu sagen in ein Privatverhältniss zu sich selbst. Er unterscheidet sich als ursprünglicher Werth von sich selbst als Mehrwerth, als Gott Vater von sich selbst als Gottsohn, und beide sind vom selben Alter, und bilden in der That nur eine Person, denn nur durch den Mehrwerth von 10 Pfd. St. werden die vorgeschossenen 100 Pfd. St. Kapital, und sobald sie diess geworden, sobald der
Sohn, und durch den Sohn der Vater erzeugt, verschwindet ihr Unterschied wieder und sind beide Eins, 110 Pfd. St.
Der Werth wird also prozessirender Werth, prozessirendes Geld und als solches Kapital. Er kommt aus der Circulation her, geht wieder in sie ein, erhält und vervielfältigt sich in ihr, kehrt vergrössert aus ihr zurück und beginnt denselben Kreislauf stets wieder von neuem(FN 13).
Kaufen um zu verkaufen, oder vollständiger, kaufen um theurer zu verkaufen, G — W — G', scheint zwar nur einer Art des Kapitals, dem Kaufmannskapital, eigenthümliche Form. Aber auch das industrielle Kapital ist Geld, das sich in Waare verwandelt und durch den Verkauf der Waare in mehr Geld rückverwandelt. Akte, die etwa zwischen dem Kauf und dem Verkaufe, ausserhalb der Circulationssphäre, vorgehn, ändern nichts an dieser Form der Bewegung. In dem zinstragenden Kapital endlich stellt sich die Form G — W — G' abgekürzt dar, im Resultat ohne die Vermittlung, so zu sagen im Lapidarstyl, als G — G', Geld, das gleich mehr Geld, Werth, der grösser als er selbst ist.
In der That also ist G — W — G' die allgemeine Formel des Kapitals, wie es unmittelbar in der Circulationssphäre erscheint.
b) Widersprüche der allgemeinen Formel.↑Die Circulationsform, worin sich das Geld zum Kapital entpuppt, widerspricht allen früher entwickelten Gesetzen über die Natur der Waare, des Werths, des Geldes und der Circulation selbst. Was sie von der einfachen Waarencirculation unterscheidet, ist die umgekehrte Reihenfolge derselben zwei entgegengesetzten Prozesse, Verkauf und Kauf. Und wie sollte dieser rein formelle Unterschied die Natur dieser Prozesse umzaubern?
Noch mehr. Diese Umkehrung existirt nur für einen der drei Geschäftsfreunde, die mit einander handeln. Als Kapitalist kaufe ich Waare von A und verkaufe sie wieder an B, während ich als einfacher Waarenbesitzer Waare an B verkaufe und dann Waare von A kaufe. Für die Geschäftsfreunde A und B existirt dieser Unterschied nicht. Sie treten
nur als Käufer oder Verkäufer von Waaren auf. Ich selbst stehe ihnen jedesmal als einfacher Geldbesitzer oder Waarenbesitzer, Käufer oder Verkäufer, gegenüber, und zwar trete ich in beiden Reihenfolgen der einen Person nur als Käufer und der andern nur als Verkäufer gegenüber, der einen als nur Geld, der andern als nur Waare, keiner von beiden als Kapital oder Kapitalist oder Repräsentant von irgend etwas, das mehr als Geld oder Waare wäre oder eine andere Wirkung ausser der des Geldes oder der Waare ausüben könnte. Für mich bilden Kauf von A und Verkauf an B eine Reihenfolge. Aber der Zusammenhang zwischen diesen beiden Akten existirt nur für mich. A scheert sich nicht um meine Transaktion mit B, und B nicht um meine Transaktion mit A. Wollte ich ihnen etwa das besondere Verdienst klar machen, das ich mir durch die Umkehrung der Reihenfolge erworben, so würden sie mir beweisen, dass ich mich in der Reihenfolge selbst irre und dass die Gesammttransaktion nicht mit einem Kauf begann und einem Verkauf endete, sondern umgekehrt mit einem Verkauf begann und mit einem Kauf abschloss. In der That, mein erster Akt, der Kauf, war von A’s Standpunkt ein Verkauf, und mein zweiter Akt, der Verkauf, war von B’s Standpunkt ein Kauf. Nicht zufrieden damit, werden A und B erklären, dass die ganze Reihenfolge überflüssig und Hokus Pokus war. A wird die Waare direkt an B verkaufen und B sie direkt von A kaufen. Damit verschrumpft die ganze Transaktion in einen einseitigen Akt der gewöhnlichen Waarencirculation, vom Standpunkt A’s blosser Verkauf und vom Standpunkt B’s blosser Kauf. Wir sind also durch die Umkehrung der Reihenfolge nicht über die Sphäre der einfachen Waarencirculation hinausgekommen und müssen vielmehr zusehn, ob sie ihrer Natur nach Verwerthung der in sie hineingehenden Werthe und daher Bildung von Mehrwerth gestattet.
Nehmen wir den Circulationsprozess in einer Form, worin er sich als blosser Waarenaustausch darstellt. Diess ist stets der Fall, wenn beide Waarenbesitzer Waaren von einander kaufen und die Bilanz ihrer wechselseitigen Geldforderungen sich am Zahlungstag ausgleicht. Das Geld dient hier als Rechengeld, um die Werthe der Waaren in ihren Preisen auszudrücken, tritt aber nicht den Waaren selbst dinglich gegenüber. Soweit es sich um den Gebrauchswerth handelt, ist es klar, dass beide Austauscher hier gewinnen können. Beide veräussern Waaren, die ihnen als Gebrauchswerth nutzlos, und erhalten Waaren, deren sie zum Ge-
brauch bedürfen. Und dieser Nutzen mag nicht der einzige sein. A, der Wein verkauft und Getreide kauft, producirt vielleicht mehr Wein als Getreidebauer B in derselben Arbeitszeit produciren könnte und Getreidebauer B in derselben Arbeitszeit mehr Getreide als Weinbauer A produciren könnte. A erhält also für denselben Tauschwerth mehr Getreide und B mehr Wein als wenn jeder von den beiden, ohne Austausch, Wein und Getreide für sich selbst produciren müsste. Mit Bezug auf den Gebrauchswerth also kann gesagt werden, dass „der Austausch eine Transaktion ist, worin beide Seiten gewinnen(FN 14).“ Anders mit dem Tauschwerth. „Ein Mann, der viel Wein und kein Getreide besitzt, handelt mit einem Mann, der viel Getreide und keinen Wein besitzt und zwischen ihnen wird ausgetauscht Weizen zum Werth von 50 gegen einen Werth von 50 in Wein. Dieser Austausch ist keine Vermehrung des Tauschwerths weder für den einen, noch für den andern; denn bereits vor dem Austausch besass jeder von ihnen einen Werth gleich dem, den er sich vermittelst dieser Operation verschafft hat(FN 15).“ Es ändert nichts an der Sache, wenn das Geld als Circulationsmittel zwischen die Waaren tritt und die Akte des Kaufs und Verkaufs sinnlich auseinanderfallen(FN 16). Der Werth der Waaren ist in ihren Preisen dargestellt, bevor sie in die Circulation treten, also Voraussetzung und nicht Resultat derselben(FN 17).
Abstrakt betrachtet, d. h. abgesehn von Umständen, die nicht aus den immanenten Gesetzen der einfachen Waarencirculation hervorfliessen, geht ausser dem Ersatz eines Gebrauchswerths durch einen andern nichts in ihr vor als eine Metamorphose, ein blosser Formwechsel der Waare. Derselbe Tauschwerth, d. h. dasselbe Quantum vergegen-
ständlichter gesellschaftlicher Arbeit, bleibt in der Hand desselben Waarenbesitzers abwechselnd in Gestalt seiner Waare, des Geldes, worin sie sich verwandelt, der Waare, worin sich diess Geld rückverwandelt. Dieser Formwechsel schliesst keine Aenderung der Werthgrösse ein. Der Wechsel aber, den der Tauschwerth der Waare selbst in diesem Prozess erfährt, beschränkt sich auf einen Wechsel seiner Geldform. Er existirt erst als Preis der zum Verkauf angebotenen Waare, dann als dieselbe Geldsumme, die in diesem Preise ausgedrückt ist, endlich als der Preis einer äquivalenten Waare. Dieser Formwechsel schliesst an und für sich eben so wenig eine Aenderung der Werthgrösse ein, wie das Auswechseln einer Fünfpfundnote gegen Sovereigns, halbe Sovereigns und Schillinge. Sofern also die Cirkulation der Waare nur einen Formwechsel ihres Tauschwerths bedingt, bedingt sie, wenn das Phänomen rein vorgeht, Austausch von Aequivalenten. Die Vulgärökonomie selbst, so wenig sie ahnt, was der Werth ist, unterstellt daher, so oft sie in ihrer Art das Phänomen rein betrachten will, dass Nachfrage und Zufuhr sich decken, d. h. dass ihre Wirkung überhaupt fortfällt. Wenn also mit Bezug auf den Gebrauchswerth beide Austauscher gewinnen können, können sie nicht beide gewinnen an Tauschwerth. Hier heisst es vielmehr: „Wo Gleichheit ist, ist kein Gewinn(FN 18).“ Waaren können zwar zu Preisen verkauft werden, die von ihren Werthen abweichen, aber diese Abweichung erscheint als Verletzung des Gesetzes des Waarenaustausches(FN 19). In seiner reinen Gestalt ist er ein Austausch von Aequivalenten, also kein Mittel sich an Werth zu bereichern(FN 20).
Hinter den Versuchen, die Waarencirkulation als Quelle von Mehrwerth darzustellen, lauert daher meist ein quid pro quo, eine Verwechslung von Gebrauchswerth und Tauschwerth. So z. B. bei Con
dillac: „Es ist falsch, dass man im Waarenaustausch gleichen Werth gegen gleichen Werth austauscht. Umgekehrt. Jeder der beiden Contrahenten giebt immer einen kleineren für einen grösseren Werth … Tauschte man in der That immer gleiche Werthe aus, so wäre kein Gewinn zu machen für irgend einen Contrahenten. Aber alle beide gewinnen oder sollten doch gewinnen. Warum? Der Werth der Dinge besteht bloss in ihrer Beziehung auf unsere Bedürfnisse. Was für den einen mehr, ist für den andern weniger, und umgekehrt. … Man setzt nicht voraus, dass wir unsrer Consumtion unentbehrliche Dinge zum Verkauf ausbieten. . . . Wir wollen eine uns nutzlose Sache weggeben, um eine uns nothwendige zu erhalten; wir wollen weniger für mehr geben … Es war natürlich zu urtheilen, dass man im Austausch gleichen Werth für gleichen Werth gebe, so oft jedes der ausgetauschten Dinge an Werth demselben Quantum Geld gleich war … Aber eine andre Betrachtung muss noch in die Rechnung eingehn; es fragt sich, ob wir beide einen Ueberfluss gegen etwas Nothwendiges austauschen(FN 21).“ Man sieht, wie Condillac nicht nur Gebrauchswerth und Tauschwerth durcheinander wirft, sondern wahrhaft kindlich einer Gesellschaft mit entwickelter Waarenproduktion einen Zustand unterschiebt, worin der Producent seine Subsistenzmittel selbst producirt und nur den Ueberschuss über den eignen Bedarf, den Ueberfluss, in die Cirkulation wirft(FN 22). Dennoch wird Condillac’s Argument häufig bei modernen Oekonomen wiederholt, namentlich wenn es gilt, die entwickelte Gestalt des Waarenaustausches, den Handel, als produktiv von Mehrwerth darzustellen. „Der Handel“, heisst es z. B., „ fügt den Produkten Werth zu, denn dieselben
Produkte haben mehr Werth in den Händen des Consumenten als in den Händen des Producenten und er muss daher wörtlich (strictly) als Produktionsakt betrachtet werden(FN 23).“ Aber man zahlt die Waaren nicht doppelt, das einemal ihren Gebrauchswerth und das andremal ihren Tausch werth. Und wenn der Gebrauchswerth der Waare dem Käufer nützlicher als dem Verkäufer, ist ihre Geldform dem Verkäufer nützlicher als dem Käufer. Würde er sie sonst verkaufen? Und so könnte ebensowohl gesagt werden, dass der Käufer wörtlich (strictly) einen „Produktionsakt“ vollbringt, indem er z. B. die Strümpfe des Kaufmanns in Geld verwandelt.
Werden Waaren oder Waaren und Geld von gleichem Tauschwerth, also Aequivalente ausgetauscht, so zieht offenbar keiner mehr Werth aus der Cirkulation heraus als er in sie hineinwirft. Es findet dann keine Bildung von Mehrwerth Statt. In seiner reinen Form aber bedingt der Cirkulationsprozess der Waaren Austausch von Aequivalenten. Jedoch gehn die Dinge in der Wirklichkeit nicht rein zu. Unterstellen wir daher Austausch von Nicht-Aequivalenten.
Jedenfalls steht auf dem Waarenmarkt nur Waarenbesitzer dem Waarenbesitzer gegenüber, und die Macht, die diese Personen über einander ausüben, ist nur die Macht ihrer Waaren. Die stoffliche Verschiedenheit der Waaren ist das stoffliche Motiv des Austauschs und macht die Waarenbesitzer wechselseitig von einander abhängig, indem keiner von ihnen den Gegenstand seines eignen Bedürfnisses und jeder von ihnen den Gegenstand des Bedürfnisses der Andern in seiner Hand hält. Ausser dieser stofflichen Verschiedenheit ihrer Gebrauchswerthe besteht nur noch ein Unterschied unter den Waaren, der Unterschied zwischen ihrer Naturalform und ihrer verwandelten Form, zwischen Waare und Geld. Und so unterscheiden sich die Waarenbesitzer nur als Verkäufer, Besitzer von Waare, und als Käufer, Besitzer von Geld.
Gesetzt nun, es sei durch irgend ein unerklärliches Privilegium dem Verkäufer gegeben, die Waare über ihrem Werthe zu verkaufen, zu 110, wenn sie 100 werth ist, also mit einem nominellen Preisaufschlage von 10 %. Der Verkäufer kassirt also einen Mehrwerth von 10 ein. Aber
nachdem er Verkäufer war, wird er Käufer. Ein dritter Waarenbesitzer begegnet ihm jetzt als Verkäufer und geniesst seinerseits das Privilegium, die Waare 10 % zu theuer zu verkaufen. Unser Mann hat als Verkäufer 10 gewonnen, um als Käufer 10 zu verlieren(FN 24). Das ganze kömmt in der That darauf hinaus, dass alle Waarenbesitzer ihre Waaren einander 10 % über dem Werth verkaufen, was ganz dasselbe ist, als ob sie die Waaren zu ihren Werthen verkauften. Ein solcher allgemeiner nomineller Preisaufschlag der Waaren bringt dieselbe Wirkung hervor, als ob die Waarenwerthe z. B. in Silber statt in Gold geschätzt würden. Die Geldnamen, d. h. die Preise der Waaren würden anschwellen, aber ihre Werthverhältnisse unverändert bleiben.
Unterstellen wir umgekehrt, es sei das Privilegium des Käufers, die Waaren unter ihrem Werth zu kaufen. Hier ist es nicht einmal nöthig zu erinnern, dass der Käufer wieder Verkäufer wird. Er war Verkäufer, bevor er Käufer ward. Er hat bereits 10 % als Verkäufer verloren, bevor er 10 % als Käufer gewinnt(FN 25). Alles bleibt wieder beim Alten.
Die Bildung von Mehrwerth, und daher die Verwandlung von Geld in Kapital, kann also weder dadurch erklärt werden, dass die Verkäufer die Waaren über ihrem Werthe verkaufen, noch dadurch, dass die Käufer sie unter ihrem Werthe kaufen(FN 26).
Das Problem wird in keiner Weise dadurch vereinfacht, dass man fremde Beziehungen einschmuggelt, also etwa mit Oberst Torrens sagt:
„Die effektive Nachfrage besteht in dem Vermögen und der Neigung (!) der Konsumenten, sei es durch unmittelbaren oder vermittelten Austausch, für Waaren eine gewisse grössere Portion von allen Ingredienzien des Kapitals zu geben, als ihre Produktion kostet(FN 27).“ In der Cirkulation stehn sich Produzenten und Konsumenten nur als Verkäufer und Käufer gegenüber. Behaupten, der Mehrwerth für den Produzenten entspringe daraus, dass die Konsumenten die Waare über dem Werth zahlen, heisst nur den einfachen Satz maskiren: Der Waarenbesitzer besitzt als Verkäufer das Privilegium zu theuer zu verkaufen. Der Verkäufer hat die Waare selbst producirt oder vertritt ihren Produzenten, aber der Käufer hat nicht minder die in seinem Gelde dargestellte Waare selbst produzirt oder vertritt ihren Produzenten. Es steht also Produzent dem Produzenten gegenüber. Was sie unterscheidet, ist dass der eine kauft und der andre verkauft. Es bringt uns keinen Schritt weiter, dass der Waarenbesitzer unter dem Namen Produzent die Waare über ihrem Werthe verkauft und unter dem Namen Consument sie zu theuer zahlt(FN 28).
Die consequenten Vertreter der Illusion, dass der Mehrwerth aus einem nominellen Preiszuschlag entspringt, oder aus dem Privilegium des Verkäufers die Waare zu theuer zu verkaufen, unterstellen daher eine Klasse, die nur kauft ohne zu verkaufen, also auch nur consumirt ohne zu produziren. Die Existenz einer solchen Klasse ist von unsrem bisher erreichten Standpunkt, dem der einfachen Cirkulation nach, unerklärlich. Aber greifen wir vor. Das Geld, womit eine solche Klasse beständig kauft, muss ihr beständig, ohne Austausch, umsonst, auf beliebige Rechtsund Gewaltstitel hin, von den Waarenbesitzern selbst zufliessen. Dieser Klasse die Waaren über dem Werth verkaufen, heisst nur, umsonst weggegebenes Geld sich zum Theil wieder zurückschwindeln(FN 29). So zahlten die kleinasiatischen Städte jährlichen
Geldtribut an das alte Rom. Mit diesem Geld kaufte Rom Waaren von ihnen und kaufte sie zu theuer. Die Kleinasiaten prellten die Römer, indem sie den Eroberern einen Theil des Tributs wieder abluchsten auf dem Wege des Handels. Aber dennoch blieben die Kleinasiaten die Geprellten. Ihre Waaren wurden ihnen nach wie vor mit ihrem eignen Gelde gezahlt. Es ist diess keine Methode der Bereicherung oder der Bildung von Mehrwerth.
Halten wir uns also innerhalb der Schranken des Waarenaustauschs, wo Verkäufer Käufer und Käufer Verkäufer sind. Unsere Verlegenheit stammt vielleicht daher, dass wir die Personen nur als personificirte Categorien, nicht individuell, gefasst haben.
Waarenbesitzer A mag so pfiffig sein seine Collegen B oder C über’s Ohr zu hauen, während sie trotz des besten Willens die Revanche schuldig bleiben. A verkauft Wein zum Werth von 40 Pfd. St. an B und erwirbt im Austausch Getreide zum Werth von 50 Pfd. St. A hat seine 40 Pfd. St. in 50 Pfd. St. verwandelt, mehr Geld aus weniger Geld gemacht und seine Waare in Kapital verwandelt. Sehn wir näher zu. Vor dem Austausch hatten wir für 40 Pfd. St. Wein in der Hand von A und für 50 Pfd. St. Getreide in der Hand von B, Gesammtwerth von 90 Pfd. St. Nach dem Austausch haben wir denselben Gesammtwerth von 90 Pfd. St. Der circulirende Werth hat sich um kein Atom vergrössert, seine Vertheilung zwischen A und B hat sich verändert. Auf der einen Seite erscheint als Mehrwerth, was auf der anderen Minderwerth ist, auf der einen Seite als Plus, was auf der andern als Minus. Derselbe Wechsel hätte sich ereignet, wenn A, ohne die verhüllende Form des Austauschs, dem B 10 Pfd. St. direkt gestohlen hätte. Die Summe der circulirenden Werthe kann offenbar durch keinen Wechsel in ihrer Vertheilung vermehrt werden, so wenig wie ein Jude die Masse der edlen Metalle in einem Lande dadurch vermehrt, dass er einen Farthing aus der Zeit der Königin Anna
für eine Guinea verkauft. Die Gesammtheit der Kapitalistenklasse eines Landes kann sich nicht selbst übervortheilen(FN 30).
Man mag sich also drehen und wenden wie man will, das Facit bleibt dasselbe. Werden Aequivalente ausgetauscht, so entsteht kein Mehrwerth, und werden Nicht-Aequivalente ausgetauscht, so entsteht auch kein Mehrwerth(FN 31). Die Circulation oder der Waarenaustausch schafft keinen Werth(FN 32).
Man versteht daher, warum in unserer Analyse der Grundform des Kapitals, der Form, worin es die ökonomische Organisation der modernen Gesellschaft bestimmt, seine populärsten und so zu sagen antediluvianischen Gestalten, Handelskapital und Wucherkapital, zunächst gänzlich unberücksichtigt bleiben.
Im eigentlichen Handelskapital erscheint die Form G — W — G', kaufen um theuer zu verkaufen, am reinsten. Andrerseits geht seine ganze Bewegung innerhalb der Circulationssphäre vor. Da es aber unmöglich ist aus der Circulation selbst die Verwandlung von Geld in Kapital, die Bildung von Mehrwerth zu erklären, erscheint das Handelskapital unmöglich, sobald Aequivalente ausgetauscht werden(FN 33), daher nur
ableitbar aus der doppelseitigen Uebervortheilung der kaufenden und verkaufenden Waarenproducenten durch den sich parasitisch zwischen sie schiebenden Kaufmann. In diesem Sinn sagt Franklin: „ Krieg ist Raub, Handel ist Prellerei(FN 34):“ Soll die Verwerthung des Handelskapitals nicht aus blosser Prellerei der Waarenproducenten erklärt werden, so gehört dazu eine lange Reihe von Mittelgliedern, die hier, wo die Waarencirculation und ihre einfachen Momente unsere einzige Voraussetzung bilden, noch gänzlich fehlt.
Was vom Handelskapital, gilt noch mehr vom Wucherkapital. Im Handelskapital sind die Extreme, das Geld, das auf den Markt geworfen und das vermehrte Geld, das dem Markt entzogen wird, wenigstens vermittelt durch Kauf und Verkauf, durch die Bewegung der Circulation. Im Wucherkapital ist die Form G — W — G' abgekürzt auf die unvermittelten Extreme G — G', Geld, das sich gegen mehr Geld austauscht, eine der Natur des Geldes widersprechende und daher vom Standpunkt des Waarenaustauschs unerklärliche Form. Daher Aristoteles: „da die Chrematistik eine doppelte ist, die eine zum Handel, die andre zur Oekonomik gehörig, die letztere nothwendig und lobenswerth, die erstere auf die Circulation gegründet und mit Recht getadelt, (denn sie beruht nicht auf der Natur, sondern auf wechselseitiger Prellerei), so ist der Wucher mit vollstem Rechte verhasst, weil das Geld selbst hier die Quelle des Erwerbs und nicht dazu gebraucht wird, wozu es erfunden ward. Denn für den Waarenaustausch entstand es, der Zins aber macht aus Geld mehr Geld. Daher auch sein Name (τόϰος Zins und Geborenes). Denn die Geborenen sind den Erzeugern ähnlich. Der Zins aber ist Geld von Geld, so dass von allen Erwerbszweigen dieser der naturwidrigste(FN 35).“
Wie das Handelskapital werden wir das zinstragende Kapital im Verlauf unserer Untersuchung als abgeleitete Formen
vorfinden und zugleich sehn, warum sie historisch vor dem Kapital in seiner modernen Grundform erscheinen.
Es hat sich gezeigt, dass der Mehrwerth nicht aus der Circulation entspringen kann, bei seiner Bildung also etwas hinter ihrem Rücken vorgehn muss, das in ihr selbst unsichtbar ist(FN 36). Kann aber der Mehrwerth anders woher entspringen als aus der Circulation? Die Circulation ist die Summe aller Wechselbeziehungen der Waarenbesitzer. Ausserhalb derselben steht der Waarenbesitzer nur noch in Beziehung zu seiner eignen Waare. Was ihren Werth(FN 37) angeht, beschränkt sich das Verhältniss darauf, dass sie ein nach bestimmten gesellschaftlichen Gesetzen gemessenes Quantum seiner eignen Arbeit enthält. Diess Quantum Arbeit drückt sich aus in der Werthgrösse seiner Waare und da sich Werthgrösse in Rechengeld darstellt, in einem Preise von z. B. 10 Pfd. St. Aber seine Arbeit stellt sich nicht dar im Werthe der Waare und einem Ueberschuss über ihren eignen Werth, nicht in einem Preise von 10, der zugleich ein Preis von 11 ist, nicht in einem Werth, der grösser als er selbst ist. Der Waarenbesitzer kann durch seine Arbeit Werthe bilden, aber keine sich verwerthenden Werthe. Er kann den Werth einer Waare erhöhen, indem er vorhandnem Werth neuen Werth durch neue Arbeit zusetzt, z. B. aus Leder Stiefel macht. Derselbe Stoff hat jetzt mehr Werth, weil er ein grösseres Arbeitsquantum enthält. Der Stiefel hat daher mehr Werth als das Leder, aber der Werth des Leders ist geblieben, was er war. Er hat sich nicht verwerthet, nicht während der Stiefelfabrikation seinen ursprünglichen Werth um einen Mehrwerth bereichert. Es ist also unmöglich, dass der Waarenproducent ausserhalb der Circulationssphäre, ohne mit andern Waarenbesitzern in Berührung zu treten, Werth verwerthe und daher Geld oder Waare in Kapital verwandle.
Kapital kann also nicht aus der Circulation entspringen und es kann eben so wenig aus der Circulation nicht entspringen. Es muss zugleich in ihr und nicht in ihr entspringen.
Ein doppeltes Resultat hat sich also ergeben.
Die Verwandlung des Geldes in Kapital ist auf Grundlage dem Waarenaustausch immanenter Gesetze zu entwickeln, so dass der Austausch von Aequivalenten als Ausgangspunkt gilt(FN 38). Unser nur noch als Kapitalistenraupe vorhandner Geldbesitzer muss die Waaren zu ihrem Werth kaufen, zu ihrem Werth verkaufen, und dennoch am Ende des Prozesses mehr Werth herausziehn als er hineinwarf. Seine Schmetterlingsentfaltung muss in der Cirkulationssphäre und muss nicht in der Cirkulationssphäre vorgehn. Diess sind die Bedingungen des Problems. Hie Rhodus, hic salta!
3) Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.↑Die Werthveränderung des Geldes, das sich in Kapital verwandeln soll, kann nicht an diesem Geld selbst vorgehn, denn als Kaufmittel und als Zahlungsmittel realisirt es nur den Preis der Waare, die es kauft oder zahlt, während es, in seiner eignen Form verharrend, zum Petrefakt von gleichbleibender Werthgrösse erstarrt(FN 39). Eben so wenig
kann die Veränderung aus dem zweiten Akt, dem Wiederverkauf der Waare, entspringen, denn dieser Akt verwandelt die Waare blos aus der Naturalform zurück in die Geldform. Die Veränderung muss sich also zutragen mit der Waare, die im ersten Akt G — W gekauft wird, aber nicht mit ihrem Tauschwerth, denn es werden Aequivalente ausgetauscht, die Waare wird zu ihrem Werthe bezahlt. Die Veränderung kann also erst entspringen aus ihrem Gebrauchswerth als solchem, d. h. aus ihrem Verbrauch. Um aus dem Verbrauch einer Waare Tauschwerth herauszuziehn, müsste unser Geldbesitzer so glücklich sein innerhalb der Cirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Waare zu entdecken, deren Gebrauchswerth selbst die eigenthümliche Beschaffenheit besässe, Quelle von Tauschwerth zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst Vergegenständlichung von Arbeit wäre, daher Werthschöpfung. Und der Geldbesitzer findet auf dem Markt eine solche spezifische Waare vor — das Arbeitsvermögen oder die Arbeitskraft.
Unter Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehn wir den Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existiren und die er in Bewegung setzt, so oft er Gebrauchswerthe irgend einer Art producirt.
Damit jedoch der Geldbesitzer die Arbeitskraft als Waare auf dem Markt vorfinde, müssen verschiedne Bedingungen erfüllt sein. Der Waarenaustausch schliesst an und für sich keine andern Abhängigkeitsverhältnisse ein als die aus seiner eignen Natur entspringenden. Unter dieser Voraussetzung kann die Arbeitskraft als Waare nur auf dem Markt erscheinen, sofern und weil sie von ihrem eignen Besitzer, der Person, deren Arbeitskraft sie ist, als Waare feilgeboten oder verkauft wird. Damit ihr Besitzer sie als Waare verkaufe, muss er über sie verfügen können, also freier Eigenthümer seines Arbeitsvermögens, seiner Person sein(FN 40). Er und der Geldbesitzer begegnen sich auf dem Markt und treten in Verhältniss zu einander als ebenbürtige Waaren
besitzer, nur dadurch unterschieden, dass der eine Käufer, der andere Verkäufer, beide also juristisch gleiche Personen sind. Die Fortdauer dieses Verhältnisses erheischt, dass der Eigenthümer der Arbeitskraft sie stets nur für bestimmte Zeit verkaufe, denn verkauft er sie in Bausch und Bogen, ein für allemal, so verkauft er sich selbst, verwandelt sich aus einem Freien in einen Sklaven, aus einem Waarenbesitzer in eine Waare. Er als Person muss sich beständig zu seiner Arbeitskraft als seinem Eigenthum und daher seiner eignen Waare verhalten und das kann er nur, so weit er sie dem Käufer stets nur vorübergehend, für einen bestimmten Zeittermin, zur Verfügung stellt, zum Verbrauch überlässt, also durch ihre Veräusserung nicht auf sein Eigenthum an ihr verzichtet(FN 41).
Die zweite wesentliche Bedingung, damit der Geldbesitzer die Arbeitskraft auf dem Markt als Waare vorfinde, ist die, dass ihr Besitzer, statt Waaren verkaufen zu können, worin sich seine Arbeit vergegenständlicht hat, vielmehr seine Arbeitskraft selbst, die nur in seiner lebendigen Leiblichkeit existirt, als Waare feilbieten muss.
Damit Jemand von seiner Arbeitskraft unterschiedne Waaren verkaufe, muss er natürlich Produktionsmittel besitzen, z. B. Rohstoffe, Arbeitsinstrumente u. s. w. Er kann keine Stiefel machen ohne Leder. Er bedarf ausserdem Lebensmittel. Niemand kann von Produkten der Zukunft zehren, also auch nicht von Gebrauchswerthen, mit deren Produktion er noch nicht fertig, und wie am ersten Tag seiner Erscheinung auf der Weltbühne muss der Mensch noch jeden Tag konsumiren, bevor und während er produzirt. Werden die Produkte als Waaren produzirt, so müssen sie verkauft werden, nachdem sie produzirt sind und können die Bedürfnisse des Produzenten erst nach dem Verkauf befriedigen. Zur Produktionszeit kömmt die für den Verkauf nöthige Zeit hinzu.
Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Waarenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Waare verfügt, dass er andrerseits andre Waaren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nöthigen Sachen.
Die Frage, warum dieser freie Arbeiter ihm in der Cirkulationssphäre gegenübertritt, interessirt den Geldbesitzer nicht, der den Arbeitsmarkt als eine besondre Abtheilung des Waarenmarkts vorfindet. Und einstweilen interessirt sie uns eben so wenig. Wir halten uns theoretisch an die Thatsache, wie der Geldbesitzer praktisch. Eins jedoch ist klar. Die Natur produzirt nicht auf der einen Seite Geldoder Waarenbesitzer und auf der andern blosse Besitzer der eignen Arbeitskräfte. Diess Verhältniss ist kein naturgeschichtliches und eben so wenig ein gesellschaftliches, das allen Geschichtsperioden gemein wäre. Es ist offenbar selbst das Resultat einer vorhergegangnen historischen Entwicklung, das Produkt vieler ökonomischer Umwälzungen, des Untergangs einer ganzen Reihe älterer Formationen der gesellschaftlichen Produktion.
Auch die ökonomischen Kategorieen, die wir früher betrachtet, tragen ihre geschichtliche Spur. Im Dasein des Produkts als Waare sind bestimmte historische Bedingungen eingehüllt. Um Waare zu werden, darf das Produkt nicht als unmittelbares Subsistenzmittel für den Produzenten selbst produzirt werden. Hätten wir weiter geforscht:
Unter welchen Umständen nehmen alle oder nimmt auch nur die Mehrzahl der Produkte die Form der Waare an, so hätte sich gefunden, dass diess nur auf Grundlage einer ganz spezifischen, der kapitalistischen Produktionsweise, geschieht. Eine solche Untersuchung lag jedoch der Analyse der Waare fern. Waarenproduktion und Waarencirkulation können stattfinden, obgleich die weit überwiegende Produktenmasse, unmittelbar auf den Selbstbedarf gerichtet, sich nicht in Waare verwandelt, der gesellschaftliche Produktionsprozess also noch lange nicht in seiner ganzen Breite und Tiefe vom Tauschwerth beherrscht ist. Die Darstellung des Produkts als Waare bedingt eine so weit entwickelte Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft, dass die Scheidung zwischen Gebrauchswerth und Tauschwerth, die im unmittelbaren Tauschhandel erst beginnt, bereits vollzogen ist. Eine solche Entwicklungsstufe ist aber den geschichtlich verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen gemein.
Oder betrachten wir das Geld, so setzt es eine gewisse Höhe der Waarencirkulation voraus. Die besondern Geldformen, blosses Waarenäquivalent, oder Cirkulationsmittel, oder Zahlungsmittel, Schatz und Weltgeld, deuten, je nach dem verschiednen Umfang und dem relativen Vorwiegen einer oder der andern Funktion, auf sehr verschiedne Stufen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses. Dennoch genügt erfahrungsmässig eine relativ schwach entwickelte Waarencirkulation zur Bildung aller dieser Formen. Anders mit dem Kapital. Seine historischen Existenzbedingungen sind durchaus nicht da mit der Waarenund Geldcirkulation. Es entsteht nur, wo der Besitzer von Produktionsund Lebensmitteln den freien Arbeiter als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf dem Markt vorfindet, und diese eine historische Bedingung umschliesst eine Weltgeschichte. Das Kapital kündigt sich daher von vorn herein als eine Epoche des gesellschaftlichen Produktionsprozesses an.
Diese eigenthümliche Waare, die Arbeitskraft, ist nun näher zu betrachten. Gleich allen andern Waaren besitzt sie einen Tauschwerth(FN 42). Wie wird er bestimmt?
Der Werth der Arbeitskraft, gleich dem jeder andern Waare, ist bestimmt durch die zur Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels nothwendige Arbeitszeit. Soweit sie Tauschwerth, repräsentirt die Arbeitskraft selbst nur ein bestimmtes Quantum in ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit. Die Arbeitskraft existirt nur als Anlage des lebendigen Individuums. Ihre Produktion setzt also seine Existenz voraus. Diese gegeben, besteht ihre Produktion in seiner Reproduktion oder Erhaltung. Zu seiner Erhaltung bedarf das lebendige Individuum einer gewissen Summe von Lebensmitteln. Die zur Produktion der Arbeitskraft nothwendige Arbeitszeit löst sich also auf in die zur Produktion dieser Lebensmittel nothwendige Arbeitszeit, oder der Werth der Arbeitskraft ist der Werth der zur Erhaltung ihres Besitzers nothwendigen Lebensmittel. Die Arbeitskraft verwirklicht sich jedoch nur durch ihre Aeusserung, bethätigt sich nur in der Arbeit. Durch ihre Bethätigung, die Arbeit, wird aber ein bestimmtes Quantum von menschlichem Muskel, Nerv, Hirn u. s. w. verausgabt, das wieder ersetzt werden muss. Diese vermehrte Ausgabe bedingt eine vermehrte Einnahme(FN 43). Wenn der Eigenthümer der Arbeitskraft heute gearbeitet hat, muss er denselben Prozess morgen unter denselben Bedingungen von Kraft und Gesundheit wiederholen können. Die Summe der Lebensmittel muss also hinreichen, das arbeitende Individuum als arbeitendes Individuum in seinem normalen Lebenszustand zu erhalten. Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung u. s. w. sind verschieden je nach den klimatischen und andern natürlichen Eigenthümlichkeiten eines Landes. Andrerseits ist der Umfang s. g. nothwendiger Lebensmittel, wie die Art ihrer Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher grossentheils von der Kulturstufe eines Landes, unter anderm auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, und daher mit welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat(FN 44). Im Gegensatz zu den andern Waaren enthält also die Werth-
bestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element. Für ein bestimmtes Land, zu einer bestimmten Periode jedoch, ist der Durchschnitts-Umkreis der nothwendigen Lebensmittel gegeben.
Der Eigenthümer der Arbeitskraft ist sterblich. Soll also seine Erscheinung auf dem Markt eine kontinuirliche sein, wie die kontinuirliche Verwandlung von Geld in Kapital voraussetzt, so muss der Verkäufer der Arbeitskraft sich verewigen, „wie jedes lebendige Individuum sich verewigt, durch Fortpflanzung(FN 45).“ Die durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogenen Arbeitskräfte müssen zum allermindesten durch eine gleiche Zahl neuer Arbeitskräfte beständig ersetzt werden. Die Summe der zur Produktion der Arbeitskraft nothwendigen Lebensmittel schliesst also die Lebensmittel der Ersatzmänner ein, d. h. der Kinder der Arbeiter, so dass sich diese Race eigenthümlicher Waarenbesitzer auf dem Waarenmarkt verewigt(FN 46).
Um die allgemein menschliche Natur so zu modificiren, dass sie Geschick und Fertigkeit in einem bestimmten Arbeitszweig erlangt, entwickelte und spezifische Arbeitskraft wird, bedarf es einer bestimmten Bildung oder Erziehung, welche ihrerseits eine grössere oder geringere Summe von Waarenäquivalenten kostet. Je nach dem mehr oder minder vermittelten Charakter der Arbeitskraft, sind ihre Bildungskosten verschieden. Diese Erlernungskosten, verschwindend klein für die gewöhnliche Arbeitskraft, gehn also ein in den Umkreis der zu ihrer Produktion nothwendigen Waaren.
Der Werth der Arbeitskraft löst sich auf in den Werth einer bestimmten Summe von Lebensmitteln. Er wechselt daher auch mit dem Werth dieser Lebensmittel, d. h. der Grösse der zu ihrer Produktion erheischten Arbeitszeit.
Ein Theil der Lebensmittel, z. B. Nahrungsmittel, Heizungsmittel u. s. w., werden täglich neu verzehrt, und müssen täglich neu ersetzt
werden. Andere Lebensmittel, wie Kleider, Möbel u. s. w., verbrauchen sich in längeren Zeiträumen, und sind daher nur in längeren Zeiträumen zu ersetzen. Waaren einer Art müssen täglich, andere wöchentlich, vierteljährlich u. s. f. gekauft oder gezahlt werden. Wie sich die Summe dieser Ausgaben aber immer während eines Jahres z. B. vertheilen möge, sie muss gedeckt sein durch die Durchschnittseinnahme, Tag ein, Tag aus. Wäre die Masse der täglich zur Produktion der Arbeitskraft erheischten Waaren = A, die der wöchentlich erheischten = B, die der vierteljährlich erheischten = C u. s. w., so wäre der tägliche Durchschnitt dieser Waaren u. s. w. Gesetzt in dieser für den Durchschnitts-Tag nöthigen Waarenmasse steckten 6 Stunden gesellschaftlicher Arbeit, so vergegenständlicht sich in der Arbeitskraft täglich ein halber Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit, oder ein halber Arbeitstag ist zur täglichen Produktion der Arbeitskraft erheischt. Diess zu ihrer täglichen Produktion erheischte Arbeitsquantum bildet den Tageswerth der Arbeitskraft, oder den Werth der täglich reproduzirten Arbeitskraft. Wenn sich ein halber Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit ebenfalls in einer Goldmasse von 3 sh. oder einem Thaler darstellt, so ist Ein Thaler der dem Tageswerth der Arbeitskraft entsprechende Preis. Bietet der Besitzer der Arbeitskraft sie feil für Einen Thaler täglich, so ist ihr Verkaufspreis gleich ihrem Werth, und, nach unsrer Voraussetzung, zahlt der auf Verwandlung seiner Thaler in Kapital erpichte Geldbesitzer diesen Werth.
Die letzte Grenze oder Minimalgrenze des Werths der Arbeitskraft wird gebildet durch den Werth einer Waarenmasse, ohne deren tägliche Zufuhr der Träger der Arbeitskraft, der Mensch, seinen Lebensprozess nicht erneuern kann, also durch den Werth der physisch unentbehrlichen Lebensmittel. Sinkt der Preis der Arbeitskraft auf diess Minimum, so sinkt er unter ihren Werth, denn sie kann so nur in verkümmerter Form erhalten werden und sich entwickeln. Der Tauschwerth jeder Waare ist aber bestimmt durch die Arbeitszeit, erfordert um sie in normaler Güte zu liefern.
Es ist eine ausserordentlich wohlfeile Sentimentalität, diese aus der Natur der Sache fliessende Werthbestimmung der Arbeitskraft grob
zu finden und etwa mit Rossi zu jammern: „Das Arbeitsvermögen (puissance de travail) begreifen, während man von den Subsistenzmitteln der Arbeit während des Produktionsprozesses abstrahirt, heisst ein Hirngespinnst (être de raison) begreifen. Wer Arbeit sagt, wer Arbeitsvermögen sagt, sagt zugleich Arbeiter und Subsistenzmittel, Arbeiter und Arbeitslohn(FN 47).“ Wer Arbeitsvermögen sagt, sagt nicht Arbeit, so wenig als wer Verdauungsvermögen sagt, Verdauen sagt. Zum letztern Prozess ist bekanntlich mehr als ein guter Magen erfordert. Wer Arbeitsvermögen sagt, abstrahirt nicht von den zu seiner Subsistenz nothwendigen Lebensmitteln. Ihr Werth ist vielmehr ausgedrückt in seinem Werth. Wird es nicht verkauft, so nützt es dem Arbeiter nichts, so empfindet er es vielmehr als eine grausame Naturnothwendigkeit, dass sein Arbeitsvermögen ein bestimmtes Quantum Subsistenzmittel zu seiner Produktion erheischt hat und stets wieder von neuem zu seiner Reproduktion erheischt. Er entdeckt dann mit Sismondi: „das Arbeitsvermögen . . . . ist Nichts, wenn es nicht verkauft wird(FN 48).“
Die eigenthümliche Natur dieser spezifischen Waare, der Arbeitskraft, bringt es mit sich, dass mit der Abschliessung des Kontrakts zwischen Käufer und Verkäufer ihr Gebrauchswerth noch nicht wirklich in die Hand des Käufers übergegangen ist. Ihr Tauschwerth, gleich dem jeder andern Waare, war bestimmt, bevor sie in die Cirkulation trat, denn ein bestimmtes Quantum gesellschaftlicher Arbeit ward zur Produktion der Arbeitskraft verausgabt, aber ihr Gebrauchswerth besteht erst in der nachträglichen Kraftäusserung. Die Veräusserung der Kraft und ihre wirkliche Aeusserung, d. h. ihr Dasein als Gebrauchswerth, fallen daher der Zeit nach aus einander. Bei solchen Waaren aber, wo die formelle Veräusserung des Gebrauchswerths durch den Verkauf und seine wirkliche Ueberlassung an den Käufer der Zeit nach auseinander fallen, funktionirt das Geld des Käufers meist als Zahlungsmittel. In allen Ländern kapitalistischer Produktionsweise wird die Arbeitskraft erst gezahlt, nachdem sie bereits während des im Kaufkontrakt festgesetzten Termins funktionirt hat, z. B. am Ende jeder Woche(FN 49). Ueberall schiesst daher der
Arbeiter dem Kapitalisten den Gebrauchswerth der Arbeitskraft vor; er lässt sie vom Käufer konsumiren, bevor er ihren Preis bezahlt erhält, überall kreditirt daher der Arbeiter dem Kapitalisten. Dass diess Kreditiren kein leerer Wahn ist, zeigt nicht nur der gelegentliche Verlust des kreditirten Salairs beim Bankerott des Kapitalisten(FN 50), sondern auch eine Reihe mehr nachhaltiger Wirkungen(FN 51). Indess ändert es an der Natur des
Waarenaustauschs selbst nichts, ob das Geld als Kaufmittel oder als Zahlungsmittel funktionirt. Der Preis der Arbeitskraft ist kontraktlich festgesetzt, obgleich er erst hinterher realisirt wird, wie der Miethpreis eines Hauses. Die Arbeitskraft ist verkauft, obgleich sie erst hinterher bezahlt wird. Für die reine Auffassung des Verhältnisses wird es daher nützlich sein, einstweilen stets vorauszusetzen, dass der Besitzer der Arbeitskraft mit ihrem Verkauf jedesmal auch sogleich den kontraktlich stipulirten Preis erhält.
Wir kennen nun die Art und Weise der Bestimmung des Tauschwerths, der dem Besitzer dieser eigenthümlichen Waare, der Arbeitskraft, vom Geldbesitzer gezahlt wird. Der Gebrauchswerth, den letzterer seinerseits im Austausch erhält, zeigt sich erst im wirklichen Verbrauch, im Konsumtionsprozess der Arbeitskraft. Alle zu diesem Prozess nöthigen Dinge, wie Rohmaterial u. s. w., kauft der Geldbesitzer auf dem Waarenmarkt und zahlt sie zum vollen Preis. Der Konsumtionsprozess der Arbeitskraft ist zugleich der Produktionsprozess von Waare und von Mehrwerth. Die Kon-
sumtion der Arbeitskraft, gleich der Konsumtion jeder andern Waare, vollzieht sich ausserhalb des Markts oder der Cirkulationssphäre. Diese geräuschvolle, auf der Oberfläche hausende und Aller Augen zugängliche Sphäre verlassen wir daher, zusammen mit Geldbesitzer und Besitzer der Arbeitskraft, um beiden nachzufolgen in die verborgne Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: No admittance except on business. Hier wird sich zeigen, nicht nur wie das Kapital producirt, sondern auch wie das Kapital selbst producirt wird. Das Geheimniss der Plusmacherei muss sich endlich enthüllen.
Die Sphäre der Cirkulation oder des Waarenaustauschs, innerhalb deren Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, war in der That ein wahres Eden der angebornen Menschenrechte. Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigenthum, und Bentham. Freiheit! denn Käufer und Verkäufer einer Waare, z. B. der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen bestimmt. Sie kontrahiren als freie, rechtlich ebenbürtige Personen. Der Kontrakt ist das freie Produkt, worin sich ihre Willen einen gemeinsamen Rechtsausdruck geben. Gleichheit! Denn sie beziehen sich nur als Waarenbesitzer auf einander und tauschen Aequivalent für Aequivalent. Eigenthum! Denn jeder verfügt nur über das Seine. Bentham! Denn jedem von den beiden ist es nur um sich zu thun. Die einzige Macht, die sie zusammen und in ein Verhältniss bringt, ist die ihres Eigennutzes, ihres Sondervortheils, ihrer Privatinteressen. Und eben weil so jeder nur für sich und keiner für den andern kehrt, vollbringen alle, in Folge einer prästabilirten Harmonie der Dinge, oder unter den Auspicien einer allpfiffigen Vorsehung, nur das Werk ihres wechselseitigen Vortheils, des Gemeinnutzens, des Gesammtinteresses.
Beim Scheiden von dieser Sphäre der einfachen Cirkulation oder des Waarenaustauschs, woraus der Freihändler vulgaris Anschauungen, Begriffe und Massstab für sein Urtheil über die Gesellschaft des Kapitals und der Lohnarbeit entlehnt, verwandelt sich, so scheint es, schon in etwas die Physiognomie unserer dramatis personae. Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraft-Besitzer folgt ihm nach als sein Arbeiter; der Eine bedeutungsvoll schmunzelnd und ge-
schäftseifrig, der Andre scheu, widerstrebsam, wie Jemand, der seine eigne Haut zu Markt getragen und nun nichts andres zu erwarten hat als die — Gerberei.
Drittes Kapitel. Die Produktion des absoluten Mehrwerths.↑
1) Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess.↑Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst. Der Käufer der Arbeitskraft konsumirt sie, indem er ihren Verkäufer arbeiten lässt. Letztrer wird hierdurch actu sich bethätigende Arbeitskraft, Arbeiter, was er früher nur potentia war. Um seine Arbeit in Waaren darzustellen, muss er sie vor allem in Gebrauchswerthen darstellen, Sachen, die zur Befriedigung von Bedürfnissen irgend einer Art dienen. Es ist also ein besondrer Gebrauchswerth, ein bestimmter Artikel, den der Kapitalist vom Arbeiter anfertigen lässt. Die Produktion von Gebrauchswerthen, oder Gütern, ändert ihre allgemeine Natur nicht dadurch, dass sie für den Kapitalisten und unter seiner Kontrole vorgeht. Der Arbeitsprozess ist daher zunächst in seinen abstrakten Momenten, unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form zu betrachten.
Der Arbeitsprozess ist zunächst ein Prozess zwischen dem Menschen und der Natur, ein Prozess, worin er seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne That vermittelt, regelt und kontrolirt. Der Mensch tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eignes Leben brauchbaren Form zu assimiliren. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur ausser ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigne Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eignen Botmässigkeit. Wir haben es hier nicht mit den ersten thierartig instinktmässigen Formen des Arbeitsprozesses zu
thun. Dem Zustand, worin der Arbeiter als Verkäufer seiner eignen Arbeitskraft auf dem Waarenmarkt auftritt, ist in urzeitlichen Hintergrund der Zustand entrückt, worin der menschliche Arbeitsprozess seine erste instinktartige Form noch nicht abgestreift hatte. Wir unterstellen den Arbeitsprozess in einer Form, worin er dem Menschen ausschliesslich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vorn herein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt, verwirklicht er im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiss, der die Art und Weise seines Thuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Ausser der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckgemässe Wille, der sich als Aufmerksamkeit äussert, für die ganze Dauer des Arbeitsprozesses erheischt, und um so mehr, je weniger die Arbeit durch ihren eignen Inhalt und ihre Art und Weise der Ausführung den Arbeiter mit sich fortreisst, je weniger er sie daher als Spiel seiner eignen körperlichen und geistigen Kräfte geniesst.
Die einfachen Momente des Arbeitsprozesses sind die zweckmässige Thätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel.
Die Erde (worunter ökonomisch auch das Wasser einbegriffen), wie sie den Menschen ursprünglich mit Proviant, fertigen Lebensmitteln ausrüstet(FN 1), findet sich ohne sein Zuthun als der allgemeine Gegenstand der menschlichen Arbeit vor. Alle Dinge, welche die Arbeit nur von ihrem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Erdganzen loslöst, sind
von Natur vorgefundne Arbeitsgegenstände. So der Fisch, der von seinem Lebenselement, dem Wasser, getrennt, gefangen wird, das Holz, das im Urwald gefällt, das Erz, das aus seiner Ader losgebrochen wird. Ist der Arbeitsgegenstand dagegen selbst schon sozusagen durch frühere Arbeit filtrirt, so nennen wir ihn Rohmaterial. Z. B. das bereits losgebrochene Erz, das nun ausgewaschen wird. Alles Rohmaterial ist Arbeitsgegenstand, aber nicht jeder Arbeitsgegenstand ist Rohmaterial. Rohmaterial ist der Arbeitsgegenstand nur, sobald er bereits eine durch Arbeit vermittelte Veränderung erfahren hat.
Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Thätigkeit auf diesen Gegenstand dienen. Er benutzt die mechanischen, physischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andre Dinge, seinem Zweck gemäss, wirken zu lassen(FN 2). Der Gegenstand, dessen sich der Arbeiter unmittelbar bemächtigt — abgesehn von der Ergreifung fertiger Lebensmittel, der Früchte z. B., wobei seine eigenen Leibesorgane allein als Arbeitsmittel dienen — ist nicht der Arbeitsgegenstand, sondern das Arbeitsmittel. So wird das Natürliche selbst zum Organ seiner Thätigkeit, ein Organ, das er seinen eigenen Leibesorganen hinzufügt, seine natürliche Gestalt verlängernd, trotz der Bibel. Wie die Erde seine ursprüngliche Proviantkammer, ist sie sein ursprüngliches Arsenal von Arbeitsmitteln. Sie liefert ihm z. B. den Stein, womit er wirft, reibt, drückt, schneidet u. s. w. Die Erde selbst ist ein Arbeitsmittel, setzt jedoch zu ihrem Dienst als Arbeitsmittel in der Agrikultur wieder eine ganze Reihe andrer Arbeitsmittel und eine schon relativ hohe Entwicklung der Arbeitskraft voraus(FN 3). Sobald überhaupt der Arbeitsprozess nur
einigermassen entwickelt ist, bedarf er bereits bearbeiteter Arbeitsmittel. In den ältesten Menschenhöhlen finden wir Steinwerkzeuge und Steinwaffen. Neben bearbeitetem Stein und Holz spielt im Anfang der Menschengeschichte das gezähmte, also selbst schon durch Arbeit veränderte, gezüchtete Thier die Hauptrolle als Arbeitsmittel(FN 4). Der Gebrauch und die Schöpfung von Arbeitsmitteln, obgleich im Keim schon gewissen Thierarten eigen, charakterisiren den spezifisch menschlichen Arbeitsprozess und Franklin definirt daher den Menschen als „ a toolmaking animal“, ein Werkzeuge fabrizirendes Thier. Dieselbe Wichtigkeit, die der Bau von Knochenreliquien für die Erkenntniss der Organisation untergegangner Thiergeschlechter, haben Reliquien von Arbeitsmitteln für die Beurtheilung untergegangner ökonomischer Gesellschaftsformationen. Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeitsmitteln gemacht wird, unterscheidet die ökonomischen Epochen(FN 5). Die Arbeitsmittel sind nicht nur der Gradmesser der Entwicklung der menschlichen Arbeitskraft, sondern auch der Index der gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen gearbeitet wird. Unter den Arbeitsmitteln selbst bieten die mechanischen Arbeitsmittel, deren Gesammtheit man das Knochenund Muskelsystem der Produktion nennen kann, viel entscheidendere Charaktermerkmale einer gesellschaftlichen Produktionsepoche, als solche Arbeitsmittel, die nur zu Behältern des Arbeitsgegenstands dienen, und deren Gesammtheit ganz allgemein als das Gefässsystem der Produktion bezeichnet werden kann, wie z. B. Röhren, Fässer, Körbe, Krüge u. s. w. Erst in der chemischen Fabrikation spielen sie eine bedeutungsvolle Rolle.
Im weiteren Sinn zählt der Arbeitsprozess unter seine Mittel ausser den Dingen, welche die Wirkung der Arbeit auf ihren Gegenstand vermitteln, und daher in einer oder der andern Weise als Leiter der Thätigkeit dienen, alle gegenständlichen Bedingungen, die überhaupt erheischt sind, damit der ganze Prozess vorgehe. Sie gehn nicht direkt in den Arbeitsprozess ein, aber der Arbeitsprozess kann ohne sie gar nicht
oder nur unvollkommen vorgehn. Das allgemeine Arbeitsmittel dieser Art ist wieder die Erde selbst, denn sie giebt dem Arbeiter den locus standi und seinem Prozess den Wirkungsraum ( field of employment). Durch die Arbeit schon vermittelte Arbeitsmittel dieser Art sind z. B. Arbeitsgebäude, Kanäle, Strassen u. s. w.
Der Arbeitsprozess ist also ein Prozess, worin die Thätigkeit des Menschen durch das Arbeitsmittel eine von vorn herein bezweckte Veränderung im Arbeitsgegenstand bewirkt. Dieser Prozess erlischt im Produkt. Sein Produkt ist ein Gebrauchswerth, ein durch Formveränderung menschlichen Bedürfnissen assimilirter Naturstoff. Durch den Prozess hat sich die Arbeit mit ihrem Gegenstand verbunden. Die Arbeit ist vergegenständlicht und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf Seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft, in der Form des Seins, auf Seiten des Produkts. Er hat gesponnen und das Produkt ist ein Gespinnst.
Betrachtet man den ganzen Prozess vom Standpunkt seines Resultats, des Produkts, so erscheinen beide, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, als Produktionsmittel(FN 6) und die Arbeit selbst als produktive Arbeit(FN 7).
Wenn ein Gebrauchswerth als Produkt aus dem Arbeitsprozess herauskommt, gehn andre Gebrauchswerthe, selbst Produkte früherer Arbeitsprozesse, als Produktionsmittel in den Prozess ein. Derselbe Gebrauchswerth, der das Produkt eines Arbeitsprozesses, bildet das Produktionsmittel eines andern. Produkte sind daher nicht nur Resultat, sondern zugleich Bedingung des Arbeitsprozesses.
Mit Ausnahme der extraktiven Industrie, die ihren Arbeitsgegenstand von Natur vorfindet, wie der Bergbau, die Jagd, der Fischfang u. s. w., (der Ackerbau nur, soweit er in erster Instanz die jungfräuliche Erde selbst aufbricht), behandeln alle Industriezweige einen Gegenstand, der Rohmaterial, d. h. bereits durch die Arbeit filtrirter
Arbeitsgegenstand, selbst schon Produkt eines früheren Arbeitsprozesses ist. So z. B. der Samen in der Agrikultur. Thiere und Pflanzen, die man als Naturprodukte zu betrachten pflegt, sind nicht nur Produkte vielleicht der Arbeit vom vorigen Jahr, sondern, in ihren jetzigen Formen, Produkte einer durch viele Generationen, unter menschlicher Kontrole, vermittelst menschlicher Arbeit, fortgesetzten Umwandlung. Was aber die Arbeitsmittel insbesondere betrifft, so zeigt ihre ungeheure Mehrzahl dem oberflächlichsten Blick die Spur vergangner Arbeit.
Das Rohmaterial kann die Hauptsubstanz eines Produkts bilden, oder nur als Hilfsstoff in seine Bildung eingehn. Der Hilfsstoff wird vom Arbeitsmittel konsumirt, wie Kohle von einer Dampfmaschine, Oel vom Rade, Heu von einem Zugpferd, oder dem Rohmaterial zugesetzt, um eine stoffliche Veränderung darin zu bewirken, wie Chlor zur ungebleichten Leinwand, Kohle zum Eisen, Farbe zur Wolle, oder er unterstützt die Verrichtung der Arbeit selbst, wie z. B. zur Beleuchtung und Heizung des Arbeitslokals verwandte Stoffe. Der Unterschied zwischen Hauptstoff und Hilfsstoff verschwimmt in der eigentlich chemischen Fabrikation, weil keines der angewandten Rohmaterialien als die Substanz des Produkts wieder erscheint(FN 8).
Da jedes Ding vielerlei Eigenschaften besitzt und daher verschiedner Nutzanwendung fähig ist, kann dasselbe Produkt das Rohmaterial sehr verschiedner Arbeitsprozesse bilden. Korn z. B. ist Rohmaterial für Müller, Stärkefabrikant, Destillateur, Viehzüchter u. s. w. Es wird Rohmaterial seiner eignen Produktion als Samen. So geht die Kohle als Produkt aus der Minenindustrie hervor und als Produktionsmittel in sie ein.
Dasselbe Produkt mag in demselben Arbeitsprozess als Arbeitsmittel und Rohmaterial dienen. Bei der Viehmast z. B., wo das Vieh, das bearbeitete Rohmaterial, zugleich Mittel der Düngerbereitung ist.
Ein Produkt kann in einer für die Konsumtion fertigen Form existiren und dennoch von neuem zum Rohmaterial eines andern Produkts werden, wie die Traube zum Rohmaterial des Weins. Oder der Arbeitsprozess entlässt sein Produkt in Formen, worin es nur als Rohmaterial
eines nachfolgenden Arbeitsprozesses benutzt werden kann. Rohmaterial in diesem Zustand heisst Halbfabrikat und hiesse besser Stufenfabrikat, wie z. B. Baumwolle, Faden, Garn u. s. w. Obgleich selbst schon Produkt, mag das ursprüngliche Rohmaterial eine ganze Staffel verschiedner Arbeitsprozesse zu durchlaufen haben, worin es in stets veränderter Gestalt stets von neuem als Rohmaterial funktionirt bis zum letzten Arbeitsprozess, der es als fertiges Lebensmittel oder fertiges Arbeitsmittel von sich abstösst.
Man sieht: ob ein Gebrauchswerth als Rohmaterial, Arbeitsmittel oder Produkt erscheint, hängt ganz und gar ab von seiner bestimmten Funktion im Arbeitsprozesse, von der Stelle, die er in ihm einnimmt, und mit dem Wechsel dieser Stelle wechseln jene Bestimmungen.
Durch ihren Eintritt als Produktionsmittel in neue Arbeitsprozesse verlieren Produkte daher den Charakter des Produkts. Sie funktioniren nur noch als gegenständliche Faktoren der lebendigen Arbeit. Der Spinner bezieht sich auf die Spindel nur als Mittel, womit, und auf den Flachs nur als Gegenstand, den er spinnt. Allerdings kann man nicht spinnen ohne Spinnmaterial und Spindel. Das Vorhandensein dieser Produkte ist daher vorausgesetzt beim Beginn des wirklichen Spinnprozesses. In diesem Prozess selbst aber ist es eben so gleichgültig, dass Flachs und Spindel Produkte vergangner Arbeit sind, wie es im wirklichen Ernährungsprozess gleichgültig ist, dass Brod das Produkt der vergangnen Arbeiten von Bauer, Müller, Bäcker u. s. w. Umgekehrt. Machen Produktionsmittel im Arbeitsprozess ihren Charakter als Produkte vergangner Arbeit geltend, so durch ihre Mängel. Ein Messer, das nicht schneidet, Garn, das beständig zerreisst u. s. w., erinnern lebhaft an Messerschmied A und Garnwichser E. Im gelungenen Produkt ist die Vermittlung seiner Gebrauchseigenschaften durch vergangne Arbeit ausgelöscht.
Eine Maschine, die nicht im Arbeitsprozess dient, ist nutzlos. Ausserdem verfällt sie der zerstörenden Gewalt des natürlichen Stoffwechsels. Das Eisen verrostet, das Holz verfault. Garn, das nicht verwebt oder verstrickt wird, ist verdorbene Baumwolle. Die lebendige Arbeit muss diese Dinge ergreifen, sie von den Todten erwecken, sie aus nur möglichen in wirkliche und wirkende Gebrauchswerthe verwandeln. Vom Feuer der
Arbeit beleckt, als Leiber derselben angeeignet, zu ihren begriffs und berufsmässigen Funktionen im Prozess begeistet, werden sie zwar auch verzehrt, aber zweckvoll, als Bildungselemente neuer Gebrauchswerthe.
Wenn vorhandne Produkte nicht nur die Resultate, sondern auch die Existenzbedingungen des Arbeitsprozesses sind, ist andrerseits ihr Hineinwerfen in den Arbeitsprozess, also ihr Kontakt mit lebendiger Arbeit, das einzige Mittel um diese Produkte vergangner Arbeit als Gebrauchswerthe zu erhalten und zu verwirklichen. Der Arbeitsprozess resultirt überhaupt nur in Gebrauchswerth, so weit sein Produkt fähig, als Lebensmittel in die individuelle Konsumtion oder als Produktionsmittel in neuen Arbeitsprozess einzugehn.
Im Arbeitsprozess werden seine stofflichen Elemente, sein Gegenstand und sein Mittel, als Gebrauchswerthe verbraucht. Die Arbeit verspeist sie. Der Arbeitsprozess ist also Konsumtionsprozess. Es unterscheidet diese produktive Konsumtion von der individuellen Konsumtion, dass letztere die Produkte als Lebensmittel des lebendigen Individuums, jene sie als Lebensmittel der Arbeit, der sich bethätigenden Arbeitskraft, verzehrt. Das Produkt der individuellen Konsumtion ist daher der Konsument selbst, das Resultat der produktiven Konsumtion ein von dem Konsumenten unterschiednes Produkt.
Sofern Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand selbst schon Produkte sind, Resultate vergangner Arbeitsprozesse, ist der Arbeitsprozess ein Prozess, worin Produkte verzehrt werden um Produkte zu schaffen oder worin Produkte als Produktionsmittel von Produkten dienen. Wie der Arbeitsprozess aber ursprünglich nur zwischen dem Menschen und der ohne sein Zuthun vorhandenen Erde vorgeht, dienen in ihm immer noch solche Produktionsmittel, die von Natur vorhanden, keine Verbindung von Naturstoff und menschlicher Arbeit darstellen.
Der Arbeitsprozess, wie wir ihn in seinen einfachen und abstrakten Momenten dargestellt haben, ist zweckmässige Thätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerthen, Aneignung des Natürlichen für menschliche Bedürfnisse, allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und daher
unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen seinen Gesellschaftsformen gleich gemeinsam. Wir hatten daher bei unsrer Darstellung nicht nöthig, den Arbeiter im Verhältniss zu andern Arbeitern darzustellen. Der Mensch und seine Arbeit auf der einen, die Natur und ihre Stoffe auf der andern Seite, genügten. So wenig man dem Weizen anschmeckt, wer ihn gebaut hat, so wenig sieht man diesem Prozess an, unter welchen Bedingungen er vorgeht, ob unter der brutalen Peitsche des Sklavenaufsehers oder unter dem ängstlichen Auge des Kapitalisten, ob Cincinnatus ihn verrichtet in der Bestellung seiner paar jugera, oder der Wilde, der mit einem Stein eine Bestie erlegt(FN 9).
Kehren wir zu unserem Kapitalisten in spe zurück. Wir verliessen ihn, nachdem er auf dem Waarenmarkt alle zu einem Arbeitsprozess nothwendigen Faktoren gekauft hatte, die gegenständlichen Faktoren in den Produktionsmitteln, den subjektiven Faktor in der Arbeitskraft. Die bestimmte Art dieser Produktionsmittel und dieser Arbeitskraft richtet sich nach der Art des Arbeitsprozesses, wofür sie bestimmt sind, ob Stiefel, Garn u. s. w. gemacht werden sollen. Unser Kapitalist setzt sich also daran, die von ihm gekaufte Waare, die Arbeitskraft, zu konsumiren, d. h. den Träger der Arbeitskraft, den Arbeiter die Produktionsmittel durch seine Arbeit konsumiren zu lassen. Die allgemeine Natur des Arbeitsprozesses ändert sich natürlich nicht dadurch, dass der Arbeiter ihn für den Kapitalisten, statt für sich selbst verrichtet. Aber auch die bestimmte Art und Weise wie Stiefel gemacht oder Garn gesponnen wird, kann sich zunächst nicht ändern durch die Dazwischenkunft des Kapitalisten. Er muss die Arbeitskraft zunächst nehmen, wie er sie auf dem Markt vorfindet, also auch ihre Arbeit, wie sie in einer Periode entsprang, wo es noch keine
Kapitalisten gab. Die Verwandlung der Produktionsweise selbst durch die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital kann sich erst später ereignen und ist daher erst später zu betrachten.
Der Arbeitsprozess, wie er als Konsumtionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten vorgeht, zeigt nur zwei eigenthümliche Phänomene.
Der Arbeiter arbeitet unter der Kontrole des Kapitalisten, dem seine Arbeit gehört. Der Kapitalist passt auf, dass die Arbeit ordentlich verrichtet wird und dass die Produktionsmittel zweckgemäss verwandt werden, also kein Rohmaterial vergeudet und das Arbeitsinstrument geschont, d. h. nur so weit zerstört wird, als unzertrennlich ist von seinem Gebrauch in der Arbeit.
Zweitens aber: das Produkt ist Eigenthum des Kapitalisten, nicht des unmittelbaren Produzenten, des Arbeiters. Der Kapitalist zahlt z. B. den Tageswerth der Arbeitskraft. Ihr Gebrauch, wie der jeder andern Waare, z. B. eines Pferdes, das er für einen Tag gemiethet, gehört ihm also für den Tag. Dem Käufer der Waare gehört der Gebrauch der Waare, und der Besitzer der Arbeitskraft giebt in der That nur den von ihm verkauften Gebrauchswerth, indem er seine Arbeit giebt. Von dem Augenblicke, wo er in die Werkstätte des Kapitalisten trat, gehörte der Gebrauchswerth seiner Arbeitskraft, also ihr Gebrauch, die Arbeit, dem Kapitalisten. Der Kapitalist hat durch den Kauf der Arbeitskraft die Arbeit selbst als lebendigen Gährungsstoff den todten von ihm gleichfalls besessenen Bildungselementen des Produkts einverleibt. Von seinem Standpunkt ist der Arbeitsprozess nur die Konsumtion der von ihm gekauften Waare Arbeitskraft, die er jedoch nur konsumiren kann, indem er ihr Produktionsmittel zusetzt. Der Arbeitsprozess ist ein Prozess zwischen Dingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörigen Dingen. Das Produkt dieses Prozesses gehört ihm daher ganz eben so sehr als das Produkt des Gährungsprozesses in seinem Weinkeller(FN 10).
Das Produkt — das Eigenthum des Kapitalisten — ist ein Gebrauchswerth, Garn, Stiefel u. s. w. Aber obgleich Stiefel z. B. gewissermassen die Basis des gesellschaftlichen Fortschritts bilden und unser Kapitalist ein entschiedener Fortschrittsmann ist, fabrizirt er die Stiefel nicht ihrer selbst wegen. Der Gebrauchswerth ist überhaupt nicht das Ding „ qu’on aime pour lui même“ in der Waarenproduktion. Gebrauchswerthe werden hier überhaupt nur produzirt, weil und sofern sie materielles Substrat, Träger des Tauschwerths sind. Und unserem Kapitalisten handelt es sich um zweierlei. Erstens will er einen Gebrauchswerth produziren, der einen Tauschwerth hat, einen zum Verkauf bestimmten Artikel, eine Waare. Und zweitens will er eine Waare produziren, deren Werth höher als die Werthsumme der zu ihrer Produktion erheischten Waaren, der Produktionsmittel und der Arbeitskraft, für die er sein gutes Geld auf dem Waarenmarkt vorschoss. Er will nicht nur einen Gebrauchswerth produziren, sondern eine Waare, nicht nur Gebrauchswerth, sondern Tauschwerth, und nicht nur Werth, sondern auch Mehrwerth.
In der That, da es sich hier um Waarenproduktion handelt, haben wir bisher offenbar nur eine Seite des Prozesses betrachtet. Wie die Waare selbst Einheit von Gebrauchswerth und Tauschwerth, muss ihr Produktionsprozess Einheit von Arbeitsprozess und Werthbildungsprozess sein.
Betrachten wir den Produktionsprozess also jetzt auch als Werthbildungsprozess.
Wir wissen, dass der Werth jeder Waare bestimmt ist durch das Quantum der in ihrem Gebrauchswerth materialisirten Arbeit, durch die zu ihrer Produktion gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit. Diess gilt auch für das Produkt, das sich unsrem Kapitalisten als Resultat des Arbeitsprozesses ergab. Es ist also zunächst die in diesem Produkt vergegenständlichte Arbeit zu berechnen.
Es sei z. B. Garn.
Zur Herstellung des Garns war zuerst sein Rohmaterial nöthig, z. B. 10 Pfund Baumwolle. Was der Werth der Baumwolle, ist nicht erst zu untersuchen, denn der Kapitalist hat sie auf dem Markt zu ihrem Werth, z. B. zu 10 sh. gekauft. In dem Preise der Baumwolle ist die zu ihrer Produktion erheischte Arbeit schon als allgemeine gesellschaftliche Arbeit dargestellt. Wir wollen ferner annehmen, dass die in der Verarbeitung der Baumwolle verzehrte Spindelmasse, die uns alle anderen aufgewandten Arbeitsmittel repräsentirt, einen Werth von 2 sh. besitzt. Ist eine Goldmasse von 12 sh. das Produkt von 24 Arbeitsstunden oder zwei Arbeitstagen, so folgt zunächst, dass im Garn zwei Arbeitstage vergegenständlicht sind.
Der Umstand, dass die Baumwolle ihre Form verändert hat und die aufgezehrte Spindelmasse ganz verschwunden ist, darf nicht beirren. Nach dem allgemeinen Werthgesetz sind z. B. 10 lbs. Garn ein Aequivalent für 10 lbs. Baumwolle und ¼ Spindel, wenn der Werth von 40 lbs. Garn = dem Werth von 40 lbs. Baumwolle + dem Werth einer ganzen Spindel, d. h. wenn dieselbe Arbeitszeit erfordert ist um beide Seiten dieser Gleichung zu produziren. In diesem Fall stellt sich dieselbe Arbeitszeit das einemal in dem Gebrauchswerth Garn, das andremal in den Gebrauchswerthen Baumwolle und Spindel dar. Der Tauschwerth ist also gleichgültig dagegen, ob er in Garn, Spindel oder Baumwolle erscheint. Dass Spindel und Baumwolle, statt ruhig neben einander zu liegen, im Spinnprozesse eine Verbindung eingehn, welche die Form ihres Gebrauchswerths verändert, sie in Garn verwandelt, berührt ihren Tauschwerth eben so wenig, als wenn sie durch einfachen Austausch gegen ein Aequivalent von Garn umgesetzt worden wären.
Die zur Produktion der Baumwolle erheischte Arbeitszeit ist Theil der zur Produktion des Garns, dessen Rohmaterial sie bildet, erheischten Arbeitszeit und deshalb im Garn enthalten. Ebenso verhält es sich mit der Arbeitszeit, die zur Produktion der Spindelmasse erheischt ist, ohne deren Verschleiss oder Konsum die Baumwolle nicht versponnen werden kann(FN 11).
So weit also der Werth des Garns, die zu seiner Herstellung erheischte Arbeitszeit, in Betracht kommt, können die verschiednen besondern, der Zeit und dem Raum nach getrennten Arbeitsprozesse, die durchlaufen werden müssen, um die Baumwolle zu produziren, die vernutzte Spindelmasse zu produziren, endlich aus Baumwolle und Spindel Garn zu machen, als verschiedne successive Phasen eines und desselben Arbeitsprozesses betrachtet werden. Alle im Garn enthaltne Arbeit ist vergangne Arbeit. Dass die zur Produktion seiner Bildungselemente erheischte Arbeitszeit früher vergangen war, im Plusquamperfectum steht, dagegen die zum Schlussprozess, dem Spinnen, unmittelbar verwandte Arbeit dem Präsens näher, im Perfectum steht, ist ein durchaus gleichgültiger Umstand. Ist eine bestimmte Masse Arbeit, z. B. von 30 Arbeitstagen, zum Bau eines Hauses nöthig, so ändert es nichts am Gesammtquantum der dem Hause einverleibten Arbeitszeit, dass der 30. Arbeitstag 29 Tage später in die Produktion einging als der erste Arbeitstag. Und so kann die im Arbeitsmaterial und Arbeitsmittel enthaltene Arbeitszeit ganz so betrachtet werden, als wäre sie nur in einem früheren Stadium des Spinnprozesses verausgabt worden als das zuletzt in der Form des Spinnens verausgabte Arbeitsquantum.
Die Werthe der Produktionsmittel, der Baumwolle und der Spindel, ausgedrückt in dem Preise von 12 sh., bilden also Bestandtheile des Garnwerths, oder des Werths des Produkts.
Nur müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Einmal müssen Baumwolle und Spindel wirklich zur Produktion eines Gebrauchswerths gedient haben. Es muss in unserm Fall Garn aus ihnen geworden sein.
Welcher Gebrauchswerth ihn trägt, ist dem Tauschwerth gleichgültig, aber ein Gebrauchswerth muss ihn tragen. Zweitens ist vorausgesetzt, dass nur die unter den gegebenen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen nothwendige Arbeitszeit verwandt worden ist. Wäre also nur 1 Pfund Baumwolle nöthig, um 1 Pfund Garn zu spinnen, so darf nur 1 Pfund Baumwolle verzehrt sein in der Bildung von 1 Pfund Garn. Ebenso verhält es sich mit der Spindel. Hätte der Kapitalist die Phantasie mit goldenen, statt mit eisernen Spindeln spinnen zu lassen, so zählte im Garnwerth dennoch nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit, d. h. die zur Produktion der eisernen Spindelmasse nothwendige Arbeitszeit.
Wir kennen jetzt den Werththeil, den die Produktionsmittel, Baumwolle und Spindel, im Garnwerth bilden. Er ist gleich 12 sh., oder die Materiatur von zwei Arbeitstagen. Es handelt sich also nun um den Werththeil, welchen die Arbeit des Spinners selbst der Baumwolle zusetzt.
Wir haben diese Arbeit jetzt von einem ganz anderen Gesichtspunkte zu betrachten, als während des Arbeitsprozesses. Dort handelte es sich um die zweckmässige Thätigkeit, Baumwolle in Garn zu verwandeln. Je zweckmässiger die Arbeit, desto besser das Garn, alle andern Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt. Die Arbeit des Spinners war spezifisch verschieden von andern produktiven Arbeiten, und diese Verschiedenheit offenbarte sich subjektiv und objektiv, im besondern Zweck des Spinnens, seiner besondern Operationsweise, der besondern Natur seiner Produktionsmittel, dem spezifischen Gebrauchswerth seines Produkts. Baumwolle und Spindel dienen als Lebensmittel der Spinnarbeit, aber man kann mit ihnen keine gezogenen Kanonen machen. Sofern die Arbeit des Spinners dagegen werthbildend ist, d. h. Quelle von Tauschwerth, ist sie durchaus nicht verschieden von der Arbeit des Kanonenbohrers, oder, was uns hier näher liegt, von den Arbeiten, die in den Produktionsmitteln des Garns verwirklicht sind, den Arbeiten des Baumwollpflanzers und des Spindelmachers. Nur wegen dieser Identität können Baumwollpflanzen, Spindelmachen und Spinnen blos quantitativ verschiedene Theile desselben Gesammtwerths, des Garnwerths, bilden. Es handelt sich hier nicht mehr um die Qualität, die Beschaffenheit und den Inhalt der Arbeit, sondern nur noch um ihre Quantität. Diese
ist einfach zu zählen. Wir nehmen an, dass die Spinnarbeit einfache Arbeit, gesellschaftliche Durchschnittsarbeit ist. Man wird später sehn, dass die gegentheilige Annahme nichts an der Sache ändern würde.
Während des Arbeitsprozesses setzt sich die Arbeit beständig aus der Form der Unruhe in die des Seins, aus der Form der Bewegung in die der Gegenständlichkeit um. Am Ende einer Stunde ist die Spinnbewegung in einem gewissen Quantum Garn dargestellt, also ein bestimmtes Quantum Arbeit, eine Arbeitsstunde in der Baumwolle vergegenständlicht. Wir sagen Arbeitsstunde, denn die Spinnarbeit gilt hier nur, so weit sie Verausgabung von Arbeitskraft, nicht so weit sie die spezifische Arbeit des Spinnens ist.
Es ist nun entscheidend wichtig, dass während der Dauer des Prozesses, d. h. der Verwandlung von Baumwolle in Garn, nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit verzehrt wird. Müssen unter normalen, d. h. durchschnittlichen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, a Pfund Baumwolle während einer Arbeitsstunde in b Pfund Garn verwandelt sein, so gilt nur der Arbeitstag als Arbeitstag von 12 Stunden, der 12 × a Pfund Baumwolle in 12 × b Pfund Garn verwandelt. Denn nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zählt als werthbildend.
Rohmaterial und Produkt erscheinen hier in einem ganz anderen Licht als vom Standpunkt des eigentlichen Arbeitsprozesses. Das Rohmaterial gilt hier nur als Aufsauger eines bestimmten Quantums Arbeit. Durch diese Aufsaugung verwandelt es sich in der That in Garn, weil ihm Spinnarbeit zugesetzt wurde. Aber das Produkt, das Garn, ist jetzt nur Gradmesser der von der Baumwolle eingesaugten Arbeit. Wird in einer Stunde 1⅔ lbs. Baumwolle versponnen oder in 1⅔ lbs. Garn verwandelt, so zeigen 10 lbs. Garn 6 eingesaugte Arbeitsstunden an. Bestimmte und erfahrungsmässig festgestellte Quanta Produkt stellen jetzt nichts dar als bestimmte Quanta Arbeit, bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit. Sie sind nur noch Materiatur von einer Stunde, zwei Stunden, einem Tag gesellschaftlicher Arbeit.
Dass die Arbeit grade Spinnarbeit, ihr Material Baumwolle und ihr Produkt Garn, wird hier eben so gleichgültig, als dass der Arbeitsgegenstand selbst schon Produkt, also Rohmaterial ist. Wäre der Arbei-
ter, statt in der Spinnerei, in der Kohlengrube beschäftigt, so wäre der Arbeitsgegenstand, die Kohle, von Natur vorhanden. Dennoch stellte ein bestimmtes Quantum aus dem Bett losgebrochener Kohle, z. B. ein Centner, ein bestimmtes Quantum aufgesaugter Arbeit dar.
Beim Verkauf der Arbeitskraft ward unterstellt, dass ihr Tageswerth = 3 sh., und in den letztern 6 Arbeitsstunden verkörpert sind, diess Arbeitsquantum also erheischt ist, um die Durchschnittssumme der täglichen Lebensmittel des Arbeiters zu produziren. Verwandelt unser Spinner nun während einer Arbeitsstunde 1⅔ lbs. Baumwolle in 1⅔ lbs. Garn(FN 12), so in 6 Stunden 10 lbs. Baumwolle in 10 lbs. Garn. Während der Dauer des Spinnprozesses saugt die Baumwolle also 6 Arbeitsstunden ein. Dieselbe Arbeitszeit stellt sich in einem Goldquantum von 3 sh. dar. Der Baumwolle wurde also durch das Spinnen selbst ein Werth von 3 sh. zugesetzt.
Sehn wir uns nun den Gesammtwerth des Produkts, der 10 lbs. Garn, an. In ihnen sind 2½ Arbeitstage vergegenständlicht, 2 Tage enthalten in Baumwolle und Spindelmasse, ½ Tag Arbeit eingesaugt während des Spinnprozesses. Dieselbe Arbeitszeit stellt sich in einer Goldmasse von 15 sh. dar. Der dem Werth der 10 lbs. Garn adäquate Preis beträgt also 15 sh., der Preis eines lb. Garn 1 sh. 6 d.
Unser Kapitalist stutzt. Der Werth des Produkts ist gleich dem Werth des vorgeschossenen Kapitals. Der vorgeschossene Werth hat sich nicht verwerthet, keinen Mehrwerth erzeugt, Geld sich also nicht in Kapital verwandelt. Der Preis der 10 lbs. Garn ist 15 sh. und 15 sh. wurden verausgabt auf dem Waarenmarkt für die Bildungselemente des Produkts oder, was dasselbe, die Faktoren des Arbeitsprozesses, 10 sh. für Baumwolle, 2 sh. für die verzehrte Spindelmasse, und 3 sh. für Arbeitskraft. Der aufgeschwollene Werth des Garns hilft nichts, denn sein Werth ist nur die Summe der früher auf Baumwolle, Spindel und Arbeitskraft vertheilten Werthe, und aus einer solchen blossen Addition vorhandner Werthe kann nun und nimmermehr ein Mehrwerth entspringen(FN 13). Diese Werthe sind jetzt alle auf ein Ding konzentrirt, aber
so waren sie in der Geldsumme von 15 sh., bevor diese sich durch drei Waarenkäufe zersplitterte.
An und für sich ist diess Resultat nicht befremdlich. Der Werth eines lb. Garn ist 1 sh. 6 d. und für 10 lbs. Garn müsste unser Kapitalist daher auf dem Waarenmarkt 15 sh. zahlen. Ob er sich sein Privathaus fertig auf dem Markt kauft, oder es selbst bauen lässt, keine dieser Operationen wird das im Erwerb des Hauses ausgelegte Geld vermehren.
Der Kapitalist, der in der Vulgärökonomie Bescheid weiss, sagt vielleicht, er habe sein Geld mit der Absicht vorgeschossen, mehr Geld daraus zu machen. Der Weg zur Hölle ist jedoch mit guten Absichten gepflastert und er konnte eben so gut der Absicht sein, Geld zu machen, ohne zu produziren(FN 14). Er droht. Man werde ihn nicht wieder ertappen. Künftig werde er die Waare fertig auf dem Markt kaufen, statt sie selbst zu fabriziren. Wenn aber alle seine Brüder Kapitalisten dessgleichen thun, wo soll er Waare auf dem Markt finden? Und Geld kann er nicht essen. Er katechisirt. Man soll seine Abstinenz bedenken. Er konnte seine 15 sh. verprassen. Statt dessen hat er sie produktiv konsumirt und Garn daraus gemacht. Aber dafür ist er ja im Besitz von Garn statt von Gewissensbissen. Er muss bei Leibe nicht in die Rolle des Schatzbildners zurückfallen, der uns zeigte, was bei der Ascetik herauskommt. Ausserdem, wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Welches immer das Verdienst seiner Entsagung, es ist nichts da, um sie extra zu zahlen, da der Werth des Produkts, der aus dem Prozess herauskommt, nur gleich der Summe der
hineingeworfenen Waarenwerthe. Er beruhige sich also dabei, dass Tugend der Tugend Lohn. Statt dessen wird er zudringlich. Das Garn ist ihm unnütz. Er hat es für den Verkauf produzirt. So verkaufe er es, oder, noch einfacher, produzire in Zukunft nur Dinge für seinen eignen Bedarf, ein Rezept, das ihm bereits sein Hausarzt Mac Culloch als probates Mittel gegen die Epidemie der Ueberproduktion verschrieben hat. Er stellt sich trutzig auf die Hinterbeine. Sollte der Arbeiter mit seinen eignen Gliedmassen in der blauen Luft Arbeitsgebilde schaffen, Waaren produziren? Gab er ihm nicht den Stoff, womit und worin er allein seine Arbeit verleiblichen kann? Da nun der grösste Theil der Gesellschaft aus solchen Habenichtsen besteht, hat er nicht der Gesellschaft durch seine Produktionsmittel, seine Baumwolle und seine Spindel, einen unermesslichen Dienst erwiesen, nicht dem Arbeiter selbst, den er obendrein noch mit Lebensmitteln versah? Und soll er den Dienst nicht berechnen? Hat der Arbeiter ihm aber nicht den Gegendienst erwiesen, Baumwolle und Spindel in Garn zu verwandeln? Ausserdem handelt es sich hier nicht um Dienste(FN 15). Ein Dienst ist nichts als die nützliche Wirkung eines Gebrauchswerths, sei es der Waare, sei es der Arbeit(FN 16). Hier aber gilt’s den Tauschwerth. Er zahlte dem Arbeiter den Werth von 3 sh. Der Arbeiter gab ihm ein exaktes Aequivalent
zurück in dem der Baumwolle zugesetzten Werth von 3 sh., Werth für Werth. Unser Freund, eben noch so kapitalübermüthig, nimmt plötzlich die anspruchslose Haltung seines eignen Arbeiters an. Hat er nicht selbst gearbeitet? nicht die Arbeit der Ueberwachung, der Oberaufsicht über den Spinner verrichtet? Bildet diese seine Arbeit nicht auch Werth? Sein eigner overlooker und sein manager zucken die Achseln. Unterdess hat er aber bereits mit heitrem Lächeln seine alte Physiognomie wieder angenommen. Er foppte uns mit der ganzen Litanei. Er giebt keinen Deut darum. Er überlässt diese und ähnliche faule Ausflüchte und hohle Flausen den dafür eigens bezahlten Professoren der politischen Oekonomie. Er selbst ist ein praktischer Mann, der zwar nicht immer bedenkt, was er ausserhalb des Geschäfts sagt, aber stets weiss, was er im Geschäft thut.
Sehn wir näher zu. Der Tageswerth der Arbeitskraft betrug 3 sh., weil in ihr selbst ein halber Arbeitstag vergegenständlicht ist, d. h. weil die täglich zur Produktion der Arbeitskraft nöthigen Lebensmittel einen halben Arbeitstag kosten. Aber die vergangene Arbeit, die in der Arbeitskraft steckt, und die lebendige Arbeit, die sie leisten kann, ihre täglichen Erhaltungskosten und ihre tägliche Verausgabung, sind zwei ganz verschiedne Grössen. Die erstere bestimmt ihren Tauschwerth, die andere bildet ihren Gebrauchswerth. Dass ein halber Arbeitstag nöthig, um ihn während 24 Stunden am Leben zu erhalten, hindert den Arbeiter keineswegs einen ganzen Tag zu arbeiten. Der Werth der Arbeitskraft und ihre Verwerthung im Arbeitsprozess sind also zwei verschiedne Grössen. Diese Werthdifferenz hatte der Kapitalist im Auge, als er die Arbeitskraft kaufte. Ihre nützliche Eigenschaft, Garn oder Stiefel zu machen, war nur eine conditio sine qua, weil Arbeit in nützlicher Form verausgabt werden muss, um Werth zu bilden. Was aber entschied, war der spezifische Gebrauchswerth dieser Waare, Quelle von Tauschwerth zu sein und von mehr Tauschwerth als sie selbst hat. Diess ist der spezifische Dienst, den der Kapitalist von ihr erwartet. Und er verfährt dabei den ewigen Gesetzen des Waarenaustausches gemäss. In der That, der Verkäufer der Arbeitskraft, wie der Verkäufer jeder andern Waare, realisirtihren Tauschwerth und veräussert ihren Gebrauchswerth. Er kann den einen nicht erhalten, ohne den andern wegzugeben. Der Gebrauchswerth der Arbeitskraft, die Arbeit selbst, gehört eben so wenig ihrem Verkäufer, wie der
Gebrauchswerth des verkauften Oels dem Oelhändler. Der Geldbesitzer hat den Tageswerth der Arbeitskraft gezahlt; ihm gehört daher ihr Gebrauch während des Tages, die tagelange Arbeit. Der Umstand, dass die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, dass daher der Werth, den ihr Gebrauch während eines Tags schafft, doppelt so gross ist als ihr eigner Tageswerth, ist ein besondres Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den Verkäufer.
Unser Kapitalist hat den Casus vorgesehn. Der Arbeiter findet daher in der Werkstätte die nöthigen Produktionsmittel nicht nur für einen sechsstündigen, sondern für einen zwölfstündigen Arbeitsprozess. Saugten 10 lbs. Baumwolle 6 Arbeitsstunden ein und verwandelten sich in 10 lbs. Garn, so werden 20 lbs. Baumwolle 12 Arbeitsstunden einsaugen und in 20 lbs. Garn verwandelt. Betrachten wir das Produkt des verlängerten Arbeitsprozesses. In den 20 lbs. Garn sind jetzt 5 Arbeitstage vergegenständlicht, 4 in der verzehrten Baumwollund Spindelmasse, 1 von der Baumwolle eingesaugt während des Spinnprozesses. Der Goldausdruck von 5 Arbeitstagen ist aber 30 sh. oder 1 Pfd. St. 10 sh. Diess also der Preis der 20 lbs. Garn. Das Pfund Garn kostet nach wie vor 1 sh. 6 d. Aber die Werthsumme der in den Prozess geworfenen Waaren betrug 27 sh. Der Werth des Garns beträgt 30 sh. Der Werth des Produkts ist um ⅓ gewachsen über den zu seiner Produktion vorgeschossenen Werth. So haben sich 27 sh. in 30 sh. verwandelt. Sie haben einen Mehrwerth von 3 sh. gesetzt. Das Kunststück ist endlich gelungen. Geld ist in Kapital verwandelt.
Alle Bedingungen des Problems sind gelöst und die Gesetze des Waarenaustausches in keiner Weise verletzt. Aequivalent wurde gegen Aequivalent ausgetauscht. Der Kapitalist zahlte als Käufer jede Waare zu ihrem Werth, Baumwolle, Spindelmasse, Arbeitskraft. Er that dann, was jeder andre Käufer von Waaren thut. Er konsumirte ihren Gebrauchswerth. Der Konsumtionsprozess der Arbeitskraft, der zugleich Produktionsprozess der Waare, ergab ein Produkt von 20 lbs. Garn mit einem Werth von 30 sh. Der Kapitalist kehrt nun zum Markt zurück und verkauft Waare, nachdem er Waare gekauft hat. Er verkauft das Pfund Garn zu 1 sh. 6 d., keinen Deut über oder unter seinem Werth. Und doch zieht er 3 sh. mehr aus der Cirkulation her-
aus als er ursprünglich in sie hineinwarf. Dieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines Geldes in Kapital, geht in der Cirkulationssphäre vor und geht nicht in ihr vor. Durch die Vermittlung der Cirkulation, weil bedingt durch den Kauf der Arbeitskraft auf dem Waarenmarkt. Nicht in der Cirkulation, denn diese leitet nur den Verwerthungsprozess ein, der sich in der Produktionssphäre zuträgt. Und so ist „tout pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.“
Indem der Kapitalist Geld in Waaren verwandelt, die als Stoffbildner eines neuen Produkts oder als Faktoren des Arbeitsprozesses dienen, indem er ihrer todten Gegenständlichkeit lebendige Arbeitskraft einverleibt, verwandelt er Werth, vergangne, vergegenständlichte, todte Arbeit in Kapital, sich selbst verwerthenden Werth, ein beseeltes Ungeheuer, das zu „arbeiten“ beginnt, als hätt’ es Lieb’ im Leibe.
Vergleichen wir nun Werthbildungsprozess und Verwerthungsprozess, so ist der Verwerthungsprozess nichts als ein über einen gewissen Punkt hinaus verlängerter Werthbildungsprozess. Dauert der letztre nur bis zu dem Punkt, wo der vom Kapital gezahlte Werth der Arbeitskraft durch ein neues Aequivalent ersetzt ist, so ist er einfacher Werthbildungsprozess. Dauert der Werthbildungsprozess über diesen Punkt hinaus, so wird er Verwerthungsprozess.
Vergleichen wir ferner den Werthbildungsprozess mit dem Arbeitsprozess, so besteht der letztere in der wirklichen Arbeit, die Gebrauchswerthe produzirt. Die Bewegung wird hier qualitativ betrachtet, in ihrer besondern Art und Weise, nach Zweck und Inhalt. Derselbe Arbeitsprozess stellt sich im Werthbildungsprozess nur von seiner quantitativen Seite dar. Es handelt sich nur noch um die Zeit, welche die Arbeit zu ihrer Operation braucht, oder um die Dauer, während deren die Arbeitskraft verausgabt wird. Hier gelten auch die Waaren, die in den Arbeitsprozess eingehn, nicht mehr als funktionell bestimmte, stoffliche Faktoren der zweckmässig wirkenden Arbeitskraft. Sie zählen nur noch als bestimmte Quanta vergegenständlichter Arbeit. Ob in den Produktionsmitteln enthalten oder durch die Arbeitskraft zugesetzt, die Arbeit zählt nur noch nach ihrem Zeitmass. Sie beträgt so viel Stunden, Tage u. s. w.
Sie zählt jedoch nur, soweit die zur Produktion des Gebrauchswerths verbrauchte Zeit gesellschaftlich nothwendig ist. Es umfasst
diess Verschiednes. Die Arbeitskraft muss unter normalen Bedingungen funktioniren. Ist die Spinnmaschine das gesellschaftlich herrschende Arbeitsmittel für die Spinnerei, so darf dem Arbeiter nicht ein Spinnrad in die Hand gegeben werden. Statt Baumwolle von normaler Güte muss er nicht Schund erhalten, der jeden Augenblick reisst. In beiden Fällen würde er mehr als die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zur Produktion eines Pfundes Garn verbrauchen, diese überschüssige Zeit aber nicht Werth oder Geld bilden. Der normale Charakter der gegenständlichen Arbeitsfaktoren hängt jedoch nicht vom Arbeiter, sondern vom Kapitalisten ab. Fernere Bedingung ist der normale Charakter der Arbeitskraft selbst. In dem Fach, worin sie verwandt wird, muss sie das herrschende Durchschnittsmass von Geschick, Fertigkeit und Raschheit besitzen. Aber unser Kapitalist kaufte auf dem Arbeitsmarkt Arbeitskraft von normaler Güte. Diese Kraft muss in dem gewöhnlichen Durchschnittsmass der Anstrengung, mit dem gesellschaftlich üblichen Grad von Intensivität verausgabt werden. Darüber wacht der Kapitalist eben so ängstlich, als dass keine Zeit ohne Arbeit vergeudet wird. Er hat die Arbeitskraft für bestimmte Zeitfrist gekauft. Er hält darauf das Seine zu haben. Er will nicht bestohlen sein. Endlich — und hierfür hat derselbe Herr einen eignen code pénal — darf kein zweckwidriger Consum von Rohmaterial und Arbeitsmitteln stattfinden, weil vergeudetes Material oder Arbeitsmittel überflüssig verausgabte Quanta vergegenständlichter Arbeit darstellen, also nicht zählen und nicht in das Produkt der Werthbildung eingehn(FN 17).
Man sieht: der früher aus der Analyse der Waare gewonnene Unterschied zwischen der Arbeit, soweit sie Gebrauchswerth, und derselben Arbeit, soweit sie Tauschwerth schafft, hat sich jetzt als Unterscheidung der verschiednen Seiten des Produktionsprozesses dargestellt.
Als Einheit von Arbeitsprozess und Werthbildungsprozess ist der Produktionsprozess Produktionsprozess von Waaren; als Einheit von Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess ist er kapitalistischer Produktionsprozess, kapitalistische Form der Waarenproduktion.
Es wurde früher bemerkt, dass es für den Verwerthungsprozess durchaus gleichgültig, ob die vom Kapitalisten angeeignete Arbeit einfache, gesellschaftliche Durchschnittsarbeit, oder komplizirtere Arbeit, Arbeit von höherem spezifischem Gewicht ist. Die Arbeit, die als höhere, komplizirtere Arbeit gegenüber der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit gilt, ist die Aeusserung einer Arbeitskraft, worin höhere Bildungskosten eingehn, deren Produktion mehr Arbeitszeit kostet und die daher einen höheren Tauschwerth hat als die einfache Arbeitskraft. Ist der Werth dieser Kraft höher, so äussert sie sich aber auch in höherer Arbeit und vergegenständlicht sich
daher, in denselben Zeiträumen, in verhältnissmässig höheren Werthen. Welches jedoch immer der Gradunterschied zwischen Spinnarbeit und Juwelierarbeit, die Portion Arbeit, wodurch der Juwelenarbeiter nur den Werth seiner eignen Arbeitskraft ersetzt, unterscheidet sich qualitativ in keiner Weise von der zusätzlichen Portion Arbeit, wodurch er Mehrwerth schafft. Nach wie vor kommt der Mehrwerth nur heraus durch einen quantitativen Ueberschuss von Arbeit, durch die verlängerte Dauer desselben Arbeitsprozesses, in dem einen Fall Prozess der Garnproduktion, in dem andern Fall Prozess der Juwelenproduktion(FN 18).
Andrerseits muss in jedem Werthbildungsprozess die höhere Arbeit stets auf gesellschaftliche Durchschnittsarbeit reducirt werden, z. B. ein Tag höherer Arbeit auf x Tage einfacher Arbeit(FN 19). Man erspart also eine überflüssige Operation und vereinfacht die Analyse durch die Annahme, dass der vom Kapital verwandte Arbeiter einfache gesellschaftliche Durchschnittsarbeit verrichtet.
2) Constantes Kapital und variables Kapital.↑Die verschiedenen Faktoren des Arbeitsprozesses nehmen verschiednen Antheil an der Bildung des Produkten-Werths.
Der Arbeiter setzt dem Arbeitsgegenstand neuen Tauschwerth zu durch Zusatz eines bestimmten Quantums von Arbeit, abgesehn vom bestimmten Inhalt, Zweck und technologischen Charakter seiner Arbeit. Andrerseits finden wir die Werthe der verzehrten Produktionsmittel wieder als Bestandtheile des Produkten-Werths, z. B. die Werthe von Baumwolle und Spindel im Garnwerth. Der Werth der Produktionsmittel wird also erhalten durch seine Uebertragung auf das Produkt. Diess Uebertragen geschieht während der Verwandlung der Produktionsmittel in Produkt, im Arbeitsprozess. Es ist vermittelt durch die Arbeit. Aber wie?
Der Arbeiter arbeitet nicht doppelt in derselben Zeit, nicht einmal um der Baumwolle durch seine Arbeit einen Werth zuzusetzen, und das andremal um ihren alten Werth zu erhalten, oder, was dasselbe, um den Werth der Baumwolle, die er verarbeitet, und der Spindel, womit er arbeitet, auf das Produkt, das Garn, zu übertragen. Sondern durch blosses Zusetzen von neuem Werth erhält er den alten Werth. Da aber der Zusatz von neuem Werth zum Arbeitsgegenstand und die Erhaltung der alten Werthe im Produkt zwei ganz verschiedne Resultate sind, die der Arbeiter in derselben Zeit hervorbringt, obgleich er nur einmal in derselben Zeit arbeitet, kann diese Doppelseitigkeit des Resultats offenbar nur aus der Doppelseitigkeit seiner Arbeit selbst erklärt werden. In demselben Zeitpunkt muss sie in
einer Eigenschaft Werth schaffen und in einer andern Eigenschaft Werth erhalten oder übertragen.
Wie setzt jeder Arbeiter Arbeitszeit und daher Werth zu? Immer nur in der Form seiner eigenthümlich produktiven Arbeitsweise. Der Spinner setzt nur Arbeitszeit zu, indem er spinnt, der Weber, indem er webt, der Schmidt, indem er schmiedet. Durch die zweckbestimmte Form aber, worin sie Arbeit überhaupt zusetzen und daher Neuwerth, durch das Spinnen, Weben, Schmieden werden die Produktionsmittel, Baumwolle und Spindel, Garn und Webstuhl, Eisen und Amboss, zu Bildungselementen eines Produkts, eines neuen Gebrauchswerths(FN 20). Die alte Form ihres Gebrauchswerths vergeht, aber nur um in einer neuen Form von Gebrauchswerth aufzugehn. Bei Betrachtung des Werthbildungsprozesses ergab sich aber, dass so weit ein Gebrauchswerth zweckgemäss vernutzt wird zur Produktion eines neuen Gebrauchswerths, die zur Herstellung des vernutzten Gebrauchswerths nothwendige Arbeitszeit einen Theil der zur Herstellung des neuen Gebrauchswerths nothwendigen Arbeitszeit bildet, also Arbeitszeit ist, die vom vernutzten Produktionsmittel auf das neue Produkt übertragen wird. Der Arbeiter erhält also die Werthe der vernutzten Produktionsmittel oder überträgt sie als Werthbestandtheile auf das Produkt, nicht durch sein Zusetzen von Arbeit überhaupt, sondern durch den besondren nützlichen Charakter, durch die spezifisch produktive Form dieser zusätzlichen Arbeit. Als solche zweckgemässe produktive Thätigkeit, Spinnen, Weben, Schmieden, erweckt die Arbeit durch ihren blossen Kontakt die Produktionsmittel von den Todten, begeistet sie zu Faktoren des Arbeitsprozesses und verbindet sich mit ihnen zu Produkten.
Wäre die spezifische produktive Arbeit des Arbeiters nicht Spinnen, so würde er die Baumwolle nicht in Garn verwandeln, also auch die Werthe von Baumwolle und Spindel nicht auf das Garn übertragen. Wechselt dagegen derselbe Arbeiter das Metier und wird Tischler, so wird er nach wie vor durch einen Arbeitstag seinem Material Werth zusetzen. Er setzt ihn also zu nicht durch seine Arbeit, soweit sie Spinnarbeit oder Tischlerarbeit, sondern so weit sie abstrakte, gesell
schaftliche Arbeit überhaupt, und er setzt eine bestimmte Werthgrösse zu, nicht weil seine Arbeit einen besondern nützlichen Inhalt hat, sondern weil sie eine bestimmte Zeit dauert. In ihrer abstrakten allgemeinen Eigenschaft also, als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, setzt die Arbeit des Spinners den Werthen von Baumwolle und Spindel Neuwerth zu, und in ihrer konkreten, besondern, nützlichen Eigenschaft als Spinnprozess, überträgt sie den Werth dieser Produktionsmittel auf das Produkt und erhält so ihren Werth im Produkt. Daher die Doppelseitigkeit ihres Resultats in demselben Zeitpunkt.
Durch das bloss quantitative Zusetzen von Arbeit wird neuer Werth zugesetzt, durch die Qualität der zugesetzten Arbeit werden die alten Werthe der Produktionsmittel im Produkt erhalten. Diese doppelseitige Wirkung derselben Arbeit in Folge ihres doppelseitigen Charakters zeigt sich handgreiflich an verschiednen Erscheinungen.
Nimm an, irgend eine Erfindung befähige den Spinner in 6 Stunden so viel Baumwolle zu verspinnen wie früher in 36 Stunden. Als zweckmässig-nützliche, produktive Thätigkeit hat seine Arbeit ihre Kraft versechsfacht. Ihr Produkt ist ein sechsfaches, 36 statt 6 lbs. Garn. Aber die 36 Pfund Baumwolle saugen jetzt nur so viel Arbeitszeit ein als früher 6 Pfund. Ein Sechstel weniger neuer Arbeit wird ihnen zugesetzt als mit der alten Methode, daher nur noch ein Sechstel des früheren Werths. Andrerseits existirt jetzt der sechsfache Werth von Baumwolle im Produkt, den 36 Pfund Garn. In den 6 Spinnstunden wird ein sechsmal grösserer Werth von Rohmaterial erhalten und auf das Produkt übertragen, obgleich demselben Rohmaterial ein sechsmal kleinerer Neuwerth zugesetzt wird. Diess zeigt, wie die Eigenschaft, worin die Arbeit während desselben untheilbaren Prozesses Werthe erhält, wesentlich unterschieden ist von der Eigenschaft, worin sie Werth schafft. Je mehr nothwendige Arbeitszeit während der Spinnoperation auf dasselbe Quantum Baumwolle geht, desto grösser der Neuwerth, der der Baumwolle zugesetzt wird, aber je mehr Pfunde Baumwolle in derselben Arbeitszeit versponnen werden, desto grösser der alte Werth, der im Produkt erhalten wird.
Nimm umgekehrt an, die Produktivität der Spinnarbeit bleibe unverändert, der Spinner brauche also nach wie vor gleich viel Zeit, um ein
Pfund Baumwolle in Garn zu verwandeln. Aber der Tauschwerth der Baumwolle selbst wechsle, ein Pfund Baumwolle steige oder falle um das Sechsfache seines Preises. In beiden Fällen fährt der Spinner fort demselben Quantum Baumwolle dieselbe Arbeitszeit zuzusetzen, also denselben Werth und in beiden Fällen produzirt er in gleicher Zeit gleich viel Garn. Dennoch ist der Werth, den er von der Baumwolle auf das Garn, das Produkt, überträgt, das einemal sechsmal kleiner, das andremal sechsmal grösser als zuvor. Ebenso wenn die Arbeitsmittel sich vertheuern oder verwohlfeilen, aber stets denselben Dienst im Arbeitsprozess leisten.
Bleiben die technologischen Bedingungen des Spinnprozesses unverändert und geht gleichfalls kein Werthwechsel mit seinen Produktionsmitteln vor, so verbraucht der Spinner nach wie vor in gleichen Arbeitszeiten gleiche Quanta Rohmaterial und Maschinerie von gleichbleibenden Werthen. Der Werth, den er im Produkt erhält, steht dann in direktem Verhältniss zu dem Neuwerth, den er zusetzt. In zwei Wochen setzt er zweimal mehr Arbeit zu als in einer Woche, also zweimal mehr Werth, und zugleich vernutzt er zweimal mehr Material von zweimal mehr Werth, und verschleisst zweimal mehr Maschinerie von zweimal mehr Werth, erhält also im Produkt von zwei Wochen zweimal mehr Werth als im Produkt einer Woche. Unter gegebnen gleichbleibenden Produktionsbedingungen erhält der Arbeiter um so mehr Werth, je mehr Werth er zusetzt, aber er erhält nicht mehr Werth, weil er mehr Werth zusetzt, sondern weil er ihn unter gleichbleibenden und von seiner eignen Arbeit unabhängigen Bedingungen zusetzt.
Allerdings kann in einem relativen, wenn auch nicht absoluten Sinn gesagt werden, dass der Arheiter stets in derselben Proportion alte Werthe erhält, worin er Neuwerth zusetzt. Ob die Baumwolle von 1 sh. auf 2 sh. steige oder auf 6 d. falle, er erhält in dem Produkt einer Stunde stets nur halb so viel Baumwollwerth, wie der auch wechsle, als in dem Produkt von zwei Stunden. Wechselt ferner die Produktivität seiner eignen Arbeit, sie steige oder falle, so wird er z. B. in einer Arbeitsstunde mehr oder weniger Baumwolle verspinnen als früher, und dem entsprechend mehr oder weniger Baumwollwerth im Produkt einer Arbeitsstunde erhalten. Mit alle dem wird er in
zwei Arbeitsstunden zweimal mehr Werth erhalten als in einer Arbeitsstunde.
Werth, von seiner nur symbolischen Darstellung im Werthzeichen abgesehn, existirt nur in einem Gebrauchswerth, einem Ding. (Der Mensch selbst, als blosses Dasein von Arbeitskraft betrachtet, ist ein Naturgegenstand, ein Ding, wenn auch lebendiges, selbstbewusstes Ding, und die Arbeit selbst ist dingliche Aeusserung dieser Kraft.) Geht daher der Gebrauchswerth verloren, so geht auch der Tauschwerth verloren. Die Produktionsmittel verlieren mit ihrem Gebrauchswerth nicht zugleich ihren Tauschwerth, weil sie durch den Arbeitsprozess die ursprüngliche Gestalt ihres Gebrauchswerths in der That nur verlieren, um im Produkt die Gestalt eines andern Gebrauchswerths zu gewinnen. So wichtig es aber für den Tauschwerth ist in irgend einem Gebrauchswerth zu existiren, so gleichgültig ist es für ihn, in welchem er existirt, wie die Metamorphose der Waare zeigt. Es folgt hieraus, dass im Arbeitsprozess Werth vom Produktionsmittel auf das Produkt nur übergeht, so weit das Produktionsmittel mit seinem selbstständigen Gebrauchswerth auch seinen Tauschwerth verliert. Es giebt nur den Werth an das Produkt ab, den es als Produktionsmittel verliert. Die gegenständlichen Faktoren des Arbeitsprozesses verhalten sich aber in dieser Hinsicht verschieden.
Die Kohle, womit die Maschine geheizt wird, verschwindet spurlos, ebenso der Talg, womit man die Axe des Rades schmiert u. s. w. Farben und andre Hilfsstoffe verschwinden, zeigen sich aber in den Eigenschaften des Produkts. Das Rohmaterial bildet die Substanz des Produkts, hat aber seine Form verändert. Rohmaterial und Hilfsstoffe verlieren also die selbstständige Gestalt, womit sie in den Arbeitsprozess als Gebrauchswerthe eintraten. Anders mit den eigentlichen Arbeitsmitteln. Ein Instrument, eine Maschine, ein Fabrikgebäude, ein Gefäss u. s. w. dienen im Arbeitsprozess nur, so lange sie ihre ursprüngliche Gestalt bewahren und morgen wieder in eben derselben Form in den Arbeitsprozess eingehn, wie gestern. Wie sie während ihres Lebens, des Arbeitsprozesses, ihre selbstständige Gestalt dem Produkt gegenüber bewahren, so auch nach ihrem Tode. Die Leichen von Maschinen, Werkzeugen, Arbeitsgebäuden u. s. w. existiren immer noch selbstständig getrennt von den Produkten, die sie bilden halfen. Betrachten wir nun die ganze Periode, während
deren ein solches Arbeitsmittel dient, von dem Tag seines Eintritts in die Werkstätte bis zum Tage seiner Verbannung in die Rumpelkammer, so ist während dieser Periode sein Gebrauchswerth von der Arbeit vollständig verzehrt worden, und sein Tauschwerth daher vollständig auf das Produkt übergegangen. Hat eine Spinnmaschine z. B. in 10 Jahren ausgelebt, so ist während des zehnjährigen Arbeitsprozesses ihr Gesammtwerth auf das zehnjährige Produkt übergegangen. Die Lebensperiode eines Arbeitsmittels umfängt also eine grössere oder kleinere Anzahl stets von neuem mit ihm wiederholter Arbeitsprozesse. Und es geht dem Arbeitsmittel wie dem Menschen. Jeder Mensch stirbt täglich um 24 Stunden ab. Man sieht aber keinem Menschen genau an, wie viel Tage er bereits verstorben ist. Diess verhindert Lebensversicherungsgesellschaften jedoch nicht, aus dem Durchschnittsleben der Menschen sehr sichre, und was noch viel mehr ist, sehr profitliche Schlüsse zu ziehn. So mit dem Arbeitsmittel. Man weiss aus der Erfahrung, wie lang ein Arbeitsmittel, z. B. eine Maschine von gewisser Art, durchschnittlich vorhält. Gesetzt sein Gebrauchswerth im Arbeitsprozess daure nur 6 Tage. So verliert es im Durchschnitt jeden Arbeitstag ⅙ seines Gebrauchswerths und giebt daher ⅙ seines Tauschwerths an das tägliche Produkt ab. In dieser Art wird der Verschleiss aller Arbeitsmittel berechnet, also z. B. ihr täglicher Verlust an Gebrauchswerth, und die ihm entsprechende tägliche Abgabe von Tauschwerth an das Produkt.
Es zeigt sich hier schlagend, dass ein Produktionsmittel nie mehr Werth an das Produkt abgiebt, als es selbst im Arbeitsprozess durch Vernichtung seines eignen Gebrauchswerths verliert. Hätte es keinen Tauschwerth zu verlieren, d. h. wäre es nicht selbst Produkt menschlicher Arbeit, so würde es keinen Tauschwerth an das Produkt abgeben. Es diente als Bildner von Gebrauchswerth, ohne als Bildner von Tauschwerth zu dienen. Diess ist daher der Fall mit allen Produktionsmitteln, die von Natur, ohne menschliches Zuthun, vorhanden sind, mit Erde, Wind, Wasser, dem Eisen in der Erzader, dem Holze des Urwaldes u. s. w.
Ein andres interessantes Phänomen tritt uns hier entgegen. Eine Maschine sei z. B. 1000 Pfd. St. werth und schleisse sich in 1000 Tagen ab. In diesem Falle geht täglich des Werths der Maschine von ihr selbst auf ihr tägliches Produkt über, aber, obgleich mit abnehmender Lebenskraft, wirkt die Maschine stets ganz im Arbeitsprozess. Es zeigt
sich hier also, dass ein Faktor des Arbeitsprozesses, ein Produktionsmittel, ganz in den Arbeitsprozess, aber nur stückweis in den Verwerthungsprozess eingeht. Der Unterschied von Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess reflektirt sich hier an den gegenständlichen Faktoren, indem dasselbe Produktionsmittel als Element des Arbeitsprozesses ganz und als Element der Werthbildung nur stückweis in demselben Produktionsprozess zählt(FN 21).
Andrerseits kann umgekehrt ein Produktionsmittel ganz in den Verwerthungsprozess eingehn, obgleich nur stückweis in den Arbeitsprozess. Nimm an, beim Verspinnen der Baumwolle fielen täglich auf 115 Pfund 15 Pfunde ab, die kein Garn, sondern nur devil’s dust bilden. Dennoch, wenn dieser Abfall von 15 % normal, von der Durchschnitts-Verarbeitung
der Baumwolle unzertrennlich ist, geht der Werth der 15 lbs. Baumwolle, die kein Element des Garns, ganz eben so sehr in seinen Werth ein, wie der Werth der 100 lbs., die seine Substanz bilden. Der Gebrauchswerth von 15 lbs. Baumwolle muss verstauben, um 100 lbs. Garn zu machen. Der Untergang dieser Baumwolle ist also eine Produktionsbedingung des Garns. Eben desswegen giebt sie ihren Tauschwerth an das Garn ab. Diess gilt von allen Exkrementen des Arbeitsprozesses, in dem Grad wenigstens, worin diese Exkremente nicht wieder neue Produktionsmittel und daher neue selbstständige Gebrauchswerthe bilden. So sieht man in den grossen Maschinenfabriken zu Manchester Berge von Eisenabfällen, durch cyklopische Maschinen gleich Hobelspähnen abgeschält, am Abend auf grossen Wagen aus der Fabrik in die Eisengiesserei wandern, um den andern Tag wieder als massives Eisen aus der Eisengiesserei in die Fabrik zurückzuwandern.
Nur soweit Produktionsmittel während des Arbeitsprozesses Tauschwerth in der Gestalt ihrer alten Gebrauchswerthe verlieren, übertragen sie Tauschwerth auf die neue Gestalt des Produkts. Das Maximum des Werthverlustes, den sie im Arbeitsprozess erleiden können, ist aber beschränkt durch ihre ursprüngliche Werthgrösse, womit sie in den Arbeitsprozess eintreten, oder durch die zu ihrer eignen Produktion erheischte Arbeitszeit. Produktionsmittel können dem Produkt daher nie mehr Werth zusetzen, als sie unabhängig vom Arbeitsprozess, dem sie dienen, besitzen. Wie nützlich ein Arbeitsmaterial, eine Maschine, ein Produktionsmittel, wenn es 150 Pfd. St., sage 500 Arbeitstage, kostet, setzt es dem Gesammtprodukt, zu dessen Bildung es dient, nie mehr als 150 Pfd. St. zu. Sein Werth ist bestimmt nicht durch den Arbeitsprozess, worin es als Produktionsmittel eingeht, sondern durch den Arbeitsprozess, woraus es als Produkt herauskommt. In dem Arbeitsprozess dient es nur als Gebrauchswerth, als Ding mit nützlichen Eigenschaften, und gäbe daher keinen Tauschwerth an das Produkt ab, hätte es nicht Tauschwerth besessen vor seinem Eintritt in den Prozess(FN 22).
Indem die produktive Arbeit Produktionsmittel in Bildungselemente eines neuen Produkts verwandelt, geht mit deren Tauschwerth eine Seelenwanderung vor. Er geht aus dem verzehrten Leib in den neu gestalteten Leib über. Aber diese Seelenwanderung ereignet sich gleichsam hinter dem Rücken der wirklichen Arbeit. Der Arbeiter kann neue Arbeit nicht zusetzen, also nicht neuen Werth schaffen, ohne alte Werthe zu erhalten, denn er muss die Arbeit immer in bestimmter nützlicher Form zusetzen, und er kann sie nicht in nützlicher Form zusetzen, ohne Produkte zu Produktionsmitteln eines neuen Produkts zu machen, und dadurch ihren Werth auf das neue Produkt zu übertragen. Es ist also eine Naturgabe der sich bethätigenden Arbeitskraft, der lebendigen Arbeit, Werth zu erhalten, indem sie Werth zusetzt, eine Naturgabe, die dem Arbeiter nichts kostet, aber dem Kapitalisten viel einbringt, die Erhaltung des vorhandnen Kapitalwerths(FN 22a).
So lange das Geschäft flott geht, ist der Kapitalist zu sehr in die Plusmacherei vertieft, um diese Gratisgabe der Arbeit zu sehn. Gewaltsame Unterbrechungen des Arbeitsprozesses, Krisen, machen sie ihm empfindlich bemerksam(FN 23).
Was überhaupt im Arbeitsprozess an den Produktionsmitteln verzehrt wird, ist ihr Gebrauchswerth, dessen Konsumtion durch die Arbeit Produkte bildet. Ihr Tauschwerth wird in der That nicht konsumirt(FN 24), kann also auch nicht reproduzirt werden. Er wird erhalten, aber nicht weil eine Operation mit ihm selbst im Arbeitsprozess vorgeht, sondern weil der Gebrauchswerth, worin er ursprünglich existirt, zwar verschwindet, aber nur in einem anderen Gebrauchswerth verschwindet. Der Tauschwerth der Produktionsmittel erscheint daher wieder im Werth des Produkts, aber er wird, genau gesprochen, nicht reproduzirt. Was produzirt wird, ist der neue Gebrauchswerth, worin der alte Tauschwerth wieder erscheint(FN 25).
Anders mit dem subjektiven Faktor des Arbeitsprozesses, der sich bethätigenden Arbeitskraft. Während die Arbeit durch ihre zweckmässige Form den Werth der Produktionsmittel auf das Produkt überträgt und erhält, bildet jedes Moment ihrer Bewegung zusätzlichen Werth, Neuwerth. Gesetzt der Produktionsprozess breche ab beim Punkt, wo der Arbeiter ein Aequivalent für den Werth seiner eignen Arbeitskraft produzirt, durch sechsstündige Arbeit z. B. einen Werth von 3 sh. zugesetzt hat. Dieser Werth bildet den Ueberschuss des Produktenwerthes über seine dem Werth der Produktionsmittel geschuldeten Bestandtheile. Es ist der einzige Originalwerth, der innerhalb dieses Prozesses entstand, der einzige Werththeil des Produkts, der durch den Prozess selbst produzirt ist. Allerdings ersetzt er nur das vom Kapitalisten beim Kauf der Arbeitskraft vorgeschossene, vom Arbeiter selbst in Lebensmitteln verausgabte Geld. Mit Bezug auf die verausgabten 3 sh. erscheint der Neuwerth von 3 sh. nur als Reproduktion. Aber er ist wirklich reproduzirt, nicht nur scheinbar, wie der Werth der Produktionsmittel. Der Ersatz eines Werths durch den andern ist hier vermittelt durch neue Werthschöpfung.
Wir wissen jedoch bereits, dass der Arbeitsprozess über den Punkt hinaus fortdauert, wo ein blosses Aequivalent für den Werth der
Arbeitskraft reproduzirt und dem Arbeitsgegenstand zugesetzt wäre. Statt der 6 Stunden, die hierzu genügten, währt der Prozess z. B. 12 Stunden. Durch die Bethätigung der Arbeitskraft wird also nicht nur ihr eigner Werth reproduzirt, sondern ein überschüssiger Werth produzirt. Dieser Mehrwerth bildet den Ueberschuss des Produktenwerthes über den Werth der verzehrten Produktbildner, d. h. der Produktionsmittel und der Arbeitskraft.
Indem wir die verschiedenen Rollen dargestellt, welche die verschiedenen Faktoren des Arbeitsprozesses in der Bildung des Produktenwerths spielen, haben wir in der That die Funktionen der verschiedenen Bestandtheile des Kapitals in seinem eignen Verwerthungsprozess charakterisirt. Der Ueberschuss des Gesammtwerths des Produkts über die Werthsumme seiner Bildungselemente ist der Ueberschuss des verwertheten Kapitals über den ursprünglich vorgeschossenen Kapitalwerth. Produktionsmittel auf der einen Seite, Arbeitskraft auf der andern, sind nur die verschiednen Existenzformen, die der ursprüngliche Kapitalwerth bei Abstreifung seiner Geldform und seiner Verwandlung in die Faktoren des Arbeitsprozesses annahm.
Der Theil des Kapitals also, der sich in Produktionsmittel, d. h. in Rohmaterial, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel umsetzt, verändert seine Werthgrösse nicht im Produktionsprozesse. Ich nenne ihn daher konstanten Kapitaltheil, oder kürzer: konstantes Kapital.
Der in Arbeitskraft umgesetzte Theil des Kapitals verändert dagegen seinen Werth im Produktionsprozesse. Er reproduzirt sein eignes Aequivalent und einen Ueberschuss darüber, Mehrwerth, der selbst wechseln, grösser oder kleiner sein kann. Aus einer konstanten Grösse verwandelt sich dieser Theil des Kapitals fortwährend in eine variable. Ich nenne ihn daher variablen Kapitaltheil, oder kürzer: variables Kapital. Dieselben Kapitalbestandtheile, die sich vom Standpunkt des Arbeitsprozesses als objektive und subjektive Faktoren, als Produktionsmittel und Arbeitskraft unterscheiden, unterscheiden sich vom Standpunkt des Verwerthungsprozesses als konstantes Kapital und variables Kapital.
Der Begriff des konstanten Kapitals schliesst eine Werthrevo
lution seiner Bestandtheile in keiner Weise aus. Nimm an, das Pfund Baumwolle koste heute 6 d. und steige morgen, in Folge eines Ausfalls der Baumwollerndte, auf 1 sh. Die alte Baumwolle, die fortfährt verarbeitet zu werden, ist zum Werth von 6 d. gekauft, aber sie fügt dem Produkt jetzt einen Werththeil von 1 sh. zu. Und die bereits versponnene, vielleicht schon als Garn auf dem Markt cirkulirende Baumwolle, fügt dem Produkt ebenfalls das Doppelte ihres ursprünglichen Werthes zu. Man sieht jedoch, dass diese Werthwechsel unabhängig sind von der Verwerthung der Baumwolle im Spinnprozess selbst. Wäre die alte Baumwolle noch gar nicht in den Arbeitsprozess eingegangen, so könnte sie jetzt zu 1 sh. statt zu 6 d. wieder verkauft werden. Umgekehrt: Je weniger Arbeitsprozesse sie noch durchlaufen hat, desto sichrer ist diess Resultat. Es ist daher Gesetz der Spekulation bei solchen Werthrevolutionen auf das Rohmaterial in seiner mindest verarbeiteten Form zu spekuliren, also eher auf Garn als auf Gewebe und eher auf die Baumwolle selbst als auf das Garn. Die Werthänderung entspringt hier in dem Prozesse, der Baumwolle produzirt, nicht in dem Prozesse, worin sie als Produktionsmittel und daher als konstantes Kapital funktionirt. Der Werth einer Waare ist zwar bestimmt durch das Quantum der in ihr enthaltenen Arbeit, aber diess Quantum ist gesellschaftlich bestimmt. Hat sich die gesellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit verändert — und dasselbe Quantum Baumwolle z. B. stellt in ungünstigen Erndten grösseres Quantum Arbeit dar, als in günstigen — so findet eine Rückwirkung auf die alte Waare statt, die immer nur als einzelnes Exemplar ihrer Gattung gilt(FN 26), deren Werth stets durch gesellschaftlich nothwendige, also auch stets unter gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen nothwendige Arbeit gemessen wird.
Wie der Werth des Rohmaterials, mag der Werth bereits im Produktionsprozess dienender Arbeitsmittel, der Maschinerie u. s. w., wechseln, also auch der Werththeil, den sie dem Produkt abgeben. Wird z. B. in Folge einer neuen Erfindung Maschinerie derselben Art mit verminderter Ausgabe von Arbeit reproduzirt, so entwerthet die alte Maschi-
nerie mehr oder minder und überträgt daher auch verhältnissmässig weniger Werth auf das Produkt. Aber auch hier entspringt der Werthwechsel ausserhalb des Produktionsprozesses, worin die Maschine als Produktionsmittel funktionirt. In diesem Prozess giebt sie nie mehr Werth ab als sie unabhängig von diesem Prozess besitzt.
Wie ein Wechsel im Werthe der Produktionsmittel, ob auch rückwirkend nach ihrem bereits erfolgten Eintritt in den Prozess, ihren Charakter als konstantes Kapital nicht verändert, ebenso wenig berührt ein Wechsel im Verhältnisse von konstantem und variablem Kapital ihren begrifflichen Unterschied. Die technologischen Bedingungen des Arbeitsprozesses mögen z. B. so umgestaltet werden, dass wo früher 10 Arbeiter mit 10 Werkzeugen von geringem Werth eine verhältnissmässig kleine Masse von Rohmaterial verarbeiteten, jetzt 1 Arbeiter mit einer theuren Maschine das hundertfache Rohmaterial verarbeitet. In diesem Falle wäre das konstante Kapital, d. h. die Werthmasse der angewandten Produktionsmittel, sehr gewachsen, und der variable Theil des Kapitals, der in Arbeitskraft vorgeschossene, sehr gefallen. Dieser Wechsel ändert jedoch nur das Grössenverhältniss zwischen konstantem und variablem Kapital, oder die Proportion, worin das Gesammtkapital in konstante und variable Bestandtheile zerfällt, berührt dagegen nicht den Unterschied von konstant und variabel.
3) Die Rate des Mehrwerths.↑Der Mehrwerth, den das vorgeschossene Kapital C im Produktionsprozess erzeugt hat, oder die Verwerthung des vorgeschossenen Kapitalwerths C stellt sich zunächst dar als Ueberschuss des Werths des Produkts über die Werthsumme seiner Produktionselemente.
Das Kapital C zerfällt in zwei Theile, eine Geldsumme c, die für Produktionsmittel, und eine andere Geldsumme v, die für Arbeitskraft verausgabt wird; c stellt den in konstantes, v den in variables Kapital verwandelten Werththeil vor. Ursprünglich ist also C = c + v, z. B. das vorgeschossene Kapital von 500 Pfd. St. = [Formel 1] Pfd. St. + [Formel 2] Pfd. St. Am Ende des Prozesses kommt ein Produkt
heraus, dessen Werth = [Formel 1] + m, wo m der Mehrwerth, z. B. [Formel 2] . Das ursprüngliche Kapital C hat sich in C'verwandelt, aus 500 Pfd. St. in 590 Pfd. St. Die Differenz zwischen beiden ist = m, einem Mehrwerth von 90. Da der Werth der Produktionselemente gleich dem Werth des vorgeschossenen Kapitals, so ist es in der That eine Tautologie, dass der Ueberschuss des Produktenwerths über den Werth seiner Produktionselemente gleich der Verwerthung des vorgeschossenen Kapitals oder gleich dem produzirten Mehrwerth.
Indess erfordert diese Tautologie eine nähere Bestimmung. Der mit dem Produktenwerth verglichene Werth seiner Produktionselemente ist der Werth der in seiner Bildung aufgezehrten Produktionselemente. Nun haben wir aber gesehn, dass ein Theil des angewandten konstanten Kapitals, der aus Arbeitsmitteln bestehende, seinen Werth nur bruchweis an das Produkt abgiebt, während eine andere Portion desselben in seiner alten Existenzform fortdauert. Da der letztere Theil keine Rolle im Werthbildungsprozess spielt, abstrahiren wir hier ganz und gar von ihm. Sein Hineinziehn in die Rechnung würde nichts ändern. Nimm an, c = 410 l. bestehe aus Rohmaterial zu 312 l., Hilfsstoffen zu 44 l. und im Prozess verschleissender Maschinerie von 54 l., der Werth der wirklich angewandten Maschinerie betrage aber 1054 l. Als vorgeschossen zur Erzeugung des Produktenwerths berechnen wir nur den Werth von 54 l., den die Maschinerie durch ihre Funktion verliert und daher an das Produkt abgiebt. Rechneten wir die 1000 Pfd. St. mit, die in ihrer alten Form fortexistiren als Dampfmaschine u. s. w., so müssten wir sie auf beiden Seiten mitrechnen, auf Seite des vorgeschossenen Werths und auf Seite des Produktenwerths(FN 26a), und erhielten so resp. 1500 Pfd. St. und 1590 Pfd. St. Die Differenz oder der Mehrwerth wäre nach wie vor 90 Pfd. St. Unter dem zur Werthproduktion vorgeschossenen konstanten Kapital verstehn wir
daher, wo das Gegentheil nicht aus dem Zusammenhang erhellt, stets nur den Werth der in der Produktion verzehrten Produktionsmittel.
Diess vorausgesetzt, kehren wir zurück zur Formel C = c + v, die sich in C' = [Formel 1] + m und eben dadurch C in C' verwandelt. Man weiss, dass der Werth des konstanten Kapitals im Produkt nur wieder erscheint. Das im Prozess wirklich neu erzeugte Werthprodukt ist also verschieden von dem aus dem Prozess erhaltenen Produktenwerth, daher nicht, wie es auf den ersten Blick scheint, [Formel 2] + m oder [Formel 3] , sondern v + m oder [Formel 4] , nicht 590 l., sondern 180 l. Wäre c, das konstante Kapital, = 0, in anderen Worten, gäbe es Industriezweige, worin der Kapitalist keine produzirten Produktionsmittel, weder Rohmaterial, noch Hilfsstoffe, noch Arbeitsinstrumente, sondern nur von Natur vorhandne Stoffe und Arbeitskraft anzuwenden hätte, so wäre kein konstanter Werththeil auf das Produkt zu übertragen. Dieses Element des Produktenwerths, in unsrem Beispiel 410 Pfd. St., fiele fort, aber das Werthprodukt von 180 Pfd. St., welches 90 Pfd. St. Mehrwerth enthält, bliebe ganz ebenso gross als ob c die grösste Werthsumme darstellte. Wir hätten C = [Formel 5] = v, und C', das verwerthete Kapital, = v + m, C' — C nach wie vor = m. Wäre umgekehrt m = o, in anderen Worten, hätte die Arbeitskraft, deren Werth im variablen Kapital vorgeschossen wird, nur ein Aequivalent produzirt, so C = c + v und C' (der Produktenwerth) = [Formel 6] + o, daher C = C'. Das vorgeschossene Kapital hätte sich nicht verwerthet.
Wir wissen in der That bereits, dass der Mehrwerth blos Folge der Werthveränderung ist, die mit v, dem in Arbeitskraft umgesetzten Kapitaltheil vorgeht, dass also v + m = v + ∆ v (v plus Increment von v) ist. Aber die wirkliche Werthveränderung und das Verhältniss, worin sich der Werth ändert, werden dadurch verdunkelt, dass in Folge des Wachsens seines variirenden Bestandtheils auch das vorgeschossene Gesammtkapital wächst. Es war 500 und es ist am Ende des Prozesses 590. Die reine Analyse des Prozesses erheischt also von dem Theil des Produkten-
werths, worin nur konstanter Kapitalwerth wieder erscheint, ganz zu abstrahiren, also das konstante Kapital c = o zu setzen, und damit ein Gesetz der Mathematik anzuwenden, wo sie mit variablen und konstanten Grössen operirt, und die konstante Grösse nur durch Addition oder Subtraktion mit der variablen verbunden ist(FN 27).
Eine andre Schwierigkeit entspringt aus der ursprünglichen Form des variablen Kapitals. So im obigen Beispiel ist C' = 410 l. konstantes Kapital + 90 l. variables Kapital + 90 l. Mehrwerth. Neunzig Pfd. St. sind aber eine gegebne, also konstante Grösse und es scheint daher ungereimt sie als variable Grösse zu behandeln. Aber [Formel 1] oder 90 l. variables Kapital ist hier in der That nur ein Symbol für den Prozess, den dieser Werth durchläuft. Der im Ankauf der Arbeitskraft vorgeschossene Kapitaltheil ist bestimmtes Quantum vergegenständlichter Arbeit, also konstante Werthgrösse, wie der Werth der gekauften Arbeitskraft. Im Produktionsprozess selbst aber tritt an die Stelle der vorgeschossenen 90 Pfd. St. die sich bethätigende Arbeitskraft, an die Stelle todter lebendige Arbeit, an die Stelle einer ruhenden eine fliessende Grösse, an die Stelle einer konstanten eine variable. Das Resultat ist die Reproduktion von v plus Increment von v. Vom Standpunkt der kapitalistischen Produktion ist dieser ganze Verlauf Selbstbewegung des in Arbeitskraft umgesetzten, ursprünglich konstanten Werths. Ihm wird der Prozess und sein Resultat zu gut geschrieben. Erscheint die Formel 90 l. variables Kapital oder sich verwerthender Werth daher widerspruchsvoll, so drückt sie nur einen der kapitalistischen Produktion immanenten Widerspruch aus.
Die Gleichsetzung des konstanten Kapitals mit o befremdet auf den ersten Blick. Indess vollzieht man sie beständig im Alltagsleben. Will Jemand z. B. Englands Gewinn an der Baumwollindustrie berechnen, so zieht er vor allem den an die Vereinigten Staaten, Indien, Aegypten u. s. w.
gezahlten Baumwoll preis ab; d. h. er setzt im Produktenwerth nur wiedererscheinenden Kapitalwerth = o.
Allerdings hat das Verhältniss des Mehrwerths, nicht nur zum Kapitaltheil, woraus er unmittelbar entspringt und dessen Werthveränderung er darstellt, sondern auch zum vorgeschossenen Gesammtkapital seine grosse ökonomische Bedeutung. Wir behandeln diess Verhältniss daher ausführlich im dritten Buch. Um einen Theil des Kapitals durch seinen Umsatz in Arbeitskraft zu verwerthen, muss ein andrer Theil des Kapitals in Produktionsmittel verwandelt werden. Damit das variable Kapital funktionire, muss konstantes Kapital in entsprechenden Proportionen, je nach dem bestimmten technologischen Charakter des Arbeitsprozesses, vorgeschossen werden. Der Umstand jedoch, dass man zu einem chemischen Prozess Retorten und andre Gefässe braucht, verhindert nicht bei der Analyse von der Retorte selbst zu abstrahiren. Sofern Werthschöpfung und Werthveränderung für sich selbst, d. h. rein betrachtet werden, liefern die Produktionsmittel, diese stofflichen Gestalten des konstanten Kapitals, nur den Stoff, worin sich die flüssige, werthbildende Kraft fixiren kann. Die Natur dieses Stoffes ist daher auch gleichgültig, ob Baumwolle oder Eisen. Auch der Werth dieses Stoffes ist gleichgültig. Er muss nur in hinreichender Masse vorhanden sein, um das während des Produktionsprozesses zu verausgabende Arbeitsquantum einsaugen zu können. Diese Masse gegeben, mag ihr Werth steigen, oder fallen, oder sie mag werthlos sein, wie Erde und Meer, der Prozess der Werthschöpfung und Werthveränderung wird nicht davon berührt.
Wir setzen also zunächst den konstanten Kapitaltheil gleich Null. Das vorgeschossene Kapital reduzirt sich daher von c + v auf v, und der Produktenwerth [Formel 1] + m auf das Werthprodukt [Formel 2] . Gegeben das Werthprodukt = 180 Pfd. St., worin sich die während der ganzen Dauer des Produktionsprozesses fliessende Arbeit darstellt, so haben wir den Werth des variablen Kapitals = 90 Pfd. St. abzuziehn, um den Mehrwerth = 90 Pfd. St. zu erhalten. Die Zahl 90 Pfd. St. = m drückt hier die absolute Grösse des produzirten Mehrwerths aus. Seine proportionelle Grösse aber, also das Verhältniss, worin das variable Kapital sich verwerthet hat, ist offenbar bestimmt durch das Verhältniss des Mehrwerths zum variablen Kapital, oder ist
ausgedrückt in . Im obigen Beispiel also in
= 100 %. Diese verhältnissmässige Verwerthung des variablen Kapitals, oder die verhältnissmässige Grösse des Mehrwerths, nenne ich Rate des Mehrwerths(FN 28).
Wir haben gesehn, dass der Arbeiter während eines Abschnitts des Arbeitsprozesses nur den Werth seiner Arbeitskraft produzirt, d. h. den Werth seiner nothwendigen Lebensmittel. Da er in einem auf gesellschaftlicher Theilung der Arbeit beruhenden Zustand produzirt, produzirt er seine Lebensmittel nicht direkt, sondern, in Form einer besondern Waare, des Garns z. B., einen Werth gleich dem Werth seiner Lebensmittel, oder dem Geld, womit er sie kauft. Der Theil seines Arbeitstags, den er hierzu verbraucht, ist grösser oder kleiner, je nach dem Werth seiner durchschnittlichen täglichen Lebensmittel, also der zu ihrer Produktion erheischten durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit. Stellt die Werthgrösse dieser täglichen Lebensmittel im Durchschnitt 6 vergegenständlichte Arbeitsstunden dar, so muss der Arbeiter im Durchschnitt täglich 6 Stunden arbeiten, um sie zu produziren. Arbeitete er nicht für den Kapitalisten, sondern als unabhängiger Produzent, so müsste er, unter sonst gleichbleibenden Umständen, nach wie vor im Durchschnitt denselben aliquoten Theil des Tags arbeiten, um den Werth seiner Arbeitskraft zu produziren, und dadurch die zu seiner eignen Erhaltung oder beständigen Reproduktion nöthigen Lebensmittel zu gewinnen. Da er aber in dem Theil des Arbeitstags, worin er den Tageswerth der Arbeitskraft, sage 3 sh., produzirt, nur ein Aequivalent für ihren vom Kapitalisten bereits gezahlten Werth produzirt, also durch den neu geschaffnen Werth nur den vorgeschossenen variablen Kapitalwerth ersetzt, erscheint diese Produktion von Werth als blosse Reproduktion. Den Theil des Arbeitstags also, worin diese Reproduktion vorgeht, nenne ich nothwendige Arbeitszeit, die während derselben verausgabte Arbeit nothwen_
dige Arbeit(FN 29). Nothwendig für den Arbeiter, weil unabhängig von der gesellschaftlichen Form seiner Arbeit. Nothwendig für das Kapital und seine Welt, weil das beständige Dasein des Arbeiters ihre Basis.
Die zweite Periode des Arbeitsprozesses, die der Arbeiter über die Grenzen der nothwendigen Arbeit hinausschanzt, kostet ihm zwar Arbeit, Verausgabung von Arbeitskraft, bildet aber keinen Werth für ihn. Sie bildet Mehrwerth, der den Kapitalisten mit allem Reiz einer Schöpfung aus Nichts anlacht. Diesen Theil des Arbeitstags nenne ich Surplusarbeitszeit, und die in ihr verausgabte Arbeit: Mehrarbeit (surplus labour). So entscheidend es für die Erkenntniss des Werths überhaupt, ihn als blosse Gerinnung von Arbeitszeit, als bloss vergegenständlichte Arbeit, so entscheidend für die Erkenntniss des Mehrwerths, ihn als blosse Gerinnung von Surplusarbeitszeit, als bloss vergegenständlichte Mehrarbeit zu begreifen. Nur die Form, worin diese Mehrarbeit dem unmittelbaren Produzenten, dem Arbeiter, abgepresst wird, unterscheidet die ökonomischen Gesellschaftsformationen, z. B. die Gesellschaft der Sklaverei von der der Lohnarbeit(FN 30).
Da der Werth des variablen Kapitals = Werth der von ihm gekauf-
ten Arbeitskraft, da der Werth dieser Arbeitskraft den nothwendigen Theil des Arbeitstags bestimmt, der Mehrwerth seinerseits aber bestimmt ist durch den überschüssigen Theil des Arbeitstags, so folgt: Der Mehrwerth verhält sich zum variablen Kapital, wie die Mehrarbeit zur nothwendigen, oder die Rate des Mehrwerths =
. Beide Proportionen stellen dasselbe Verhältniss in verschiedner Form dar, das einemal in der Form vergegenständlichter, das andremal in der Form flüssiger Arbeit.
Die Rate des Mehrwerths ist daher der exakte Ausdruck für den Exploitationsgrad der Arbeitskraft durch das Kapital oder des Arbeiters durch den Kapitalisten.
Nach unsrer Annahme war der Werth des Produkts = [Formel 3] + [Formel 4] , das vorgeschossene Kapital = 500 l. Da der Mehrwerth 90 und das vorgeschossene Kapital 500, würde man nach der gewöhnlichen Art der Berechnung herausbekommen, dass die Rate des Mehrwerths (die man mit der Profitrate verwechselt) = 18 %, eine Verhältnisszahl, deren Niedrigkeit Herrn Carey und andre Harmoniker rühren möchte. In der That aber ist die Rate des Mehrwerths nicht = oder
, sondern =
, also nicht
, sondern
= 100 %, mehr als das Fünffache des scheinbaren Exploitationsgrads. Obgleich wir nun im gegebnen Fall die absolute Grösse des Arbeitstags nicht kennen, auch nicht die Periode des Arbeitsprozesses (Tag, Woche u. s. w.), endlich nicht die Anzahl der Arbeiter, die das variable Kapital von 90 l. gleichzeitig in Bewegung setzt, zeigt uns die Rate des Mehrwerths
durch ihre Konvertibilität in
genau das Verhältniss der zwei Bestandtheile des Arbeitstags zu einander. Es ist 100 %. Also arbeitete der Arbeiter die eine Hälfte des Tags für sich und die andre für den Kapitalisten.
Die Methode zur Berechnung der Rate des Mehrwerths ist also kurzgefasst diese: Wir nehmen den ganzen Produktenwerth und setzen den darin nur wiedererscheinenden constanten Kapitalwerth gleich Null. Die übrigbleibende Werthsumme ist das einzige im Bildungsprozess der Waare wirklich erzeugte Werthprodukt. Ist der Mehrwerth gegeben, so ziehn wir ihn von diesem Werthprodukt ab, um das variable Kapital zu finden. Umgekehrt, wenn letzteres gegeben und wir den Mehrwerth suchen. Sind beide gegeben, so ist nur noch die Schlussoperation zu verrichten, das Verhältniss des Mehrwerths zum variablen Kapital, , zu berechnen.
So einfach die Methode, scheint es doch passend, den Leser in die ihr zu Grunde liegende und ihm ungewohnte Anschauungsweise durch einige Beispiele einzuexerciren.
Zunächst ein Beispiel aus der Spinnindustrie. Die Data gehören dem Jahre 1860. Für unsren Zweck gleichgültige Umstände sind unterdrückt. Eine Fabrik konsumirte wöchentlich 11,500 lbs. Baumwolle, wovon 1500 Abfall. Zu 7 d. das Pfund Baumwolle, beträgt das Rohmaterial daher 336 Pfd. St. Sie setzte 10000 Spindeln in Bewegung, zu 1 Pfd. St. per Spindel = 10000 Pfd. St., wovon der jährliche Verschleiss, zu 12½ %, 1250 Pfd. St., für die Woche also 24 Pfd. St.; der wöchentliche Verschleiss der Dampfmaschine 20 Pfd. St.; die wöchentliche Ausgabe für Hilfsstoffe, Kohle, Oel u. s. w. 40 Pfd. St. Der wöchentliche Arbeitslohn betrug 70 Pfd. St. und der Verkaufspreis des lb. Garn 1⅒ sh., also der 10000 lbs. Garn wöchentlich 550 Pfd. St. Der constante Werththeil des Kapitals beträgt also 420 Pfd. St. Wir setzen ihn = 0, da er in der wöchentlichen Werthbildung nicht mitspielt. Das wirkliche wöchentliche Werthprodukt, das übrig bleibt, also = 130 Pfd. St. Wir ziehn davon das an die Arbeiter gezahlte variable Kapital von 70 Pfd. St. ab, bleibt Mehrwerth von 60 Pfd. St. Die Rate des Mehrwerths, ,
, also ungefähr 86 %. Diese Prozentzahl drückt den Exploitationsgrad der Arbeitskraft oder den Verwerthungsgrad des variablen Kapitals aus. Nehmen wir an, dass 10 Stunden in jener Fabrik im täglichen Durchschnitt gearbeitet ward, so betrug die nothwendige Arbeit ungefähr 5
, und die Mehrarbeit 4
Stunden.
Jacob giebt für das Jahr 1815, bei Annahme eines Weizenpreises von 80 sh. per Quarter, und eines Durchschnittsertrags von 22 Bushels per acre, so dass der acre 11 Pfd. St. einbringt, folgende durch vorherige Kompensation verschiedner Posten sehr mangelhafte, aber für unsern Zweck genügende Rechnung.
Werthproduktion per acre.
Der Mehrwerth, stets unter der Voraussetzung, dass Preis des Produkts = seinem Werth, wird hier unter die verschiedenen Rubriken Profit, Zins, Zehnten u. s. w. vertheilt. Diese Rubriken sind hier gleichgültig. Wir addiren sie zusammen und erhalten einen Mehrwerth von 3 l. 11 sh. Die 3 l. 19 sh. für Samen und Dünger setzen wir als constanten Kapitaltheil gleich Null. Bleibt vorgeschossenes variables Kapital von 3 l. 10 sh., an dessen Stelle ein Aequivalent von [Formel 1] produzirt worden ist. Also beträgt =
mehr als 100 %. Der Arbeiter verwendet mehr als die Hälfte seines Arbeitstags zur Produktion eines Mehrwerths, den verschiedne Personen auf verschiedne Vorwände hin unter sich vertheilen(FN 31).
Der Mehrwerth stellt sich dar in einem Mehrprodukt (surplusproduce).
Wir nahmen vorher an, dass der zwölfstündige Arbeitstag des Spinners aus 6 Stunden nothwendiger Arbeit und 6 Stunden Mehrarbeit besteht, 20 lbs. Baumwolle in 20 lbs. Garn verwandelt, und ihnen einen Werth von 6 sh. zusetzt, dass ferner 1 lb. Baumwolle 1 sh. und die während des ganzen Prozesses verzehrten Arbeitsmittel 4 sh. kosten, also Werth des Gesammtprodukts 30 sh. und der eines lb. Garn 1 sh. 6 d.
Jedes Pfund Garn stellt denselben Gebrauchswerth dar. Jedes ist
das Produkt der Verbindung desselben Rohmaterials Baumwolle mit derselben produktiven Arbeit, Spinnen, vermittelt durch dieselben Arbeitsmittel. Auch der Werth jedes einzelnen Pfundes Garn zeigt dieselbe Zusammensetzung, 1 sh. für Baumwolle, 2⅖ d. für verbrauchte Arbeitsmittel, 1⅘ d., worin nothwendige Arbeit, und 1⅘ d., worin Mehrarbeit verleiblicht ist.
Vereinzelt für sich oder als aliquote Theile des Gesammtprodukts betrachtet, bestimmte Quanta Garn bleiben stets Gebilde derselben produktiven Arbeit, des Spinnens. Unter einem andern Gesichtspunkt verändert sich dagegen die Stellung des Theilprodukts ganz und gar, je nachdem es selbstständig oder im Zusammenhang mit dem Gesammtprodukt, als Theilprodukt oder als Produkttheil betrachtet wird.
Ein Pfund Garn kostet 1 sh. 6 d., und, wir sehn vom Abfall ab, das in ihm versponnene lb. Baumwolle 1 sh., also ⅔ seines Werths. Also sind ⅔ lb. Garn = 1 lb. Baumwolle und 13⅓ lbs. Garn = 20 lbs. Baumwolle. In den 13⅓ lbs. Garn stecken zwar nur 13⅓ lbs. Baumwolle zum Werth von 13⅓ sh., aber ihr zusätzlicher Werth von 6⅔ sh. bildet ein Aequivalent für die in den überschüssigen 6⅔ lbs. Garn versponnene Baumwolle. Die 13⅓ lbs. Garn stellen also alle im Gesammtprodukt von 20 lbs. Garn versponnene Baumwolle vor, das Rohmaterial des Gesammtprodukts, aber auch weiter nichts. Es ist als ob den andern 6⅔ lbs. Garn die Wolle ausgerupft und alle Wolle des Gesammtprodukts in 13⅓ lbs. Garn zusammengepresst wäre. Dagegen sind die in den 13⅓ lbs. Garn enthaltene Spinnarbeit, und der Werththeil, den die verbrauchten Arbeitsmittel zusetzen, aus ihnen selbst entfernt und auf den neben ihnen liegenden Produkttheil von 6⅔ lbs. Garn übertragen. In derselben Weise kann ein Theil dieser übrigbleibenden 6⅔ lbs. Garn — nämlich 2⅔ lbs. — wieder als blosse Darstellung der im Gesammtprodukt vernützten Arbeitsmittel zum Werth von 4 sh. gefasst werden. Acht Zehntel des Gesammtprodukts, oder 16 lbs. Garn, obgleich leiblich, als Gebrauchswerth betrachtet, als Garn, eben so sehr Gebilde der Spinnarbeit als die restirenden des Produkts, 4 lbs. Garn, enthalten daher in diesem Zusammenhang keine Spinnarbeit, keine während des Spinnprozesses selbst eingesaugte Arbeit. Es ist als ob sie sich ohne Spinnen in Garn verwandelt und als wäre ihre Garngestalt
reiner Lug und Trug. In der That, wenn der Kapitalist sie verkauft zu 24 sh. und damit seine Produktionsmittel zurückkauft, zeigt sich, dass die 16 lbs. Garn nur verkleidete Baumwolle, Spindel, Kohle u. s. w. sind. Die übrigbleibenden 4 lbs. Garn enthalten jetzt ihrerseits kein Atom von Rohmaterial und Arbeitsmittel. Was davon in ihnen steckte, ward bereits ausgeweidet und den ersten 16 lbs. Garn einverleibt. Die 4 lbs. Garn enthalten daher kein Atom der in der Produktion von Baumwolle, Maschinerie, Kohle u. s. w. verausgabten Arbeit. Ihr Werth von 6 sh. ist reine Materiatur der vom Spinner selbst verausgabten 12 Arbeitsstunden. Die im Produkt von 20 lbs. Garn verkörperte Spinnarbeit ist jetzt konzentrirt auf 4 lbs. Garn, auf ⅕ des Produkts. Es ist als ob der Spinner diess Gespinnst von 4 lbs. in der Luft gewirket oder in Baumwolle und mit Spindeln, die, ohne Zuthat menschlicher Arbeit, von Natur vorhanden, dem Produkt keinen Werth zusetzen. Von diesen 4 lbs. Garn endlich verkörpert eine Hälfte bloss nothwendige Arbeit von 6 Stunden, die andere — die letzten 2 lbs. Garn — bloss Mehrarbeit. Nur dieser letzte Theil des Gesammtprodukts bildet das Mehrprodukt.
Das Gesammtprodukt von 20 lbs. Garn kann also folgendermassen zerfällt werden: Gesammtprodukt von 20 lbs. Garn, werth 30 sh.
Von dem Gesammtprodukt von 20 lbs. Garn vertreten 16 lbs. oder ⅘ nur constantes Kapital, dagegen bloss ⅕ oder 4 lbs. die im Spinnprozess selbst verausgabte Arbeit. Und dennoch bilden die 20 lbs. Garn das Produkt der zwölfstündigen Spinnarbeit. Hier erscheint wieder der Unterschied von Arbeitsprozess und Verwerthungsprozess. Es wiederholt sich das bereits Bekannte, dass der Werth des Produkts des Arbeitstags,
d. h. der Produktenwerth, grösser ist als das tägliche Werthprodukt. So ist der Werth der täglich produzirten 20 lbs. Garn = 30 sh., aber ihr während des Tags produzirter Werththeil nur = 6 sh. Die eben gegebne Darstellung unterscheidet sich von der früheren dadurch, dass die funktionell oder begrifflich unterschiednen Bestandtheile des Produktenwerths in proportionellen Theilen des Produkts selbst ausgedrückt werden.
Diese Zerfällung des Produkts — des Resultats des Produktionsprozesses — in ein Quantum Produkt, das nur die in den Produktionsmitteln enthaltene Arbeit, ein andres Quantum, das nur die im Produktionsprozess zugesetzte nothwendige Arbeit, und ein letztes Quantum Produkt, das nur die im selben Prozess zugesetzte Mehrarbeit darstellt, ist eben so einfach als wichtig, wie ihre spätere Anwendung auf verwickelte und noch ungelöste Probleme zeigen wird.
Wir betrachteten eben das Gesammtprodukt als fertiges Resultat des zwölfstündigen Arbeitstags. Wir können es aber auch in seinem Entstehungsprozess begleiten, und dennoch die Theilprodukte als funktionell unterschiedne Produktentheile darstellen.
Der Spinner produzirt in 12 Stunden 20 lbs. Garn, daher in einer Stunde 1⅔ und in 8 Stunden 13⅓ lbs., also ein Theilprodukt vom Gesammtwerth der Baumwolle, die während des ganzen Arbeitstags versponnen wird. In derselben Art und Weise ist das Theilprodukt der folgenden Stunde und 36 Minuten = 2⅔ lbs. Garn und stellt daher den Werth der während der 12 Arbeitsstunden vernutzten Produktionsmittel dar. Ebenso produzirt der Spinner in der folgenden Stunde und 12 Minuten 2 lbs. Garn = 3 sh., ein Produktenwerth gleich dem ganzen Werthprodukt, das er in 6 Stunden nothwendiger Arbeit schafft. Endlich produzirt er in den letzten Stunden ebenfalls 2 lbs. Garn, deren Werth gleich dem durch seine halbtägige Mehrarbeit erzeugten Mehrwerth. Diese Art Berechnung dient dem englischen Fabrikanten zum Hausgebrauch und er wird z. B. sagen, dass er in den ersten 8 Stunden oder ⅔ des Arbeitstags seine Baumwolle herausschlägt u. s. w. Man sieht, die Formel ist richtig, in der That die erste Formel, übersetzt aus dem Raum, wo die Theile des Produkts fertig neben einander liegen, in die Zeit, wo sie auf einander folgen. Die Formel kann
aber auch von sehr barbarischen Vorstellungen begleitet sein, namentlich in Köpfen, die eben so praktisch im Verwerthungsprozess interessirt sind, als sie ein Interesse haben, ihn theoretisch misszuverstehen. So kann sich eingebildet werden, dass unser Spinner z. B. in den ersten 8 Stunden seines Arbeitstags den Werth der Baumwolle, in der folgenden Stunde und 36 Minuten den Werth der verzehrten Arbeitsmittel, in der folgenden Stunde und 12 Minuten den Werth des Arbeitslohns produzirt oder ersetzt, und nur die vielberühmte „ letzte Stunde“ dem Fabrikanten zur Produktion von Mehrwerth widmet. Dem Spinner wird so das doppelte Wunder aufgebürdet, Baumwolle, Spindel, Dampfmaschine, Kohle, Oel u. s. w. in demselben Augenblick zu produziren, wo er mit ihnen spinnt, und aus Einem Arbeitstag von gegebnem Intensivitätsgrad fünf solcher Tage zu machen. In unserm Fall nämlich erfordert die Produktion des Rohmaterials und der Arbeitsmittel 4 zwölfstündige Arbeitstage und ihre Verwandlung in Garn einen andern zwölfstündigen Arbeitstag. Dass die Raubgier solche Wunder glaubt und nie den doktrinären Sykophanten misst, der sie beweist, zeige folgendes Beispiel.
An einem schönen Morgen des Jahres 1836 wurde der wegen seiner ökonomischen Wissenschaft und seines „schönen Styls“ berufene Nassau W. Senior, gewissermassen der Clauren unter den englischen Oekonomen, von Oxford nach Manchester citirt, um statt in Oxford politische Oekonomie zu lehren, sie in Manchester zu lernen. Die Fabrikanten erkiesten ihn zum Preisfechter gegen den neulich erlassenen Factory Act und die darüber noch hinausstrebende Zehnstundenagitation. Mit gewohntem praktischen Scharfsinn hatten sie erkannt, dass der Herr Professor „wanted a good deal of finishing“. Sie verschrieben ihn daher nach Manchester. Der Herr Professor seinerseits hat die zu Manchester von den Fabrikanten erhaltene Lektion stylisirt in dem Pamphlet: „ Letters on the Factory Act, as it affects the cotton manufacture. London 1837.“ Hier kann man u. a. folgendes Erbauliche lesen:
„Unter dem gegenwärtigen Gesetz kann keine Fabrik, die Personen unter 18 Jahren beschäftigt, länger als 11½ Stunden täglich arbeiten, d. h. 12 Stunden während der ersten 5 Tage und 9 Stunden am Sonnabend. Die folgende Analyse (!) zeigt nun, dass in einer solchen Fabrik der ganze Reingewinn von der letzten Stunde
abgeleitet ist. Ein Fabrikant legt 100,000 Pfd. St. aus — 80,000 Pfd. St. in Fabrikgebäude und Maschinen, 20,000 in Rohmaterial und Arbeitslohn. Das jährliche Einkommen der Fabrik, vorausgesetzt das Kapital schlage jährlich einmal um, und der Bruttogewinn betrage 15 %, muss sich auf Waaren zum Werth von 115,000 Pfd. St. belaufen … Von diesen 115,000 Pfd. St. produzirt jede der 23 halben Arbeitsstunden täglich oder
. Von diesen
Arbeitsstunden, die das Ganze der 115,000 Pfd. St. bilden (constituting the whole 115,000 Pd. St.), ersetzen
, d. h. 100,000 von den 115,000, nur das Kapital;
oder 5000 Pfd. St. von den 15,000 Brutto-Gewinn (!) ersetzen die Abnutzung der Fabrik und Maschinerie. Die übrigbleibenden
, die beiden letzten halben Stunden jeden Tags produziren den Reingewinn von 10 %. Wenn daher bei gleichbleibenden Preisen die Fabrik 13 Stunden statt 11½ arbeiten dürfte, so würde, mit einer Zulage von ungefähr 2600 Pfd. St. zum cirkulirenden Kapital, der Reingewinn mehr als verdoppelt werden. Andrerseits wenn die Arbeitsstunden täglich um 1 Stunde reducirt würden, würde der Reingewinn verschwinden, wenn um 1½ Stunden, auch der Bruttogewinn(FN 32)!“
Und das nennt der Herr Professor eine „ Analyse!“ Glaubte er den Fabrikantenjammer, dass die Arbeiter die beste Zeit des Tags in der Produktion, daher der Reproduktion oder dem Ersatz des Werths von Baulichkeiten, Maschinen, Baumwolle, Kohle u. s. w. vergeuden, so war jede Analyse überflüssig. Er hatte einfach zu antworten: Meine Herren! Wenn Ihr 10 Stunden arbeiten lasst statt 11½, wird, unter
sonst gleichbleibenden Umständen, der tägliche Verzehr von Baumwolle, Maschinerie u. s. w. um 1½ Stunden abnehmen. Ihr gewinnt also grade so viel als Ihr verliert. Eure Arbeiter werden in Zukunft 1½ Stunden weniger für Reproduktion oder Ersatz des vorgeschossenen Kapitalwerths vergeuden. Glaubte er ihnen nicht aufs Wort, sondern hielt als Sachverständiger eine Analyse für nöthig, so musste er vor allem, in einer Frage, die sich ausschliesslich um das Verhältniss des Reingewinns zur Grösse des Arbeitstags dreht, die Herren Fabrikanten ersuchen, Maschinerie und Fabrikgebäude, Rohmaterial und Arbeit nicht kunterbunt durcheinander zu wirren, sondern gefälligst das in Fabrikgebäude, Maschinerie, Rohmaterial u. s. w. enthaltene constante Kapital auf die eine, das in Arbeitslohn vorgeschossene Kapital auf die andere Seite zu stellen. Ergab sich dann etwa, dass nach der Fabrikantenrechnung der Arbeiter in des Arbeitstags, oder in einer Stunde, den Arbeitslohn reproduzirt oder ersetzt, so hatte der Analytiker fortzufahren:
Nach Eurer Angabe produzirt der Arbeiter in der vorletzten Stunde seinen Arbeitslohn und in der letzten Euren Mehrwerth oder den Reingewinn. Da er in gleichen Zeiträumen gleiche Werthe produzirt, hat das Produkt der vorletzten Stunde denselben Werth wie das der letzten. Er produzirt ferner nur Werth, so weit er Arbeit verausgabt, und das Quantum seiner Arbeit ist gemessen durch seine Arbeitszeit. Diese beträgt nach Eurer Angabe 11½ Stunden per Tag. Einen Theil dieser 11½ Stunden verbraucht er zur Produktion oder zum Ersatz seines Arbeitslohns, den andern zur Produktion Eures Reingewinns. Weiter thut er nichts während des Arbeitstags. Da aber, nach Angabe, sein Lohn und der von ihm gelieferte Mehrwerth gleich grosse Werthe sind, produzirt er offenbar seinen Arbeitslohn in 5¾ Stunden und Euren Reingewinn in andern 5¾ Stunden. Da ferner der Werth des zweistündigen Garnprodukts gleich der Werthsumme seines Arbeitslohns plus Eures Reingewinns ist, muss dieser Garnwerth durch 11½ Arbeitsstunden gemessen sein, das Produkt der vorletzten Stunde durch 5¾ Arbeitsstunden, das der letzten ditto. Wir kommen jetzt zu einem häklichen Punkt. Also aufgepasst! Die vorletzte Arbeitsstunde ist eine gewöhnliche Arbeitsstunde wie die erste. Ni plus, ni moins. Wie kann der Spinner daher in Einer Arbeitsstunde einen Garnwerth produziren, der 5¾ Arbeitsstunden darstellt? Er verrichtet in der That
kein solches Wunder. Was er in Einer Arbeitsstunde an Gebrauchswerth produzirt, ist ein bestimmtes Quantum Garn. Der Werth dieses Garns ist gemessen durch 5¾ Arbeitsstunden, wovon 4¾ ohne sein Zuthun in den stündlich verzehrten Produktionsmitteln, Baumwolle, Maschinerie u. s. w. stecken, oder eine Stunde von ihm selbst zugesetzt ist. Da also sein Arbeitslohn in 5¾ Stunden produzirt wird und in dem Garnprodukt Einer Spinnstunde ebenfalls 5¾ Stunden stecken, ist es durchaus keine Hexerei, dass das Werthproduktseiner 5¾ Spinnstunden gleich dem Produktenwerth Einer Spinnstunde. Ihr seid aber durchaus auf dem Holzweg, wenn Ihr meint, er verliere ein einziges Zeitatom seines Arbeitstags mit der Reproduktion oder dem „ Ersatz“ der Werthe von Baumwolle, Maschinerie u. s. w. Dadurch dass seine Arbeit aus Baumwolle und Spindel Garn macht, dadurch dass er spinnt, geht der Werth von Baumwolle und Spindel von selbst auf das Garn über. Es ist diess der Qualität seiner Arbeit geschuldet, nicht ihrer Quantität. Allerdings wird er in einer Stunde mehr Baumwollwerth u. s. w. auf Garn übertragen als in ½ Stunde, aber nur weil er in 1 Stunde mehr Baumwolle verspinnt als in ½. Ihr begreift also: Euer Ausdruck, der Arbeiter produzirt in der vorletzten Stunde den Werth seines Arbeitslohns und in der letzten den Reingewinn, heisst weiter nichts, als dass in dem Garnprodukt von zwei Stunden seines Arbeitstags, ob sie vorn oder hinten stehen, 11½ Arbeitsstunden verkörpert sind, grade so viel Stunden als sein ganzer Arbeitstag zählt. Und der Ausdruck, dass er in den ersten 5¾ Stunden seinen Arbeitslohn und in den letzten 5¾ Stunden Euren Reingewinn produzirt, heisst wieder nichts, als dass Ihr die ersten 5¾ Stunden zahlt und die letzten 5¾ Stunden nicht zahlt. Ich spreche von Zahlung der Arbeit, statt der Arbeitskraft, um Euren slang zu reden. Vergleicht Ihr Herren nun das Verhältniss der Arbeitszeit, die Ihr zahlt, zur Arbeitszeit, die Ihr nicht zahlt, so werdet Ihr finden, dass es halber Tag zu halbem Tag ist, also 100 %, was allerdings ein artiger Prozentsatz. Es unterliegt auch nicht dem geringsten Zweifel, dass wenn Ihr Eure „Hände“ statt 11½ Stunden 13 schanzen lasst, und, was Euch so ähnlich sieht, wie ein Ei dem andern, die überschüssigen 1½ Stunden zur blossen Mehrarbeit schlagt, letztere von 5¾ Stunden auf 7¼ Stunden wachsen wird, die Rate des Mehr
werths daher von 100 % auf 126 %. Dagegen seid Ihr gar zu tolle Sanguiniker, wenn Ihr hofft, sie werde durch den Zusatz von 1½ Stunden von 100 auf 200 % und gar auf mehr als 200 % steigen, d. h. sich „mehr als verdoppeln“. Andrerseits — des Menschen Herz ist ein wunderlich Ding, namentlich wenn der Mensch sein Herz im Beutel trägt, — seid Ihr gar zu verrückte Pessimisten, wenn Ihr fürchtet, mit der Reduktion des Arbeitstags von 11½ auf 10½ Stunden werde Euer ganzer Reingewinn in die Brüche gehn. Bei Leibe nicht. Alle andern Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt, wird die Mehrarbeit von 5¾ auf 4¾ Stunden fallen, was immer noch eine ganz erkleckliche Rate des Mehrwerths giebt, nämlich 82
%. Die verhängnissvolle „ letzte Stunde“ aber, von der Ihr mehr gefabelt habt als die Chiliasten vom Weltuntergang, ist „all bosh“. Ihr Verlust wird weder Euch den „ Reingewinn“ noch den von Euch verarbeiteten Kindern beiderlei Geschlechts die „ Seelenreinheit“ kosten(FN 32a). Wenn einmal Euer „ letztes Stünd-
lein“ wirklich schlägt, denkt an den Professor von Oxford. Und nun: In einer bessern Welt wünsch’ ich mir mehr von Eurem werthen Umgang. Adio(FN 33)! ‥ Das Signal der von Senior 1836 entdeckten „ letzten Stunde“ ward am 15. April 1848, polemisch gegen das Zehnstundengesetz, von James Wilson, einem der ökonomischen Hauptmandarine, im „London Economist“ von neuem geblasen.
Wie die Rate des Mehrwerths bestimmt ist durch das Verhältniss des Mehrwerths, nicht zur Gesammtsumme des vorgeschossenen Kapitals, sondern zu seinem in Arbeitskraft ausgelegten, variablen Bestandtheil, so ist die Höhe des Mehrprodukts bestimmt, nicht durch sein Verhältniss zum Rest des Gesammtprodukts, sondern ausschliesslich zum Produkttheil, worin sich die nothwendige Arbeit darstellt. Wie die Produktion von Mehrwerth der bestimmende Zweck der kapitalistischen Produktion, so misst nicht die absolute Masse des Produkts, sondern allein die des Mehrprodukts, den Höhegrad des Reichthums(FN 34).
Die Summe der nothwendigen Arbeit und der Mehrarbeit, der Zeit, worin der Arbeiter nur den Werth seiner Arbeitskraft reproduzirt, und der Zeit, worin er Mehrwerth produzirt, bestimmt die absolute Grösse seiner Arbeitszeit — den Arbeitstag ( working day).
Wir gingen von der Voraussetzung aus, dass die Arbeitskraft zu ihrem Werthe gekauft und verkauft wird. Ihr Werth, wie der jeder andern Waare, wird bestimmt durch die zu ihrer Produktion nöthige Arbeitszeit. Erheischt also die Durchschnittssumme der täglichen Lebensmittel des Arbeiters zu ihrer Produktion 6 Stunden täglich, so muss er im Durchschnitt 6 Stunden per Tag arbeiten, um seine Arbeitskraft täglich zu produziren oder den in ihrem Verkauf erhaltenen Werth zu reproduziren. Der nothwendige Theil seines Arbeitstages beträgt dann 6 Stunden, und ist daher, unter sonst gleichbleibenden Umständen, eine gegebene Grösse. Aber damit ist die Grösse des Arbeitstags selbst noch nicht gegeben.
Nehmen wir an, die Linie a--------------b stelle die Dauer oder Länge der noth wendigen Arbeitszeit vor, sage 6 Stunden. Je nachdem die Arbeit über a b um 1, 3 oder 6 Stunden u. s. w. verlängert wird, erhalten wir die 3 verschiedenen Linien: [Abbildung] die drei verschiedne Arbeitstage von 7, 9 und 12 Stunden vorstellen. Die Verlängerungslinie b c stellt die Länge der Surplusarbeitszeit vor. Da der Arbeitstag = a b + b c oder a c ist, variirt er mit der variablen Grösse b c. Da uns a b gegeben ist, kann das Verhältniss von b c zu a b stets gemessen werden. Es beträgt in Arbeitstag I ⅙, in Arbeitstag II , und in Arbeitstag III
von a b. Da ferner die Proportion
die Rate des Mehrwerths bestimmt, ist letztere gegeben durch jenes Verhältniss. Sie beträgt in den drei verschiedenen Arbeitstagen respektive 16⅔, 50 und 100 %. Umgekehrt würde die Rate des Mehrwerths allein uns nicht die Grösse des Arbeitstags geben. Wäre sie z. B. gleich 100 %, so könnte der Arbeitstag 8, 10, 12stündig u. s. w. sein. Sie würde anzeigen, dass die zwei Bestandtheile des Arbeitstags, nothwendige Arbeit und Mehrarbeit, gleich gross sind, aber nicht wie gross jeder dieser Theile.
Der Arbeitstag ist also keine constante, sondern eine variable
Grösse. Einer seiner Theile ist zwar bestimmt durch die zur beständigen Reproduktion des Arbeiters selbst erheischte Arbeitszeit, aber seine Gesammtgrösse wechselt mit der Länge oder Dauer der Mehrarbeit. Der Arbeitstag ist daher bestimmbar, aber an und für sich unbestimmt(FN 35).
Obgleich nun der Arbeitstag keine feste, sondern eine fliessende Grösse ist, kann er andrerseits nur innerhalb gewisser Schranken variiren. Seine Minimalschranke ist jedoch unbestimmbar. Allerdings, setzen wir die Verlängerungslinie b c, oder die Mehrarbeit, = O, so erhalten wir eine Minimalschranke, den Theil des Tages nämlich, den der Arbeiter nothwendig zu seiner Selbsterhaltung arbeiten muss. Auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise kann die nothwendige Arbeit aber immer nur einen Theil seines Arbeitstages bilden, der Arbeitstag sich also nie auf diess Minimum verkürzen. Dagegen besitzt der Arbeitstag eine Maximalschranke. Er kann über eine gewisse Grenze hinaus nicht verlängert werden. Diese Maximalschranke ist doppelt bestimmt. Einmal durch die physische Schranke der Arbeitskraft. Ein Mensch kann während des natürlichen Tags von 24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft verausgaben und das Mass dieser Kraftverausgabung bildet ein Mass für seine physisch mögliche Arbeitszeit. So kann ein Pferd Tag aus, Tag ein, nur 8 Stunden arbeiten. Während eines Theils des Tags muss die Kraft ruhen, schlafen, während eines andern Theils hat der Mensch andere physische Bedürfnisse zu befriedigen, sich zu nähren, reinigen, kleiden u. s. w. Ausser dieser rein physischen Schranke stösst die Verlängerung des Arbeitstags auf moralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit zur Befriedigung geistiger und sozialer Bedürfnisse, deren Umfang und Zahl durch den allgemeinen Kulturzustand bestimmt sind. Die Variation des Arbeitstags bewegt sich daher innerhalb absoluter physischer und mehr oder minder relativer sozialer Schranken. Beide Schranken sind aber sehr elastischer Natur und erlauben den grössten Spielraum. So finden wir Arbeitstage von 8, 10, 12, 14, 16, 18 und mehr Stunden, also von der verschiedensten Länge.
Der Kapitalist hat die Arbeitskraft zu ihrem Tageswerth gekauft. Ihm gehört ihr Gebrauchswerth während eines Arbeitstags. Er hat also das Recht erlangt, den Arbeiter während eines Tags für sich arbeiten zu lassen. Aber was ist ein Arbeitstag(FN 36)? Jedenfalls weniger als ein natürlicher Lebenstag. Um wie viel? Der Kapitalist hat seine eigne Ansicht über diess ultima Thule, die nothwendige Schranke des Arbeitstags. Als Kapitalist ist er nur personifizirtes Kapital. Seine Seele ist die Kapitalseele. Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerthen, Mehrwerth zu schaffen, mit seinem constanten Theil, den Produktionsmitteln, die grösstmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen(FN 37). Das Kapital ist verstorbene Arbeit, die sich nur vampyrmässig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Die Zeit, während deren der Arbeiter arbeitet, ist die Zeit, während deren der Kapitalist die von ihm gekaufte Arbeitskraft consumirt(FN 38). Consumirt der Arbeiter seine disponible Zeit für sich selbst, so bestiehlt er den Kapitalisten(FN 39).
Der Kapitalist beruft sich also auf das Gesetz des Waarenaustauschs. Er, wie jeder andre Käufer, sucht den grösstmöglichen Nutzen aus dem Gebrauchswerth seiner Waare herauszuschlagen. Plötz-
lich aber erhebt sich die Stimme des Arbeiters, die im Sturm und Drang des Produktionsprozesses verstummt war:
Die Waare, die ich dir verkauft habe, unterscheidet sich von dem andern Waarenpöbel dadurch, dass ihr Gebrauch Werth schafft und grösseren Werth als sie selbst kostet. Diess war der Grund, warum du sie kauftest. Was auf deiner Seite als Verwerthung von Kapital erscheint, ist auf meiner Seite überschüssige Verausgabung von Arbeitskraft. Du und ich kennen auf dem Marktplatz nur ein Gesetz, das des Waarenaustauschs. Und der Consum der Waare gehört nicht dem Verkäufer, der sie veräussert, sondern dem Käufer, der sie erwirbt. Dir gehört daher der Gebrauch meiner täglichen Arbeitskraft. Aber vermittelst ihres täglichen Verkaufspreises muss ich sie täglich reproduziren und daher von neuem verkaufen können. Abgesehen von dem natürlichen Verschleiss durch Alter u. s. w., muss ich fähig sein, morgen mit demselben Normalzustand von Kraft, Gesundheit und Frische zu arbeiten, wie heute. Du predigst mir beständig das Evangelium der „Sparsamkeit“ und „Enthaltung“. Nun gut! Ich will wie ein vernünftiger, sparsamer Wirth mein einziges Vermögen, die Arbeitskraft, haushalten und mich jeder tollen Verschwendung derselben enthalten. Ich will täglich nur so viel von ihr flüssig machen, in Bewegung, in Arbeit umsetzen, als sich mit ihrer Normaldauer und gesunden Entwicklung verträgt. Durch massloses Verlängern des Arbeitstages kannst du in Einem Tage ein grösseres Quantum meiner Arbeitskraft flüssig machen, als ich in drei Tagen ersetzen kann. Was du so an Arbeit gewinnst, verliere ich an Arbeitssubstanz. Die Benutzung meiner Arbeitskraft und die Beraubung derselben sind ganz verschiedne Dinge. Wenn die Durchschnittsperiode, die ein Durchschnittsarbeiter bei vernünftigem Arbeitsmass leben kann, 30 Jahre beträgt, ist der Werth meiner Arbeitskraft, den du mir einen Tag in den andern zahlst, oder
ihres Gesammtwerths. Consumirst du sie aber in 10 Jahren, so zahlst du mir nur
oder nur ⅓ ihres Werths täglich und bestiehlst mich daher täglich um ⅔ des Werths meiner Waare. Du zahlst mir eintägige Arbeitskraft, wo du dreitägige verbrauchst. Das ist wider unsern Vertrag und das Gesetz des Waarenaustauschs. Ich verlange also einen Arbeitstag von normaler Länge und ich verlange ihn ohne Appell an dein Herz, denn in Geldsachen hört die Gemüthlichkeit
auf. Du magst ein Musterbürger sein, vielleicht Mitglied des Vereins zur Abschaffung der Thierquälerei und obendrein im Geruch der Heiligkeit stehen, aber dem Ding, das du mir gegenüber repräsentirst, schlägt kein Herz in seiner Brust. Was darin zu pochen scheint, ist mein eigner Herzschlag. Ich verlange den Normalarbeitstag, weil ich den Werth meiner Waare verlange, wie jeder andre Verkäufer(FN 40).
Man sieht: von ganz elastischen Schranken abgesehn, ergiebt sich aus der Natur des Waarenaustauschs selbst keine Grenze des Arbeitstags, also keine Grenze der Mehrarbeit. Der Kapitalist behauptet daher nur sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lange als möglich und wo möglich aus Einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. Andrerseits schliesst die spezifische Natur der verkauften Waare eine Schranke ihres Consums durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet daher nur sein Recht als Verkäufer, wenn er den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgrösse beschränken will. Es findet hier also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmässig durch das Gesetz des Waarenaustauschs besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt. Und so stellt sich in der Geschichte der kapitalistischen Produktion die Normirung des Arbeitstags als Kampf um die Schranken des Arbeitstags dar — ein Kampf zwischen dem Gesammtkapitalisten, d. h. der Klasse der Kapitalisten, und dem Gesammtarbeiter, oder der Arbeiterklasse.
Das Kapital, wie bereits bemerkt, hat die Mehrarbeit nicht erfunden. Ueberall, wo ein Theil der Gesellschaft das Monopol der Produktionsmittel besitzt, muss der Arbeiter, frei oder unfrei, der zu seiner Selbsterhaltung nothwendigen Arbeitszeit überschüssige Arbeitszeit zusetzen, um die Lebensmittel für die Eigner der Produktionsmittel zu produziren(FN 41), ob dieser Eigenthümer nun ein atheniensischer ϰαλος ϰἀγαϑός, ein etruskischer Theokrat, civis romanus, normännischer Baron, amerikanischer Sklavenhalter, walachischer Bojar, moderner Landlord oder Kapitalist
ist(FN 42). Indess ist klar, dass wenn in einer ökonomischen Gesellschaftsformation nicht der Tauschwerth, sondern der Gebrauchswerth des Produkts vorwiegt, die Mehrarbeit durch einen engeren oder weiteren Kreis von Bedürfnissen beschränkt, aber kein schrankenloses Bedürfniss nach Mehrarbeit durch den Charakter der Produktion selbst gegeben ist. Wo wir im Alterthume scheinbare Abweichungen von diesem Gesetz finden, bilden sie in der That seinen direktesten Beweis. Am entsetzlichsten z. B. zeigt sich hier die Ueberarbeit, wo der Tauschwerth in seiner selbstständigen Gestalt als Geld produzirt wird, in der Produktion von Gold und Silber. Gewaltsames zu Tod arbeiten ist hier die offizielle Form der Ueberarbeit. Man lese nur den Diodorus Siculus(FN 43). Wenn jedoch Völker, bei denen sich die Produktion noch in den niedrigeren Formen der Sklavenarbeit, Frohnarbeit u. s. w. bewegt, mitten in einem durch die kapitalistische Produktionsweise beherrschten Weltmarkt stehn, der den Verkauf ihrer Produkte ins Ausland zum vorwiegenden Interesse entwickelt, wird den barbarischen Greueln der Sklaverei, Leibeigenschaft u. s. w. der civilisirte Greuel der Ueberarbeit aufgepfropft. Daher bewahrte die Negerarbeit in den südlichen Staaten der amerikanischen Union einen gemässigt patriarchalischen Charakter, so lange die Produktion hauptsächlich auf den unmittelbaren Selbstbedarf gerichtet war. In dem Masse aber wie der Export der Baumwolle das Lebensinteresse jener Staaten wurde, wurde die Ueberarbeitung des Negers, hier und da die Consumtion seines Lebens in sieben Arbeitsjahren, Faktor eines berechneten und berechnenden Systems. Es galt nicht mehr eine
gewisse Masse nützlicher Produkte aus ihm gewinnen. Es galt nun der Produktion des Mehrwerths selbst. Aehnlich mit der Frohnarbeit, z. B. in den Donaufürstenthümern.
Die Vergleichung des Heisshungers nach Mehrarbeit in den Donaufürstenthümern mit demselben Heisshunger in englischen Fabriken bietet ein besondres Interesse, weil die Mehrarbeit in der Frohnarbeit eine selbstständige, sinnlich wahrnehmbare Form besitzt.
Gesetzt der Arbeitstag zähle 6 Stunden nothwendiger Arbeit und 6 Stunden Mehrarbeit. So liefert der freie Arbeiter dem Kapitalisten wöchentlich 6 × 6, oder 36 Stunden Mehrarbeit. Es ist dasselbe, als ob er 3 Tage in der Woche für sich und 3 Tage in der Woche umsonst für den Kapitalisten arbeite. Aber diess ist nicht sichtbar. Mehrarbeit und nothwendige Arbeit verschwimmen in einander. Ich kann daher dasselbe Verhältniss z. B. auch so ausdrücken, dass der Arbeiter in jeder Minute 30 Sekunden für sich und 30 für den Kapitalisten arbeitet u. s. w. Anders mit der Frohnarbeit. Die nothwendige Arbeit, die der walachische Bauer z. B. zu seiner Selbsterhaltung verrichtet, ist räumlich getrennt von seiner Mehrarbeit für den Bojaren. Die eine verrichtet er auf seinem eignen Felde, die andre auf dem herrschaftlichen Gut. Beide Theile der Arbeitszeit existiren daher selbstständig neben einander. Die Mehrarbeit ist als Frohnarbeit genau abgeschieden von der nothwendigen Arbeit. An dem quantitativen Verhältniss von Mebrarbeit und nothwendiger Arbeit ändert diese verschiedne Erscheinungsform offenbar nichts. Drei Tage Mehrarbeit in der Woche bleiben drei Tage Arbeit, die kein Aequivalent für den Arbeiter selbst bildet, ob sie Frohnarbeit heisse oder Lohnarbeit. Bei dem Kapitalisten jedoch erscheint der Heisshunger nach Mehrarbeit im Drang zu massloser Verlängerung des Arbeitstags, bei dem Bojaren einfacher in unmittelbarer Jagd auf Frohntage(FN 44).
Die Frohnarbeit war in den Donaufürstenthümern verknüpft mit Naturalrenten und sonstigem Zubehör von Leibeigenschaft, bildete aber den entscheidenden Tribut an die herrschende Klasse. Wo diess der Fall, entsprang die Frohnarbeit selten aus der Leibeigenschaft, sondern die Leibeigenschaft meist umgekehrt aus der Frohnarbeit. So in den rumäni-
schen Provinzen. Ihre ursprüngliche Produktionsweise war auf Gemeineigenthum gegründet, aber nicht auf Gemeineigenthum in slavischer oder gar indischer Form. Ein Theil der Ländereien wurde als freies Privateigenthum von den Mitgliedern der Gemeinde selbstständig bewirthschaftet, ein anderer Theil — der ager publicus — gemeinsam von ihnen bestellt. Die Produkte dieser gemeinsamen Arbeit dienten theils als Reservefonds gegen Missernten und andere Zufälle, theils als Staatsschatz zur Deckung für die Kosten von Krieg, Religion und andere Gemeindeausgaben. Im Laufe der Zeit usurpirten kriegerische und kirchliche Würdenträger mit dem Gemeineigenthum die Leistungen für dasselbe. Die Arbeit der freien Bauern auf ihrem Gemeindeland verwandelte sich in Frohnarbeit für die Diebe des Gemeindelandes. Damit entwickelten sich zugleich Leibeigenschafts-Verhältnisse, jedoch nur thatsächlich, nicht gesetzlich, bis das weltbefreiende Russland unter dem Vorwand, die Leibeigenschaft abzuschaffen, sie zum Gesetz erhob. Der Kodex der Frohnarbeit, den der russische General Kisseleff 1831 proklamirte, war natürlich von den Bojaren selbst diktirt. Russland eroberte so mit einem Schlag diese Magnaten der Donaufürstenthümer und den Beifallsklatsch des liberalen Cretinismus von ganz Europa.
Nach dem „ Règlement organique“, so heisst jener Kodex der Frohnarbeit, schuldet jeder walachische Bauer, ausser einer Masse detaillirter Naturalabgaben, dem s. g. Grundeigenthümer 1) 12 Arbeitstage überhaupt, 2) einen Tag Feldarbeit und 3) einen Tag Holzfuhre. Summa Summarum 14 Tage im Jahre. Mit tiefer Einsicht in die politische Oekonomie wird jedoch der Arbeitstag nicht in seinem ordinären Sinn genommen, sondern der zur Herstellung eines täglichen Durchschnittsprodukts nothwendige Arbeitstag, aber das tägliche Durchschnittsprodukt ist pfiffiger Weise so bestimmt, dass kein Cyklope in 24 Stunden damit fertig würde. In den dürren Worten echt russischer Ironie erklärt daher das „Règlement“ selbst, unter 12 Arbeitstagen sei das Produkt einer Handarbeit von 36 Tagen zu verstehn, unter einem Tag Feldarbeit drei Tage, und unter einem Tag Holzfuhr ebenfalls das Dreifache. Summa: 42 Frohntage. Es kommt aber hinzu die s. g. Jobagie, Dienstleistungen, die dem Grundherrn für ausserordentliche Produktionsbedürfnisse gebühren. Eine bestimmtes jährliches Quantum der Mannschaft, je nach der Anzahl der Dorfbevölkerung, ist zur Jobagie verfehmt. Diese zusätzliche Frohn-
arbeit wird für jeden walachischen Bauer auf 14 Tage geschätzt. So beträgt die vorgeschriebene Frohnarbeit 56 Arbeitstage jährlich. Das Ackerbaujahr zählt aber in der Walachei wegen des schlechten Klima’s nur 210 Tage, wovon 40 für Sonnund Feiertage, 30 durchschnittlich für Unwetter, zusammen 70 Tage ausfallen. Bleiben 140 Arbeitstage. Das Verhältniss der Frohnarbeit zur nothwendigen Arbeit, , oder 66⅔ %, drückt eine viel kleinere Rate des Mehrwerths aus als die, welche die Arbeit des englischen Agrikulturoder Fabrikarbeiters regulirt. Diess ist jedoch nur die gesetzlich vorgeschriebene Frohnarbeit. Und in noch „liberalerem“ Geist als die englische Fabrikgesetzgebung hat das „Règlement organique“ seine eigne Umgehung zu erleichtern gewusst. Nachdem es aus 12 Tagen 54 gemacht, wird das nominelle Tagwerk jedes der 54 Frohntage wieder so bestimmt, dass eine Zubusse auf die folgenden Tage fallen muss. In einem Tag z. B. soll eine Landstrecke ausgegätet werden, die zu dieser Operation, namentlich auf den Maispflanzungen, doppelt so viel Zeit erheischt. Das gesetzliche Tagwerk für einzelne Agrikulturarbeiten ist so auslegbar, dass der Tag im Monat Mai anfängt und im Monat Oktober aufhört. Für die Moldau sind die Bestimmungen noch härter. „Die zwölf Frohntage des Règlement organique“, rief ein siegtrunkener Bojar, „belaufen sich auf 365 Tage im Jahr!“(FN 45)
War das Règlement organique der Donaufürstenthümer ein positiver Ausdruck des Heisshungers nach Mehrarbeit, den jeder Paragraph legalisirt, so sind die englischen Factory Acts negative Ausdrücke desselben Heisshungers. Diese Gesetze treten dem Drang des Kapitals nach massloser Aussaugung der Arbeitskraft durch gewaltsame Beschränkung des Arbeitstags von Staatswegen entgegen, und zwar von Seiten eines Staats, den Kapitalist und Landlord beherrschen. Von einer täglich bedrohlicher anschwellenden Arbeiterbewegung abgesehn, diktirte dieselbe Nothwendigkeit die Beschränkung der Fabrikarbeit, welche den Guano auf die englischen Felder ausgoss. Dieselbe blinde Raubgier, die in dem einen Fall die Erde erschöpft, hatte in dem andern die Lebenskraft der Nation an der Wurzel ergriffen.
Periodische Epidemieen sprachen hier eben so deutlich als das abnehmende Soldatenmass in Deutschland und Frankreich(FN 46).
Der jetzt regulirende Factory Act von 1850 erlaubt für den durchschnittlichen Wochentag 10 Stunden, nämlich für die ersten 5 Wochentage 12 Stunden, von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, wovon aber ½ Stunde für Frühstück und eine Stunde für Mittagsessen gesetzlich abgehn, also 10½ Arbeitsstunden bleiben, und 8 Stunden für den Samstag, von 6 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags, wovon ½ Stunde für Frühstück abgeht. Bleiben 60 Arbeitsstunden, 10½ für die ersten 5 Wochentage, 7½ für den letzten Wochentag(FN 47). Es sind eigne Wächter des Gesetzes bestellt, die dem Ministerium des Innern direkt untergeordneten Fabrikinspektoren, deren Berichte halbjährig von Parlamentswegen veröffentlicht werden. Sie liefern also eine fortlaufende und offizielle Statistik über den Kapitalistenheisshunger nach Mehrarbeit.
Hören wir einen Augenblick die Fabrikinspektoren(FN 48).
„Der betrügerische Fabrikant beginnt die Arbeit eine Viertelstunde, manchmal früher, manchmal später, vor 6 Uhr Morgens, und schliesst sie eine Viertelstunde, manchmal früher, manchmal später, nach 6 Uhr Nachmittags. Er nimmt 5 Minuten weg vom Anfang und Ende der nominell für das Frühstück anberaumten halben Stunde, und knappt 10 Minuten ab zu Anfang und Ende der für Mittagsessen anberaumten Stunde. Samstag arbeitet er eine Viertelstunde, manchmal mehr, manchmal weniger, nach 2 Uhr Nachmittags. So beträgt sein Gewinn:
Oder 5 Stunden 40 Minuten wöchentlich, was mit 50 Arbeitswochen multiplicirt, nach Abzug von 2 Wochen für Feiertage oder gelegentliche Unterbrechungen, 27 Arbeitstage giebt(FN 49).“
„Wird der Arbeitstag täglich 5 Minuten über die Normaldaner verlängert, so giebt das 2½ Produktionstage im Jahr.(FN 50)“ „Eine zusätzliche Stunde täglich, dadurch gewonnen, dass bald hier ein Stückchen Zeit erhascht wird, bald dort ein anderes Stückchen, macht aus den 12 Monaten des Jahrs 13“(FN 51).
Krisen, worin die Produktion unterbrochen und nur „kurze Zeit“, nur während einiger Tage in der Woche, gearbeitet wird, ändern natürlich nichts an dem Trieb nach Verlängerung des Arbeitstags. Je weniger Geschäfte gemacht werden, desto grösser soll der Gewinn auf das gemachte Geschäft sein. Je weniger Zeit gearbeitet werden kann, desto mehr Surplusarbeitszeit soll gearbeitet werden. So berichten die Fabrikinspektoren über die Periode der Krise von 1857 — 1858:
„Man mag es für eine Inkonsequenz halten, dass irgendwelche Ueberarbeit zu einer Zeit stattfinde, wo der Handel so schlecht geht, aber sein schlechter Zustand spornt rücksichtslose Leute zu Ueberschreitungen; sie sichern sich so einen Extraprofit …“ „Zur selben Zeit“, sagt Leonhard Horner, „wo 122 Fabriken in meinem Distrikt ganz aufgegeben sind, 143 still stehn und alle andern kurze Zeit arbeiten, wird die Ueberarbeit über die gesetzlich bestimmte Zeit fortgesetzt(FN 52)“. „Obgleich“, sagt Herr Howell, „in den meisten Fabriken des schlechten Geschäftsstands wegen nur halbe Zeit gearbeitet wird, erhalte ich nach wie vor dieselbe Anzahl von Klagen, dass eine halbe Stunde oder ¾ Stunden täglich den Arbeitern weggeschnappt (snatched) werden durch Eingriffe in die ihnen gesetzlich gesicherten Fristen für Mahlzeit und Erholung(FN 53)“.
Dasselbe Phänomen wiederholt sich auf kleinerer Stufenleiter während der furchtbaren Baumwollkrise von 1861 bis 1865(FN 54).
„Es wird zuweilen vorgeschützt, wenn wir Arbeiter während der Speisestunden oder sonst zu ungesetzlicher Zeit am Werk ertappen, dass sie die Fabrik durchaus nicht verlassen wollen, und dass es des Zwangs bedarf, um ihre Arbeit (Reinigen der Maschinen u. s. w.) zu unterbrechen, namentlich Samstag Nachmittags. Aber wenn die „Hände“ nach Stillsetzung der Maschinerie in der Fabrik bleiben, geschieht es nur, weil ihnen zwischen 6 Uhr Morgens und 6 Uhr Abends, in den gesetzlich bestimmten Arbeitsstunden, keine Frist zur Verrichtung solcher Geschäfte gestattet worden ist(FN 55)“.
„Der durch Ueberarbeit über die gesetzliche Zeit zu machende Extraprofit scheint für viele Fabrikanten eine zu grosse Versuchung, um ihr widerstehen zu können. Sie rechnen auf die Chance nicht ausgefunden zu werden und berechnen, dass selbst im Fall der Entdeckung die Geringfügigkeit der Geldstrafen und Gerichtskosten ihnen immer noch eine Gewinnbilanz sichert(FN 56)“. „Wo die zusätzliche Zeit durch Multipli
kation kleiner Diebstähle („ a multiplication of small thefts“) im Laufe des Tages gewonnen wird, stehn den Inspektoren fast unüberwindliche Schwierigkeiten der Beweisführung im Weg(FN 57)“. Diese „ kleinen Diebstähle“ des Kapitals an der Mahl zeit und Erholungszeit der Arbeiter bezeichnen die Fabrikinspektoren auch als „petty pilferings of minutes“, Mausereien von Minuten(FN 58), „snatching a few minutes“, Wegschnappen von Minuten(FN 59), oder wie die Arbeiter es technisch heissen, „nibbling and cribbling at meal times(FN 60)“.
Man sieht, in dieser Atmosphäre ist die Bildung des Mehrwerths durch die Mehrarbeit kein Geheimniss. „Wenn Sie mir erlauben,“ sagte mir ein sehr respektabler Fabrikherr, „täglich nur 10 Minuten Ueberzeit arbeiten zu lassen, stecken Sie jährlich 1000 Pfd. St. in meine Tasche(FN 61)“. „ Zeitatome sind die Elemente des Gewinns(FN 62)“.
Nichts ist in dieser Hinsicht charakteristischer als die Bezeichnung der Arbeiter, die volle Zeit arbeiten, durch „ full times“ und die der Kinder unter 13 Jahren, die nur 6 Stunden arbeiten dürfen, als „ halftimes(FN 63)“. Der Arbeiter ist hier nichts mehr als personificirte Arbeitszeit. Alle individuellen Unterschiede lösen sich auf in die von „ Vollzeitler“ und „ Halbzeitler“.
Den Trieb nach Verlängerung des Arbeitstags, den Wehrwolfsheisshunger für Mehrarbeit, beobachteten wir bisher auf einem Gebiet, wo masslose Ausschreitungen, nicht übergipfelt, so sagt ein bürgerlicher englischer Oekonom, von den Grausamkeiten der Spanier gegen die Rothhäute Amerika’s(FN 64), das Kapital endlich an die Kette gesetzlicher
Regulation gelegt haben. Werfen wir jetzt den Blick auf einige Produktionszweige, wo die Aussaugung der Arbeitskraft entweder noch heute fessel frei ist oder es gestern noch war.
„Herr Broughton, ein County Magistrate, erklärte als Präsident eines Meetings, abgehalten in der Stadthalle von Nottingham, am 1 4. Januar 1860, dass in dem mit der Spitzenfabrikation beschäftigten Theile der städtischen Bevölkerung ein der übrigen civilisirten Welt unbekannter Grad von Leid und Entbehrung vorherrscht . . . . Um 2, 3, 4 Uhr des Morgens werden Kinder von 9—10 Jahren ihren schmutzigen Betten entrissen und gezwungen, für die nackte Subsistenz bis 10, 11, 12 Uhr Nachts zu arbeiten, während ihre Glieder wegschwinden, ihre Gestalt zusammenschrumpft, ihre Gesichtszüge abstumpfen und ihr menschliches Wesen ganz und gar in einem steinähnlichen Torpor erstarrt, dessen blosser Anblick schauderhaft ist. Wir sind nicht überrascht, dass Herr Mallet und andere Fabrikanten auftraten, um Protest gegen jede Diskussion einzulegen . . . . Das System, wie der Rev. Mr. Montagu Valpu es beschrieb, ist ein System unbeschränkter Sklaverei, Sklaverei in socialer, physischer, moralischer und intellektueller Beziehung. … Was soll man denken von einer Stadt, die ein öffentliches Meeting abhält, um zu petitioniren, dass die Arbeitszeit für Männer täglich auf 18 Stunden beschränkt werden solle! . . . . Wir deklamiren gegen die virginischen und karolinischen Pflanzer. Ist jedoch ihr Negermarkt, mit allen Schrecken der Peitsche und dem Schacher in Menschenfleisch, abscheulicher als diese langsame Menschenabschlachtung, die vor sich geht, damit Schleier und Kragen zum Vortheil von Kapitalisten fabrizirt werden(FN 65)?“
Die Töpferei (Pottery) von Staffordshire hat während der letzten 22 Jahre den Gegenstand drei parlamentarischer Untersuchungen
gebildet. Die Resultate sind niedergelegt im Bericht des Herrn Scriven von 1841 an die „Children’s Employment Commissioners“, im Bericht des Dr. Greenhow von 1860, veröffentlicht auf Befehl des ärztlichen Beamten des Privy Council ( Public Health, 3d Report, I, 102—113), endlich im Bericht des Herrn Longe von 1863, in „ First Report of the Children’s Employment Commission“ vom 13. Juni 1863. Für meine Aufgabe genügt ein kurzer Auszug aus den Zeugenaussagen der verarbeiteten Kinder, in den Berichten von 1860 und 1863. Von den Kindern mag man auf die Erwachsenen schliessen, namentlich Mädchen und Frauen, und zwar in einem Industriezweig, neben dem Baumwollspinnerei u. d. g. als ein sehr angenehmes und gesundes Geschäft erscheint(FN 66).
Wilhelm Wood, neunjährig, „war 7 Jahre 10 Monate alt, als er zu arbeiten begann.“ Er „ ran moulds“ (trug die fertig geformte Waare in die Trockenstube, um nachher die leere Form zurückzubringen) von Anfang an. Er kommt jeden Tag in der Woche um 6 Uhr Morgens und hört auf ungefähr 9 Uhr Abends. „Ich arbeite bis 9 Uhr Abends jeden Tag in der Woche. So z. B. während der letzten 7—8 Wochen.“ Also fünfzehnstündige Arbeit für ein siebenjähriges Kind! J. Murray, ein zwölfjähriger Knabe, sagt aus: „I run moulds and turn jigger (drehe das Rad). Ich komme um 6 Uhr, manchmal um 4 Uhr Morgens. Ich habe während der ganzen letzten Nacht bis diesen Morgen 8 Uhr gearbeitet. Ich war nicht im Bett seit der letzten Nacht. Ausser mir arbeiteten 8 oder 9 andre Knaben die letzte Nacht durch. Alle ausser Einem sind diesen Morgen wieder gekommen. Ich bekomme wöchentlich 3 sh. 6 d. (1 Thaler 5 Groschen). Ich bekomme nicht mehr, wenn ich die ganze Nacht durcharbeite. Ich habe in der letzten Woche zwei Nächte durchgearbeitet.“ Fernyhough, ein zehnjähriger Knabe: „Ich habe nicht immer eine ganze Stunde für das Mittagsessen; oft nur eine halbe Stunde; jeden Donnerstag, Freitag und Samstag(FN 67).“
Dr. Greenhow erklärt die Lebenszeit in den Töpferdistrikten von Stoke-upon-Trent und Wolstanton für ausserordentlich kurz.
Obgleich im Distrikt Stoke nur 30.6 %, und in Wolstanton nur 30.4 % der männlichen Bevölkerung über 20 Jahre in den Töpfereien beschäftigt sind, fällt im ersten Distrikt mehr als die Hälfte der Todesfälle an Brustkrankheiten unter Männern über 20 Jahren, und im letzteren Distrikt ungefähr ⅖, auf Töpfer. Dr. Boothroyd, praktischer Arzt zu Hanley, sagt aus: „Jede successive Generation der Töpfer ist zwerghafter und schwächer als die vorhergehende.“ Ebenso ein anderer Arzt, Herr Mc Bean: „Seit ich vor 25 Jahren meine Praxis unter den Töpfern begann, hat sich die auffallende Entartung dieser Klasse fortschreitend in Abnahme von Gestalt und Gewicht gezeigt.“ Diese Aussagen sind dem Bericht des Dr. Greenhow von 1860 entnommen(FN 68).
Aus dem Bericht der Kommissäre von 1863 Folgendes: Dr. J. T. Arledge, Oberarzt des North Staffordshire Krankenhauses, sagt: „Als eine Klasse repräsentiren die Töpfer, Männer und Frauen … eine entartete Bevölkerung, physisch und moralisch. Sie sind in der Regel verzwergt, schlecht gebaut, und oft an der Brust verwachsen. Sie altern vorzeitig und sind kurzlebig; phlegmatisch und blutlos, verrathen sie die Schwäche ihrer Konstitution durch hartnäckige Anfälle von Dyspepsie, Leberund Nierenstörungen und Rheumatismus. Vor allem aber sind sie Brustkrankheiten unterworfen, der Pneumonie, Phthisis, Bronchitis und dem Asthma. Eine Form des letztern ist ihnen eigenthümlich und bekannt unter dem Namen des Töpfer-Asthma oder der Töpfer-Schwindsucht. Skrophulose, die Mandeln, Knochen oder andre Körpertheile angreift, ist eine Krankheit von mehr als zwei Dritttheilen der Töpfer … Dass die Entartung (Degenerescence) der Bevölkerung dieses Distrikts nicht noch viel grösser ist, verdankt sie ausschliesslich der Rekrutirung aus den umliegenden Landdistrikten und den Zwischenheirathen mit gesundern Racen.“ Herr Charles Pearson, vor kurzem noch House Surgeon derselben Krankenanstalt, schreibt in einem Briefe an den Kommissär Longe u. a.: „Ich kann nur aus persönlicher Beobachtung, nicht statistisch sprechen, aber ich stehe nicht an zu versichern, dass meine Empörung wieder und wieder aufkochte bei dem Anblick dieser armen Kinder, deren Gesundheit geopfert wurde, um der Habgier ihrer Eltern und Arbeitsgeber zu fröhnen.“ Er zählt die Ursachen der Töpferkrankheiten auf und schliesst sie culminirend
ab mit „Long Hours“ („langen Arbeitsstunden“). Der Kommissionsbericht hofft, dass „eine Manufaktur von so hervorragender Stellung in den Augen der Welt nicht lange mehr den Makel tragen wird, dass ihr grosser Erfolg begleitet ist von physischer Entartung, vielverzweigten körperlichen Leiden, und frühem Tode der Arbeiterbevölkerung, durch deren Arbeit und Geschick so grosse Resultate erzielt worden sind(FN 69)“. Was von den Töpfereien in England, gilt von denen in Schottland(FN 70).
Die Manufaktur von Schwefelhölzern datirt von 1833, von der Entdeckung, den Phosphor auf die Zündruthe selbst anzubringen. Seit 1845 hat sie sich rasch in England entwickelt und von den dichtbevölkertsten Theilen Londons namentlich auch nach Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle, Glasgow verbreitet, mit ihr die Mundsperre, die ein Wiener Arzt schon 1845 als eigenthümliche Krankheit der Schwefelholzmacher entdeckte. Die Hälfte der Arbeiter sind Kinder unter 13 und junge Personen unter 18 Jahren. Die Manufaktur ist wegen ihrer Ungesundheit und Widerwärtigkeit so verrufen, dass nur der verkommenste Theil der Arbeiterklasse, halbverhungerte Wittwen u. s. w., Kinder für sie hergiebt, „zerlumpte, halb verhungerte, ganz verwahrloste und unerzogne Kinder(FN 71).“ Von den Zeugen, die Kommissär White (1863) verhörte, waren 270 unter 18 J., 40 unter 10 J., 10 nur 8 und 5 nur 6 Jahre alt. Wechsel des Arbeitstags von 12 auf 14 und 15 Stunden, Nachtarbeit, unregelmässige Mahlzeiten, meist in den Arbeitsräumen selbst, die vom Phosphor verpestet sind(FN 71). Dante würde in dieser Manufaktur seine grausamsten Höllenphantasien übertroffen finden.
In der Tapetenfabrik werden die gröberen Sorten mit Maschinen, die feineren mit der Hand (block printing) gedruckt. Die lebhaftesten Geschäftsmonate fallen zwischen Anfang Oktober und Ende April. Während dieser Periode dauert diese Arbeit häufig und fast ohne Unterbrechung von 6 Uhr Vormittags bis 10 Uhr Abends und tiefer in die Nacht.
J. Leach sagt aus: „Letzten Winter (1862) blieben von 19 Mädchen 6 weg in Folge durch Ueberarbeitung zugezogener Krankheiten. Um sie wach zu halten, muss ich sie anschreien.“ W. Duffy: „Die Kinder konnten oft vor Müdigkeit die Augen nicht aufhalten, in der That, wir selbst können es oft kaum.“ J. Lightbourne: „Ich bin 13 Jahre alt … Wir arbeiteten letzten Winter bis 9 Uhr Abends und den Winter vorher bis 10 Uhr. Ich pflegte letzten Winter fast jeden Abend vom Schmerz wunder Füsse zu schreien.“ G. Apsden: „Diesen meinen Jungen pflegte ich, als er 7 Jahre alt war, auf meinem Rücken hin und her über den Schnee zu tragen, und er pflegte 16 Stunden zu arbeiten! … Ich habe oft nieder gekniet, um ihn zu füttern, während er an der Maschine stand, denn er durfte sie nicht verlassen, oder stillsetzen.“ Smith, der geschäftsführende Associé einer ManchesterFabrik: „ Wir (er meint seine „Hände,“ die für „uns“ arbeiten) arbeiten ohne Unterbrechung für Mahlzeiten, so dass die Tagesarbeit von 10½ Stunden um 4½ Uhr Nachmittags fertig ist, und alles Spätere ist Ueberzeit(FN 72). (Ob dieser Herr Smith wohl keine Mahlzeit während 10½ Stunden zu sich nimmt?) Wir (derselbe Smith) hören selten auf vor 6 Uhr Abends (er meint mit der Konsumtion „unserer“ Arbeitskraftsmaschinen), so dass wir (iterum Crispinus) in der That das ganze Jahr durch Ueberzeit arbeiten … Die Kinder und Erwachsenen (152 Kinder und junge Personen unter 18 Jahren und 140 Erwachsene) haben gleichmässig während der letzten 18 Monate im Durchschnitt allermindestens 7 Tage und 5 Stunden in der Woche gearbeitet, oder 78½ Stunden wöchentlich. Für die 6 Wochen endend am 2. Mai dieses Jahres (1863) war der Durchschnitt höher — 8 Tage oder 84 Stunden in der Woche!“ Doch fügt derselbe Herr Smith, der dem plu-
ralis majestatis so sehr ergeben ist, schmunzelnd hinzu: „Maschinenarbeit ist leicht.“ Und so sagen die Anwender des Block Printing: „Handarbeit ist gesunder als Maschinenarbeit.“ Im Ganzen erklären sich die Herrn Fabrikanten mit Entrüstung gegen den Vorschlag, „ die Maschinen wenigstens während der Mahlzeiten still zu setzen“. „Ein Gesetz,“ sagt Herr Otley, der manager einer Tapetenfabrik in Borough, das „Arbeitsstunden von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends erlaubte, würde uns (!) sehr wohl zusagen, aber die Stunden des Factory Act von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends passen uns (!) nicht … Unsere Maschine wird während des Mittagessens (welche Grossmuth!) still gesetzt. Das Stillsetzen verursacht keinen nennenswerthen Verlust an Papier und Farbe. „Aber,“ fügt er sympathetisch hinzu, „ ich kann verstehn, dass der damit verbundene Verlust nicht geliebt wird.“ Der Kommissionsbericht meint naiv, die Furcht einiger „leitender Firmen“ Zeit, d. h. Aneignungszeit fremder Arbeitszeit, und dadurch „Profit zu verlieren,“ sei kein „hinreichender Grund,“ um Kinder unter 13 und junge Personen unter 18 Jahren während 12 — 16 Stunden ihr Mittagsmahl „verlieren zu lassen“, oder es ihnen zuzusetzen, wie man der Dampfmaschine Kohle und Wasser, der Wolle Seife, dem Rad Oel u. s. w. zusetzt, — während des Produktionsprozesses selbst, als blossen Hilfsstoff des Arbeitsmittels(FN 73).
Kein Industriezweig in England — (wir sehn von dem erst neuerdings sich bahnbrechenden Maschinenbrod ab) — hat so alterthümliche, ja, wie man aus den Dichtern der römischen Kaiserzeit ersehn kann, vorchristliche Produktionsweise bis heute beibehalten, als die Bäckerei. Aber das Kapital, wie früher bemerkt, ist zunächst gleichgültig gegen den technologischen Charakter des Arbeitsprozesses, dessen es sich bemächtigt. Es nimmt ihn zunächst, wie es ihn vorfindet.
Die unglaubliche Brodverfälschung, namentlich in London, wurde zuerst enthüllt durch das Comité des Unterhauses „ über die Verfälschung von Nahrungsmitteln“ (1855—56) und Dr. Hassall’s Schrift: „ Adulterations detected(FN 74)“. Die Folge dieser Enthüllungen war das Gesetz vom 6. August 1860: „for preventing the adulte-
ration of articles of food and drink,“ ein wirkungsloses Gesetz, da es natürlich die höchste Delikatesse gegen jeden free-trader beobachtet, der sich vornimmt durch Kauf und Verkauf gefälschter Waaren „to turn an honest penny(FN 75).“ Das Comité selbst formulirte mehr oder minder naiv seine Ueberzeugung, dass Freihandel wesentlich den Handel mit gefälschten, oder wie der Engländer es witzig nennt, „sophisticirten Stoffen“ bedeute. In der That, diese Art „ Sophistik“ versteht es besser als Protagoras schwarz aus weiss und weiss aus schwarz zu machen, und besser als die Eleaten den blossen Schein alles Realen ad oculos zu demonstriren(FN 76).
Jedenfalls hatte das Comité die Augen des Publikums auf sein „tägliches Brod“ und damit auf die Bäckerei gelenkt. Gleichzeitig erscholl in öffentlichen Meetings und Petitionen an das Parlament der Schrei der Londoner Bäckergesellen über Ueberarbeitung u. s. w. Der Schrei wurde so dringend, dass Herr H. S. Tremenheere, auch Mitglied der mehrerwähnten Kommission von 1863, zum königlichen Untersuchungskommissär bestallt wurde. Sein Bericht(FN 77), sammt Zeugenaussagen, regte das Publikum auf, nicht sein Herz, sondern seinen Magen. Der bibelfeste Engländer wusste zwar, dass der Mensch, wenn nicht durch
Gnadenwahl Kapitalist oder Landlord oder Sinekurist, dazu berufen ist, sein Brod im Schweisse seines Angesichts zu essen, aber er wusste nicht, dass er in seinem Brode täglich ein gewisses Quantum Menschenschweiss essen muss, getränkt mit Eiterbeulenausleerung, Spinnweb, schwarzen Käfer-Leichnamen und fauler deutscher Hefe, abgesehn von Alaun, Sandstein und sonstigen angenehmen mineralischen Ingredienzen. Ohne alle Rücksicht auf Seine Heiligkeit, den „Freetrade“, wurde daher die anhero „freie“ Bäckerei der Aufsicht von Staatsinspektoren unterworfen (Ende der Parlamentssitzung 1863) und durch denselben Parlamentsakt die Arbeitszeit von 9 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens für Bäckergesellen unter 18 Jahren verboten. Die letztere Klausel spricht Bände über die Ueberarbeitung in diesem uns so altväterisch anheimelnden Geschäftszweig.
„Die Arbeit eines Londoner Bäckergesellen beginnt in der Regel um 11 Uhr Nachts. Zu dieser Stunde macht er den Teig, ein sehr mühsamer Prozess, der ½ bis ¾ Stunden währt, je nach der Grösse des Gebäcks und seiner Feinheit. Er legt sich dann nieder auf das Kneetbrett, das zugleich als Deckel des Trogs dient, worin der Teig gemacht wird, und schläft ein paar Stunden mit einem Mehlsack unter dem Kopf und einem andern Mehlsack auf dem Leib. Dann beginnt eine rasche und ununterbrochene Arbeit von 4 Stunden, Werfen, Wägen, Formen, in den Ofen schieben, aus dem Ofen holen u. s. w. des Teiges. Die Temperatur eines Backhauses beträgt von 75 bis 90 Grad und in den kleinen Backhäusern eher mehr als weniger. Wenn das Geschäft Brod, Wecken u. s. w. zu machen vollbracht ist, beginnt die Vertheilung des Brods; und ein beträchtlicher Theil der Taglöhner, nachdem er die beschriebene harte Nachtarbeit vollbracht, trägt während des Tags das Brod in Körben, oder schiebt es in Karren, von Haus zu Haus und operirt dazwischen auch manchmal im Backhaus. Je nach der Jahreszeit und dem Umfang des Geschäfts endet die Arbeit zwischen 1 und 6 Uhr Nachmittags, während ein andrer Theil der Gesellen bis spät um Mitternacht im Backhaus beschäftigt ist(FN 78)“. „Während der Londoner Saison beginnen die Gesellen der Bäcker zu „vollen“ Brodpreisen im Westend regelmässig um 11 Uhr Nachts, und sind mit dem Brodbacken, unterbrochen durch einen oder zwei oft sehr
kurze Zwischenräume, bis 8 Uhr des nächsten Morgens beschäftigt. Sie werden dann bis 4, 5, 6, ja 7 Uhr zur Brodherumträgerei vernutzt oder manchmal mit Biscuitbacken im Backhaus. Nach vollbrachtem Werk geniessen sie einen Schlaf von 6, oft nur von 5 und 4 Stunden. Freitags beginnt die Arbeit stets früher, sage Abends 10 Uhr und dauert ohne Unterlass, sei es in der Zubereitung, sei es in der Colportirung des Brods, bis den folgenden Samstag Abend 8 Uhr, aber meist bis 4 oder 5 Uhr in Sonntag Nacht hinein. Auch in den vornehmen Bäckereien, die das Brod zum „vollen Preise“ verkaufen, muss wieder 4—5 Stunden am Sonntag vorbereitende Arbeit für den nächsten Tag verrichtet werden … Die Bäckergesellen der „ underselling masters“ (die das Brod unter dem vollen Preise verkaufen), und diese betragen, wie früher bemerkt, über ¾ der Londoner Bäcker, haben noch längere Arbeitsstunden, aber ihre Arbeit ist fast ganz auf das Backhaus beschränkt, da ihre Meister, die Lieferung an kleine Kramläden ausgenommen, nur in der eignen Boutique verkaufen. Gegen „Ende“ der Woche, d. h. am Donnerstag beginnt hier die Arbeit um 10 Uhr in der Nacht und dauert bis tief in Sonntag Nacht hinein(FN 79).“
Von den „underselling masters“ begreift selbst der bürgerliche Standpunkt: „die unbezahlte Arbeit der Gesellen (the unpaid labour of the men) bildet die Grundlage ihrer Konkurrenz“(FN 80). Und der „full priced baker“ denunzirt seine „underselling“ Konkurrenten der Untersuchungskommission als Diebe fremder Arbeit und Fälscher. „Sie reussiren nur durch den Betrug des Publikums und dadurch dass sie 18 Stunden aus ihren Gesellen für einen Lohn von 12 Stunden herausschlagen(FN 81).“
Die Brodfälschung und die Bildung einer Bäckerklasse, die das Brod unter dem vollen Preise verkauft, entwickelten sich in England seit Anfang des 18. Jahrhunderts, sobald der Zunftcharakter des Gewerbs verfiel und der Kapitalist in der Gestalt von Müller oder Mehlfaktor hinter
den nominellen Bäckermeister trat(FN 82). Damit war die Grundlage zur kapitalistischen Produktion, zur masslosen Verlängerung des Arbeitstages und Nachtarbeit gelegt, obgleich letztere selbst in London erst 1824 ernsthaft Fuss fasste(FN 83).
Man wird nach dem Vorhergehenden verstehn, dass der Kommissionsbericht die Bäckergesellen zu den kurzlebigen Arbeitern zählt, die, nachdem sie der unter allen Theilen der Arbeiterklasse normalen Kinderdecimation glücklich entwischt sind, selten das 42. Lebensjahr erreichen. Nichts desto weniger ist das Bäckergewerb stets mit Kandidaten überfüllt. Die Zufuhrquellen dieser „Arbeitskräfte“ für London sind Schottland, die westlichen Agrikulturdistrikte Englands und — Deutschland.
In den Jahren 1858—1860 organisirten die Bäckergesellen in Irland auf ihre eigenen Kosten grosse Meetings zur Agitation gegen die Nachtarbeit und das Arbeiten an Sonntagen. Das Publikum, z. B. auf dem Maimeeting zu Dublin, 1860, ergriff, der zündenden Natur des Irländers gemäss, überall lebhaft Partei für sie. Ausschliessliche Tagesarbeit wurde durch diese Bewegung in der That erfolgreich durchgesetzt zu Wexford, Kilkenny, Clonmel, Waterford u. s. w. „Zu Limerick, wo die Qualen der Lohngesellen bekanntermassen alles Mass überstiegen, scheiterte die Bewegung an der Opposition der Bäckermeister, namentlich der Bäcker-Müller. Das Beispiel Limerick’s führte zum Rückschritt in Ennis und Tipperary. Zu Cork, wo der öffentliche Unwille sich in der lebhaftesten Form kundgab, vereitelten die Meister die Bewegung durch den Gebrauch ihrer Macht die Gesellen an die Luft zu setzen. Zu Dublin leisteten die Meister den entschiedensten Widerstand und zwangen durch Verfolgung der Gesellen, die an der Spitze der Agitation standen, den Rest
zum Nachgeben, zur Fügung in die Nacht- und Sonntagsarbeit(FN 84).“ Die Kommission der in Irland bis an die Zähne gewaffneten englischen Regierung remonstrirt leichenbitterlich gegen die unerbittlichen Bäckermeister von Dublin, Limerick, Cork u. s. w.: „Das Comité glaubt, dass die Arbeitsstunden durch Naturgesetze beschränkt sind, die nicht ungestraft verletzt werden. Indem die Meister durch die Drohung sie fortzujagen, ihre Arbeiter zur Verletzung ihrer religiösen Ueberzeugung, zum Ungehorsam gegen das Landesgesetz und die Verachtung der öffentlichen Meinung zwingen,“ (diess letztere bezieht sich alles auf die Sonntagsarbeit), „setzen sie böses Blut zwischen Kapital und Arbeit und geben ein Beispiel, gefährlich für Religion, Moralität und öffentliche Ordnung … Das Comité glaubt, dass die Verlängerung des Arbeitstags über 12 Stunden ein usurpatorischer Eingriff in das häusliche und Privatleben des Arbeiters ist und so zu unheilvollen moralischen Resultaten führt, durch Einmischung in die Häuslichkeit eines Mannes und die Erfüllung seiner Familienpflichten als Sohn, Bruder, Gatte und Vater. Arbeit über 12 Stunden hat die Tendenz die Gesundheit des Arbeiters zu untergraben, führt zu vorzeitiger Alterung und frühem Tod und daher zum Unglück der Arbeiterfamilien, die der Vorsorge und der Stütze des Familienhaupts grade im nothwendigsten Augenblick beraubt werden“ („are deprived“)(FN 85).
Wir waren eben in Irland. Auf der andern Seite des Kanals, in Schottland, denuncirt der Ackerbauarbeiter, der Mann des Pfluges, seine 13—14stündige Arbeit, im rauhsten Klima, mit vierstündiger Zusatzarbeit für den Sonntag, (in diesem Lande der Sabbat-Heiligen!)(FN 86), während vor einer Londoner Grand Jury gleichzeitig drei Eisenbahnarbeiter stehn, ein Personencondukteur, ein Lokomotivenführer und ein Signalgeber. Ein grosses Eisenbahnunglück hat Hunderte von Passa-
gieren in die andere Welt expedirt. Die Nachlässigkeit der Eisenbahnarbeiter ist die Ursache des Unglücks. Sie erklären vor den Geschworenen einstimmig, vor 10 bis 12 Jahren habe ihre Arbeit nur 8 Stunden täglich gedauert. Während der letzten 5—6 Jahre habe man sie auf 14, 18 und 20 Stunden aufgeschraubt und bei besonders lebhaftem Zudrang der Reiselustigen, wie in den Perioden der Excursion-trains, währe sie oft ununterbrochen 40—50 Stunden. Sie seien gewöhnliche Menschen und keine Cyklopen. Auf einem gegebnen Punkt versage ihre Arbeitskraft. Torpor ergreife sie. Ihr Hirn höre auf zu denken und ihr Auge zu sehn. Der ganz und gar „respectable British Juryman“ antwortet durch ein Verdikt, das sie wegen „manslaughter“ (Todtschlag) vor die nächsten Assisen schickt, und in einem milden Anhang den frommen Wunsch äussert, die Herren Kapitalmagnaten der Eisenbahn möchten doch in Zukunft verschwenderischer im Ankauf der nöthigen Anzahl von „Arbeitskräften“ und „ enthaltsamer“ oder „ entsagender“ oder „ sparsamer“ in der Aussaugung der bezahlten Arbeitskraft sein(FN 87)!
Aus dem buntscheckigen Haufen der Arbeiter von allen Professionen, Altern, Geschlechtern, die eifriger auf uns andrängen als die Seelen der Erschlagenen auf den Odysseus, und denen man, ohne die Blaubücher unter ihren Armen, auf den ersten Blick die Ueberarbeit ansieht, greifen wir noch zwei Figuren heraus, deren frappanter Kontrast beweist, dass vor dem Kapital alle Menschen gleich sind, — eine Putzmacherin und einen Grobschmidt.
In den letzten Wochen von Juni 1863 brachten alle Londoner Tagesblätter einen Paragraph mit dem „sensational“ Aushängeschild: „ Death from simple Overwork“ (Tod von einfacher Ueberarbeit). Es handelte sich um den Tod der Putzmacherin Mary Anne Walkley, zwanzigjährig, beschäftigt in einer sehr respektablen Hofputzmanufaktur, exploitirt von einer Dame mit dem gemüthlichen Namen
Elise. Die alte oft erzählte Geschichte ward nun neuentdeckt(FN 88), dass diese Mädchen durchschnittlich 16½ Stunden, während der Saison aber oft 30 Stunden ununterbrochen arbeiten, indem ihre versagende „Arbeitskraft“ durch gelegentliche Zufuhr von Sherry, Portwein oder Kaffee flüssig erhalten wird. Und es war grade die Höhe der Saison. Es galt die Prachtkleider edler Ladies für den Huldigungsball bei der frisch importirten Prinzessin von Wales im Umsehn fertig zu zaubern. Mary Anne Walkley hatte 26½ Stunden ohne Unterlass gearbeitet zusammen mit 60 andern Mädchen, je 30 in einem Zimmer, das kaum ⅓ der nöthigen Kubikzoll Luft gewährte, während sie Nachts zwei zu zwei Ein Bett theilten in einem der Sticklöcher, worin Ein Schlafzimmer durch verschiedne Bretterwände abgepfercht ist(FN 89). Und diess war eine der besseren Putz-
machereien Londons. Mary Anne Walkley erkrankte am Freitag und starb am Sonntag, ohne, zum Erstaunen von Frau Elise, auch nur vorher das letzte Putzstück fertig zu machen. Der zu spät ans Sterbebett gerufene Arzt, Herr Keys, bezeugte vor der Coroner’s Jury in dürren Worten: „Mary Anne Walkley sei gestorben an langen Arbeitsstunden in einem überfüllten Arbeitszimmer und überengem schlechtventilirten Schlafgemache.“ Um dem Arzt eine Lektion in guter Lebensart zu geben, erklärte dagegen die „Coroner’s Jury“: „Die Hingeschiedene sei gestorben an der Apoplexie, aber es sei Grund zu fürchten, dass ihr Tod durch Ueberarbeit in einer überfüllten Werkstatt u. s. w. beschleunigt worden sei.“ Unsere „ weissen Sklaven,“ rief der Morning Star, das Organ der Freihandelsherrn Cobden und Bright, „ unsere weissen Sklaven werden in das Grab hineingearbeitet und verderben und sterben ohne Sang und Klang(FN 90)“.
„ Zu Tod arbeiten ist die Tagesordnung, nicht nur in der Werkstätte der Putzmacherinnen, sondern in tausend Plätzen, ja an jedem Platz, wo das Geschäft im Zug ist … Lasst uns den Grobschmidt als Beispiel nehmen. Wenn man den Dichtern glauben darf, giebt es keinen so lebenskräftigen, lustigen Mann als den Grobschmidt. Er erhebt sich früh und schlägt Funken vor der Sonne; er isst und trinkt und schläft wie kein andrer Mensch. Rein physisch betrachtet, befindet er sich, bei mässiger Arbeit, in der That in einer der besten menschlichen Stellungen. Aber wir folgen ihm in die Stadt, und sehn die Arbeitslast, die auf den starken Mann gewälzt wird, und welchen Rang nimmt er ein in den Sterblichkeitslisten unsres Landes? Zu Marylebone (einem der grössten Stadtviertel Londons) sterben Grobschmidte in dem Verhältniss von 31 per 1000 jährlich, oder 11 über der Durchschnittssterblichkeit erwachsener Männer in England. Die Beschäftigung, eine fast instinktive Kunst der Menschheit, an und für sich tadellos, wird durch blosse Uebertreibung der Arbeit, der Zerstörer des Mannes. Er kann so viel Hammerschläge täglich schlagen, so viel Schritte gehn, so viel Athemzüge holen, so viel Werk verrichten, und durchschnittlich sage 50 Jahre leben. Man zwingt ihn so viel mehr Schläge zu schlagen, so viel mehr Schritte zu gehn, so viel öfter des Tags zu athmen, und alles zusammen seine Lebensausgabe täglich um ein Viertel zu vermehren. Er macht den Versuch, und das Resultat ist, dass er für eine beschränkte Periode ein Viertel mehr Werk verrichtet und im 37. Jahr statt im 50. stirbt(FN 91)“.
Das konstante Kapital, die Produktionsmittel, sind, vom Standpunkt des Verwerthungsprozesses betrachtet, nur da, um Arbeit, und
mit jedem Tropfen Arbeit ein proportionelles Quantum Mehrarbeit einzusaugen. So weit sie das nicht thun, bildet ihre blosse Existenz einen negativen Verlust für den Kapitalisten, denn sie repräsentiren während der Zeit, wo sie brach liegen, nutzlosen Kapitalvorschuss, und dieser Verlust wird positiv, sobald sie während der Intervalle des Arbeitsprozesses zusätzliche Auslagen erheischen, um sie für den Wiederbeginn des Werks im Gang zu erhalten. Die Verlängerungdes Arbeitstags über die Grenzen des natürlichen Tags in die Nacht hinein wirkt nur als Palliativ, stillt nur annähernd den Vampyrdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Arbeit während aller 24 Stunden des Tags anzueignen, ist daher der immanente Trieb der kapitalistischen Produktion. Da diess aber physisch unmöglich, würden dieselben Arbeitskräfte Tag und Nacht fortwährend ausgesaugt, so bedarf es, zur Ueberwindung des physischen Hindernisses, der Abwechslung zwischen den bei Tag und bei Nacht verspeisten Arbeitskräften, eine Abwechslung, die verschiedne Methoden zulässt, z. B. so geordnet sein kann, dass ein Theil des Arbeiterpersonals eine Woche Tagdienst, Nachtdienst die andre Woche versieht u. s. w. Man weiss, dass dieses Ablösungssystem, diese Wechselwirthschaft, in der vollblütigen Jugendperiode der englischen Baumwollindustrie u. s. w. vorherrschte, und u. a. gegenwärtig in den Baumwollspinnereien von Moskau blüht. Als System existirt dieser 24stündige Produktionsprozess heute noch in vielen bis jetzt „ freien“ Industriezweigen Grossbritaniens, u. a. in den Hochöfen, Schmieden, Walzwerken und andern Metallmanufakturen von England, Wales und Schottland. Der Arbeitsprozess umfasst hier ausser den 24 Stunden der 6 Werkeltage grossentheils auch die 24 Stunden des Sonntags. Die Arbeiter bestehn aus Männern und Weibern, Erwachsenen und Kindern beiderlei Geschlechts. Das Alter der Kinder und jungen Personen durchläuft alle Zwischenstufen vom 8. (in einigen Fällen vom 6.) bis zum 18. Jahr(FN 92). In einigen Branchen arbeiten auch die Mädchen und Weiber des Nachts zusammen mit dem männlichen Personal(FN 93).
Von den allgemeinen schädlichen Wirkungen der Nachtarbeit abgesehn(FN 94), bietet die ununterbrochene, vierundzwanzigstündige Dauer des Produktionsprozesses höchst willkommene Gelegenheit die Grenze des nominellen Arbeitstags zu überschreiten. Z. B. in den vorhin erwähnten, sehr anstrengenden Industriezweigen beträgt der officielle Arbeitstag für jeden Arbeiter meist 12 Stunden, Nachtstunden oder Tagesstunden. Aber die Ueberarbeit über diese Grenze hinaus ist in vielen Fällen, um die Worte des englischen officiellen Berichts zu brauchen, „ wirklich
schauderhaft“ („truly fearful“)(FN 95). „Kein menschliches Gemüth,“ heisst es, „kann die Arbeitmasse, die nach den Zeugenaussagen durch Knaben von 9 bis 12 Jahren verrichtet wird, überdenken, ohne unwiderstehlich zum Schlusse zu kommen, dass dieser Machtmissbrauch der Eltern und Arbeitgeber nicht länger erlaubt werden darf(FN 96).“
„Die Methode Knaben überhaupt abwechselnd Tag und Nacht arbeiten zu lassen, führt, sowohl während des Geschäftsdrangs als während des gewöhnlichen Verlaufs der Dinge, zu schmählicher Verlängerung des Arbeitstags. Diese Verlängerung ist in vielen Fällen nicht nurgrausam, sondern gradezu unglaublich. Es kann nicht fehlen, dass aus einer oder der andern Ursache ein Ablösungsknabe hier und da wegbleibt. Einer oder mehrere der anwesenden Knaben, die ihren Arbeitstag bereits vollbracht, müssen dann den Ausfall gut machen. Diess System ist so allgemein bekannt, dass der manager eines Walzwerks, auf meine Frage, wie die Stelle der abwesenden Ersatzknaben ausgefüllt würde, antwortete: Ich weiss wohl, dass Sie das eben so gut wissen als ich, und er nahm keinen Anstand die Thatsache zu gestehn(FN 97).“
„In einem Walzwerke, wo der nominelle Arbeitstag für den einzelnen Arbeiter 11½ Stunden war, arbeitete ein Junge 4 Nächte jede Woche bis mindestens 8½ Uhr Abends des nächsten Tags und diess während der 6 Monate, wo er engagirt war.“ „Ein Andrer arbeitete im Alter von 9 Jahren manchmal drei zwölfstündige Ablösungstermine nacheinander, und im Alter von 10 Jahren, zwei Tage und zwei Nächte nach einander.“ „Ein Dritter, jetzt 10 Jahre, arbeitete von Morgens 6 Uhr bis 12 Uhr in die Nacht während drei Nächten und bis 9 Uhr Abends während der andren Nächte.“ „Ein Vierter, jetzt 13 Jahre, arbeitete von 6 Uhr Nachmittags bis den andern Tag 12 Uhr Mittags, während einer ganzen Woche, und manchmal drei Ablösungstermine nach einander, von Montag Morgen bis Dienstag Nacht.“ „Ein Fünfter, jetzt 12 Jahre, arbeitete in einer Eisengiesserei zu Stavely von 6 Uhr Morgens bis 12 Uhr Nachts während 14 Tagen, ist unfähig es länger zu thun.“ „ George Allinsworth, neunjährig: „Ich kam hierhin
letzten Freitag. Nächsten Tag hatten wir um 3 Uhr Morgens anzufangen. Ich blieb daher die ganze Nacht hier. Wohne 5 Meilen von hier. Schlief auf der Flur mit einem Schurzfell unter mir und einer kleinen Jacke über mir. Die zwei andern Tage war ich hier um 6 Uhr Morgens. Ja! diess ist ein heisser Platz! Bevor ich herkam, arbeitete ich ebenfalls während eines ganzen Jahres in einem Hochofen. Es war ein sehr grosses Werk, auf dem Lande. Begann auch Samstag Morgens um 3 Uhr, aber ich konnte wenigstens nach Hause schlafen gehn, weil es nah war. An andern Tagen fing ich 6 Uhr Morgens an und endete 6 oder 7 Uhr Abends u. s. w.(FN 98).“
Lasst uns nun hören, wie das Kapital selbst diess VierundzwanzigStundensystem auffasst. Die Uebertreibungen des Systems, seinen Missbrauch zur „grausamen und unglaublichen“ Verlängerung des Arbeitstags, übergeht es natürlich mit Stillschweigen. Es spricht nur von dem System in seiner „ normalen“ Form.
„Die Herren Naylor und Vickers, Stahlfabrikanten, die zwischen 600 und 700 Personen anwenden, und darunter nur 10 % unter 18 Jahren, und hiervon wieder nur 20 Knaben zum Nachtpersonal, äussern sich wie folgt: „Die Knaben leiden durchaus nicht von der Hitze. Die Temperatur ist wahrscheinlich 86° bis 90°. . . . . In den Hammerund Walzwerken arbeiten die Hände Tag und Nacht ablösungsweise, aber dahingegen ist auch alles andre Werk Tagwerk, von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. In der Schmiede wird von 12 Uhr bis 12 Uhr gearbeitet. Einige Hände arbeiten fortwährend des Nachts ohne Wechsel zwischen Tagund Nachtzeit . . . . Wir finden nicht, dass Tagoder Nachtarbeit irgend einen Unterschied in der Gesundheit (der Herren Naylor und Vickers?) macht, und wahrscheinlich schla-
fen Leute besser, wenn sie dieselbe Ruheperiode geniessen, als wenn sie wechselt . . . . Ungefähr zwanzig Knaben unter 18 Jahren arbeiten mit der Nachtmannschaft . . . . Wir könntens nicht recht thun (not well do) ohne die Nachtarbeit von Jungen unter 18 Jahren. Unser Einwurf ist — die Vermehrung der Produktionskosten . . . . Geschickte Hände und Häupter von Departements sind schwer zu haben, aber Jungens kriegt man so viel man will . . . . Natürlich, Anbetrachts der geringen Proportion von Jungen, die wir verwenden, wären Beschränkungen der Nachtarbeit von wenig Wichtigkeit oder Interesse für uns(FN 99).“
„Herr J. Ellis, von der Firma der Herren John Brown et Co., Stahlund Eisenwerke, die 3000 Männer und Jungen anwenden, und zwar für Theil der schweren Stahlund Eisenarbeit „Tag und Nacht, in Ablösungen“, erklärt, dass in den schweren Stahlwerken einer oder zwei Jungen auf zwei Männer kommen. Ihr Geschäft zählt 500 Jungen unter 18 Jahren und davon ungefähr ⅓, oder 170, unter 13 Jahren. Mit Bezug auf die vorgeschlagne Gesetzänderung meint Herr Ellis: „Ich glaube nicht, dass es sehr tadelhaft (very objectionable) wäre, keine Person unter 18 Jahren über 12 Stunden aus den 24 arbeiten zu lassen. Aber ich glaube nicht, dass man irgend eine Linie ziehen kann für die Entbehrlichkeit von Jungen über 12 Jahren für die Nachtarbeit. Wir würden sogar eher ein Gesetz annehmen, keine Jungen unter 13 Jahren oder selbst so hoch wie 14 Jahre, überhaupt zu verwenden, als ein Verbot die Jungen, die wir einmal haben, während der Nacht zu brauchen. Die Jungen, die in der Tagesreihe, müssen wechselweis auch in der Nachtreihe arbeiten, weil die Männer nicht unaufhörlich Nachtarbeit verrichten können; es würde ihre Gesundheit ruiniren. Wir glauben jedoch, dass Nachtarbeit, wenn die Woche dafür wechselt, keinen Schaden thut. (Die Herren Naylor und Vickers glaubten, übereinstimmend mit dem Besten ihres Geschäfts, umgekehrt, dass statt der fortwährenden, grade die periodisch wechselnde Nachtarbeit möglicher Weise Schaden anrichten kann.) Wir finden die Leute, die die alternirende Nachtarbeit verrichten, grade so gesund als die, die nur am Tage arbeiten . . . . Unsere Einwürfe gegen die Nichtanwendung von Jungen unter 18 Jahren zur Nachtarbeit
würden gemacht werden von wegen Vermehrung der Auslage, aber diess ist auch der einzige Grund. (Wie cynisch naiv!) Wir glauben, dass diese Vermehrung grösser wäre, als das Geschäft (the trade) mit schuldiger Rücksicht auf seine erfolgreiche Ausführung billiger Weise tragen könnte. (As the trade with dueregard to etc. could fairly bear! Welche breimäulige Phraseologie!) Arbeit ist hier rar, und könnte unzureichend werden unter einer solchen Regulation“ (d. h. Ellis, Brown et Co. könnten in die fatale Verlegenheit kommen den Werth der Arbeitskraft voll zahlen zu müssen)(FN 100).
Die „Cyklops Stahlund Eisenwerke“ der Herren Cammell et Co. werden auf derselben grossen Stufenleiter ausgeführt, wie die des besagten John Brown et Co. Der geschäftsführende Direktor hatte dem Regierungskommissär White seine Zeugenaussage schriftlich eingehändigt, fand es aber später passend, das zur Revision ihm wieder zurückgestellte Manuscript zu unterschlagen. Jedoch Herr White hat ein nachhaltiges Gedächtniss. Er erinnert sich ganz genau, dass für diese Herrn Cyklopen das Verbot der Nachtarbeit von Kindern und jungen Personen „ein Ding der Unmöglichkeit; es wäre dasselbe, als setzte man ihre Werke still“, und dennoch zählt ihr Geschäft wenig mehr als 6 % Jungen unter 18 und nur 1 % unter 13 Jahren(FN 101)!
Ueber denselben Gegenstand erklärt Herr E. F. Sanderson, von der Firma Sanderson, Bros. et Co., Stahl-Walzund Schmiedewerke, in Attercliffe: „Grosse Schwierigkeiten würden entspringen aus dem Verbot Jungen unter 18 Jahren des Nachts arbeiten zu lassen, die Hauptschwierigkeit aus der Vermehrung der Kosten, welche ein Ersatz der Knabenarbeit durch Männerarbeit nothwendig nach sich zöge. Wie viel das betragen würde, kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich wäre es nicht so viel, dass der Fabrikant den Stahlpreis erhöhen könnte, und folglich fiele der Verlust auf ihn, da die Männer (welch querköpfig Volk!) natürlich weigern würden, ihn zu tragen.“ Herr Sanderson weiss nicht, wie viel er den Kindern zahlt, aber „vielleicht beträgt es 4 bis 5 sh. per Kopf die Woche … Die Knabenarbeit ist von einer Art, wofür im Allgemeinen („generally,“ natürlich nicht immer „im Besondern“) die
Kraft der Jungens grade ausreicht, und folglich würde kein Gewinn aus der grössern Kraft der Männer fliessen, um den Verlust zu kompensire, oder doch nur in den wenigen Fällen, wo das Metall sehr schwer ist. Die Männer würden es auch minder lieben keine Knaben unter sich zu haben, da Männer minder gehorsam sind. Ausserdem müssen die Jungen jung anfangen, um das Geschäft zu lernen. Die Beschränkung der Jungen auf blosse Tagesarbeit würde diesen Zweck nicht erfüllen.“ Und warum nicht? Warum können Jungen ihr Handwerk nicht bei Tag lernen? Deinen Grund? „Weil dadurch die Männer, die in Wechselwochen bald den Tag, bald die Nacht arbeiten, von den Jungen ihrer Reihe während derselben Zeit getrennt, halb den Profit verlieren würden, den sie aus ihnen herausschlagen. Die Anleitung, die sie den Jungen geben, wird nämlich als Theil des Arbeitslohnes dieser Jungen berechnet und befähigt die Männer daher die Jungenarbeit wohlfeiler zu bekommen. Jeder Mann würde seinen halben Profit verlieren. (In andern Worten, die Herren Sanderson müssten einen Theil des Arbeitslohnes der erwachsenen Männer aus eigner Tasche, statt mit der Nachtarbeit der Jungen zahlen. Der Profit der Herren Sanderson würde bei dieser Gelegenheit etwas fallen und diess ist der Sanderson’sche gute Grund, warum Jungen ihr Handwerk nicht bei Tag lernen können(FN 102).) Ausserdem würde diess reguläre Nachtarbeit auf die Männer werfen, die nun von den Jungen abgelöst werden, und sie würden das nicht aushalten. Kurz und gut, die Schwierigkeiten wären so gross, dass sie wahrscheinlich zur gänzlichen Unterdrückung der Nachtarbeit führen würden.“ „Was die Produktion von Stahl selbst angeht,“ sagt E. F. Sanderson, „würde es nicht den geringsten Unterschied machen, aber!“ Aber die Herren Sanderson haben mehr zu thun als Stahl zu machen. Die Stahlmacherei ist blosser Vorwand der Plusmacherei. Die Schmelzöfen, Walzwerke u.s. w., die Baulichkeiten, die Maschinerie, das Eisen, die Kohle u. s. w. haben mehr zu thun als sich
in Stahl zu verwandeln. Sie sind da, um Mehrarbeit einzusaugen und saugen natürlich mehr davon in 24 Stunden als in 12 Stunden ein. Sie geben in der That von Gottes und Rechtswegen den Sandersons eine Anweisung auf die Arbeitszeit einer gewissen Anzahl von Händen für volle 24 Stunden des Tags, und verlieren ihren Kapitalcharakter, sind daher reiner Verlust für die Sandersons, sobald ihre Funktion der Arbeitseinsaugung unterbrochen wird. „ Aber dann wäre da der Verlust so viel kostspieliger Maschinerie, welche die halbe Zeit brach läge, und für eine solche Produktenmasse, wie wir fähig sind, sie bei dem gegenwärtigen System zu leisten, müssten wir Räumlichkeiten und Maschinenwerke verdoppeln, was die Auslage verdoppeln würde.“ Aber warum sollen grade diese Sandersons ein Privilegium der Arbeitsausbeutung vor den andern Kapitalisten geniessen, die nur bei Tag arbeiten lassen dürfen und deren Baulichkeiten, Maschinerie, Rohmaterial daher bei Nacht „brach“ liegen? „Es ist wahr“, antwortet E. F. Sanderson im Namen aller Sandersons, „es ist wahr, dass dieser Verlust von brachliegender Maschinerie alle Manufakturen trifft, worin nur bei Tag gearbeitet wird. Aber der Gebrauch der Schmelzöfen würde in unserem Fall einen Extraverlust verursachen. Hält man sie im Gang, so wird Brennmaterial verwüstet, (statt dass jetzt das Lebensmaterial der Arbeiter verwüstet wird) und hält man sie nicht im Gang, so setzt das Zeitverlust im Wiederanlegen des Feuers und zur Gewinnung des nöthigen Hitzegrads (während der Verlust, selbst Achtjähriger, an Schlafzeit Gewinn von Arbeitszeit für die Sandersonsippe) und die Oefen selbst würden vom Temperaturwechsel leiden“ (während doch dieselbigen Oefen nichts leiden vom Tagund Nachtwechsel der Arbeit)(FN 103).
„ Was ist ein Arbeitstag?“ Wie gross ist die Zeit, während deren das Kapital die Arbeitskraft, deren Tageswerth es zahlt, konsumiren darf? Wie weit kann der Arbeitstag verlängert werden über die zur Reproduktion der Arbeitskraft selbst nothwendige Arbeitszeit? Auf diese Fragen, man hat es gesehn, antwortet das Kapital: der Arbeitstag zählt täglich volle 24 Stunden nach Abzug der wenigen Ruhestunden, ohne welche die Arbeitskraft ihren erneuerten Dienst absolut versagt. Es versteht sich zunächst von selbst, dass der Arbeiter seinen ganzen Lebenstag durch nichts ist ausser Arbeitskraft, dass daher alle seine disponible Zeit von Natur und Rechtswegen Arbeitszeit ist, also der Selbstverwerthung des Kapitals angehört. Zeit zu menschlicher Bildung, zu geistiger Entwicklung, zur Erfüllung sozialer Funktionen, zu
geselligem Verkehr, zum freien Spiel der physischen und geistigen Leibeskräfte, selbst die Feierzeit des Sonntags — und wäre es im Lande der Sabbathheiligen(FN 104) — reiner Firlefanz! Aber in seinem masslos blinden Trieb, seinem Wehrwolfs-Heisshunger nach Mehrarbeit überrennt das Kapital nicht nur die moralischen, sondern auch die reinphysischen Maximalschranken des Arbeitstags. Es usurpirt die Zeit für Wachsthum, Entwicklung und gesunde Erhaltung des Körpers. Es raubt die Zeit, erheischt zum Verzehr von freier Luft und Sonnenlicht. Es knickert ab an der Mahlzeit und einverleibt sie, wo möglich, dem Produktionsprozess selbst, so dass dem Arbeiter als blossem Produktionsmittel Speisen zugesetzt werden, wie dem Dampfkessel Kohle und der Maschinerie Talg oder Oel. Den gesunden Schlaf zur Sammlung, Erneurung und Erfrischung der Lebenskraft reduzirt es auf so viel Stunden dumpfen Torpor als die Wiederbelebung eines absolut erschöpften Organismus unentbehrlich macht. Statt dass die normale Erhaltung der Arbeitskraft hier die Schranke des Arbeitstags, bestimmt umgekehrt die grösste täglich mögliche Verausgabung der Arbeitskraft, wie krankhaft gewaltsam und peinlich auch immer, die Schranke für die Rastzeit des Arbeiters. Das Kapital fragt nicht nach der Lebensdauer der Arbeitskraft. Was es interessirt, ist einzig und allein das Maximum von Arbeitskraft, das in einem Arbeitstag flüssig gemacht werden kann.
Es erreicht diess Ziel durch Verkürzung der Dauer der Arbeitskraft, wie ein habgieriger Landwirth gesteigerten Bodenertrag durch Beraubung der Bodenfruchtbarkeit erreicht.
Die kapitalistische Produktion, die wesentlich Produktion von Mehrwerth, Einsaugung von Mehrarbeit ist, produzirt also mit der Verlängerung des Arbeitstags nicht nur die Verkümmerung der menschlichen Arbeitskraft, die sie ihrer normalen moralischen und physischen Entwicklungsund Bethätigungsbedingungen beraubt. Sie produzirt die vorzeitige Erschöpfung und Abtödtung der Arbeitskraft selbst(FN 105). Sie verlängert die Produktionszeit des Arbeiters während eines gegebenen Termins durch Verkürzung seiner Lebenszeit.
Der Werth der Arbeitskraft schliesst aber den Werth der Waaren ein, welche zur Reproduktion des Arbeiters oder zur Fortpflanzung der Arbeiterklasse erheischt sind. Wenn also die naturwidrige Verlängerung des Arbeitstags, die das Kapital in seinem masslosen Trieb nach Selbstverwerthung nothwendig anstrebt, die Lebensperiode der einzelnen Arbeiter und damit die Dauer ihrer Arbeitskraft verkürzt, wird rascherer Ersatz der Verschlissenen nöthig, also das Eingehn grösserer Verschleisskosten in die Reproduktion der Arbeitskraft, ganz wie der täglich zu reproduzirende Werththeil einer Maschine um so grösser ist, in je kürzerer Zeit sie verschleisst. Das Kapital scheint daher durch sein eignes Interesse auf einen Normal-Arbeitstag hingewiesen.
Der Sklavenhalter kauft seinen Arbeiter, wie er sein Pferd kauft. Mit dem Sklaven verliert er ein Kapital, das durch neue Auslage auf dem Sklavenmarkt ersetzt werden muss. Aber „die Reisfelder von Georgien und die Sümpfe des Mississippi mögen fatalistisch zerstörend auf die menschliche Constitution wirken; dennoch ist diese Verwüstung von menschlichem Leben nicht so gross, dass sie nicht gut gemacht werden könnte aus den strotzenden Gehegen von Virginien und Kentucky. Oekonomische Rücksichten, die eine Art Sicherheit für die menschliche Behandlung des Sklaven bieten könnten, sofern sie das Interesse des Herrn mit der Erhaltung des Sklaven identifiziren, verwandeln sich, nach Einführung des
Sklavenhandels, umgekehrt in Gründe der extremsten Zugrunderichtung des Sklaven, denn sobald sein Platz einmal durch Zufuhr aus fremden Negergehegen ausgefüllt werden kann, wird die Dauer seines Lebens minder wichtig als dessen Produktivität, so lange es dauert. Es ist daher eine Maxime der Sklavenwirthschaft in Ländern der Sklaveneinfuhr, dass die wirksamste Oekonomie darin besteht, die grösstmöglichste Masse Leistung in möglichst kurzer Zeit dem Menschenvieh (human chattle) auszupressen. Es ist in tropischer Kultur, wo die jährlichen Profite oft dem Gesammtkapital der Pflanzungen gleich sind, dass Negerleben am rücksichtslosesten geopfert wird. Es ist die Agrikultur Westindiens, seit Jahrhunderten die Wiege fabelhaften Reichthums, die Millionen der afrikanischen Race verschlungen hat. Es ist heut zu Tage in Cuba, dessen Revenüen nach Millionen zählen, und dessen Pflanzer Fürsten sind, wo wir bei der Sklavenklasse, ausser der gröbsten Nahrung, der erschöpfendsten und unablässigsten Plackerei, einen grossen Theil durch die langsame Tortur von Ueberarbeit und Mangel an Schlaf und Erholung jährlich direkt zerstört sehn“(FN 106).
Mutato nomine de te fabula narratur! Lies statt Sklavenhandel Arbeitsmarkt, statt Kentucky und Virginien Irland und die Agrikulturdistrikte von England, Schottland und Wales, statt Afrika Deutschland! Wir hörten, wie die Ueberarbeit mit den Bäckern in London aufräumt, und dennoch ist der Londoner Arbeitsmarkt stets überfüllt mit deutschen und anderen Todeskandidaten für die Bäckerei. Die Töpferei, wie wir sahen, ist einer der kurzlebigsten Industriezweige. Fehlt es desswegen an Töpfern? Josiah Wedgwood, der Erfinder der modernen Töpferei, von Haus selbst ein gewöhnlicher Arbeiter, erklärte 1785 vor dem Hause der Gemeinen, dass die ganze Manufaktur 15 bis 20,000 Personen beschäftige(FN 107). Im Jahr 1861 betrug die Bevölkerung allein der städtischen Sitze dieser Industrie in Grossbritanien 101,302. „Die Baumwollindustrie zählt 90 Jahre . . . . In drei Generationen der englischen Race hat sie neun Generationen von Baumwollarbeitern verspeist(FN 108)“. Aller-
dings, in einzelnen Epochen fieberhaften Aufschwungs zeigte der Arbeitsmarkt bedenkliche Lücken. So z. B. 1834. Aber die Herrn Fabrikanten schlugen nun den Poor Law Commissioners vor die „Uebervölkerung“ der Ackerbaudistrikte nach dem Norden zu schicken, mit der Erklärung, dass die Fabrikanten sie absorbiren und konsumiren würden(FN 109). Diess waren ihre eigensten Worte. „Agenten wurden zu Manchester bestallt mit Einwilligung der Poor Law Commissioners. Agrikulturarbeiterlisten wurden ausgefertigt und diesen Agenten übermacht. Die Fabrikanten liefen in die Büreaus, und nachdem sie, was ihnen passte, ausgewählt, wurden die Familien vom Süden Englands verschickt. Diese Menschenpackete wurden geliefert mit Etiquetten gleich so viel Güterballen, auf Kanal und Lastwagen, — einige strolchten zu Fusse nach und viele irrten verloren und halbverhungert in den Manufakturdistrikten umher. Diess entwickelte sich zu einem wahren Handelszweig. Das Haus der Gemeinen wird es kaum glauben. Dieser regelmässige Handel, dieser Schacher in Menschenfleisch, dauerte fort, und diese Leute wurden gekauft und verkauft von den Manchester Agenten an die Manchester Fabrikanten, ganz so regelmässig wie Neger an die Baumwollpflanzer der südlichen Staaten . . . . Das Jahr 1860 bezeichnet das Zenith der Baumwollindustrie. Es fehlte wieder an Händen. Die Fabrikanten wandten sich wieder an die Fleischagenten und diese durchstöberten die Dünen von Dorset, die Hügel von Devon und die Ebenen von Wilts, aber die Uebervölkerung war bereits verspeist. Der „ Bury Guardian“ jammerte, dass 10,000 zusätzliche Hände nach Abschluss des englisch-französischen Handelsvertrags absorbirt werden könnten und bald an 30 oder 40,000 mehr nöthig sein würden. Nachdem die Agenten und Subagenten des Fleischhandels die Agrikulturdistrikte 1860 ziemlich resultatlos durchgefegt, wandte sich eine Fabrikantendeputation an Herrn Villiers, den Präsidenten des Poor Law Board, um wieder wie früher Zufuhr der Armenund Waisenkinder aus den Workhouses erlaubt zu erhalten(FN 110).“
Was die Erfahrung dem Kapitalisten im Allgemeinen zeigt, ist eine beständige Uebervölkerung, d. h. Uebervölkerung im Verhältniss
zum augenblicklichen Verwerthungsbedüfniss des Kapitals, obgleich sie aus verkümmerten, schnell hinlebenden, sich rasch verdrängenden, so zu sagen unreif gepflückten Menschengenerationen ihren Strom bildet(FN 111). Allerdings zeigt die Erfahrung dem verständigen Beobachter auf der andern Seite, wie rasch und tief die kapitalistische Produktion, die, geschichtlich gesprochen, kaum von gestern datirt, die Volkskraft an der Lebenswurzel ergriffen hat, wie die Degeneration der industriellen Bevölkerung nur durch beständige Absorption naturwüchsiger Lebenselemente vom Lande verlangsamt wird, und wie selbst die ländlichen Arbeiter, trotz freier Luft und des unter ihnen so allmächtig waltenden principle of natural selection, das nur die kräftigsten Individuen aufkommen lässt, schon abzuleben beginnen(FN 112). Das Kapital, das so „gute Gründe“ hat, die Leiden der es umgebenden Arbeitergeneration zu läugnen, wird in seiner praktischen Bewegung durch die Aussicht auf zukünftige Verfaulung der Menschheit und schliesslich doch unaufhaltsame Entvölkerung so wenig und so viel bestimmt als durch den möglichen Fall der Erde in die Sonne. In jeder Aktienschwindelei weiss jeder, dass das Unwetter einmal einschlagen muss, aber jeder hofft, dass es das Haupt seines Nächsten trifft, nachdem
er selbst den Goldregen aufgefangen und in Sicherheit gebracht hat. Après moile déluge! ist der Wahlruf jedes Kapitalisten und jeder Kapitalistennation. Das Kapital ist daher rücksichtslos gegen Gesundheit und Lebensdauer des Arbeiters, wo es nicht durch die Gesellschaft zur Rücksicht gezwungen wird(FN 113). Der Klage über physische und geistige Verkümmerung, vorzeitigen Tod, Tortur der Ueberarbeit, antwortet es: Sollte diese Qual uns quälen, da sie unsre Lust (den Profit) vermehrt? Im Grossen und Ganzen hängt diess aber auch nicht vom guten oder bösen Willen des einzelnen Kapitalisten ab. Die freie Konkurrenz macht die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion dem einzelnen Kapitalisten gegenüber als äusserliches Zwangsgesetz geltend(FN 114).
Die Festsetzung eines normalen Arbeitstags ist das Resultat eines vielhundertjährigen Kampfes zwischen Kapitalist und Arbeiter. Doch zeigt die Geschichte dieses Kampfes zwei entgegengesetzte Strömungen. Man vergleiche z. B. die englische Fabrikgesetzgebung unserer Zeit mit den englischen Arbeitsstatuten vom 14.
bis tief in die Mitte des 18. Jahrhunderts(FN 115). Während das moderne Fabrikgesetz den Arbeitstag gewaltsam abkürzt, suchen ihn jene Statute gewaltsam zu verlängern. Allerdings erscheinen die Ansprüche des Kapitals im Embryozustand, wo es erst wird, also noch nicht durch blosse Gewalt der ökonomischen Verhältnisse, sondern auch durch Hilfe der Staatsmacht sein Einsaugungsrecht eines genügenden Quantums Mehrarbeit sichert, ganz und gar bescheiden, vergleicht man sie mit den Konzessionen, die es in seinem Mannesalter knurrend und widerstrebig machen muss. Es kostet Jahrhunderte, bis der „freie“ Arbeiter, in Folge entwickelter kapitalistischer Produktionsweise, sich freiwillig dazu versteht, d. h. gesellschaftlich gezwungen ist, für den Preis seiner gewohnheitsmässigen Lebensmittel seine ganze aktive Lebenszeit, ja seine Arbeitsfähigkeit selbst, seine Erstgeburt für ein Gericht Linsen zu verkaufen. Es ist daher natürlich, dass die Verlängerung des Arbeitstags, die das Kapital von Mitte des 14. bis Ende des 17. Jahrhunderts staatsgewaltig den volljährigen Arbeitern aufzudringen sucht, ungefähr mit der Schranke der Arbeitszeit zusammenfällt, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Verwandlung von Kinderblut in Kapital hier und da von Staatswegen gezogen wird. Was heute, z. B. im Staate Massachussetts, bis jüngst dem freisten Staate der nordamerikanischen Republik, als Staatsschranke der Arbeit von Kindern unter 12 Jahren proklamirt ist, war in England noch Mitte des 17. Jahrhunderts der normale Arbeitstag vollblütiger Handwerker, robuster Ackerknechte und riesenhafter Grobschmidte(FN 116).
Das erste „ Statute of Labourers“ (23 Eduard III. 1349) fand seinen unmittelbaren Vorwand (nicht seine Ursache, denn die Gesetzgebung dieser Art dauert Jahrhunderte fort ohne den Vorwand) in der grossen Pest, welche die Bevölkerung dezimirte, so dass, wie ein Tory Schriftsteller sagt, „die Schwierigkeit Arbeiter zu raisonablen Preisen (d. h. zu Preisen, die ihren Anwendern ein raisonables Quantum Mehrarbeit liessen) an die Arbeit zu setzen, in der That unerträglich wurde(FN 117)“. Raisonable Arbeitslöhne wurden daher zwangsgesetzlich diktirt, ebenso wie die Grenze des Arbeitstags. Der letztere Punkt, der uns hier allein interessirt, ist wiederholt in dem Statut von 1496 (unter Henry VIII). Der Arbeitstag für alle Handwerker (artificers) und Ackerbauarbeiter vom März bis September sollte damals, was jedoch nie durchgesetzt wurde, dauern von 5 Uhr Morgens bis zwischen 7 und 8 Uhr Abends, aber die Stunden für Mahlzeiten betragen 1 Stunde für Frühstück, 1½ Stunden für Mittagsessen, und ½ Stunde für Vieruhrenbrod, also grade doppelt so viel als nach dem jetzt gültigen Fabrikakt(FN 118). Im Winter sollte ge-
arbeitet werden von 5 Uhr Morgens bis zum Dunkeln, mit denselben Unterbrechungen. Ein Statut der Elisabeth von 1562 für alle Arbeiter, „gedungen für Lohn per Tag oder Woche“, lässt die Länge des Arbeitstags unberührt, sucht aber die Zwischenräume zu beschränken auf 2½ Stunden für den Sommer und 2 für den Winter. Das Mittagsessen soll nur eine Stunde dauern und „der Nachmittagsschlaf von ½ Stunde“ nur zwischen Mitte Mai und Mitte August erlaubt sein. Für jede Stunde Abwesenheit soll 1 d. (etwa 10 Pfennige) vom Lohn abgehen. In der Praxis jedoch war das Verhältniss den Arbeitern viel günstiger als im Statutenbuch. Der Vater der politischen Oekonomie und gewissermassen der Erfinder der Statistik, William Petty, sagt in einer Schrift, die er im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts veröffentlichte: „Arbeiter (labouring men, eigentlich damals Ackerbauarbeiter) arbeiten 10 Stunden täglich und nehmen wöchentlich 20 Mahlzeiten ein, nämlich an Arbeitstagen täglich drei und an Sonntagen zwei; woraus man klärlich sieht, dass, wenn sie an Freitag Abenden fasten wollten und in anderthalb Stunden zu Mittag speisen wollten, während sie jetzt zu dieser Mahlzeit zwei Stunden brauchen, von 11 bis 1 Uhr Morgens, wenn sie also mehr arbeiteten und
weniger verzehrten, das Zehntel der oben erwähnten Steuer aufbringbar wäre(FN 119)“. Hatte Dr. Andrew Ure nicht Recht, die Zwölfstundenbill von 1833 als Rückgang in die Zeiten der Finsterniss zu verschreien? Allerdings gelten die in den Statuten und von Petty erwähnten Bestimmungen auch für „ apprentices“ (Lehrlinge). Wie es aber noch Ende des 17. Jahrhunderts mit der Kinderarbeit stand, ersieht man aus folgender Klage: „Unsere Jugend, hier in England, treibt gar nichts bis zu der Zeit wo sie Lehrlinge werden, und dann brauchen sie natürlich lange Zeit — sieben Jahre — um sich zu vollkommenen Handwerkern zu bilden“. Deutschland wird dagegen gerühmt, weil dort die Kinder von der Wiege auf wenigstens zu „ein bischen Beschäftigung erzogen werden“(FN 120).
Noch während des grössten Theils des 18. Jahrhunderts, bis zur Epoche der grossen Industrie, war es dem Kapital in England nicht gelungen, durch Zahlung des wöchentlichen Werths der Arbeitskraft sich der ganzen Wochenarbeit des Arbeiters, mit Ausnahme jedoch des Agrikulturarbeiters, zu bemächtigen. Der Umstand, dass sie eine ganze Woche mit dem Lohn von 4 Tagen leben konnten, schien den Arbeitern kein hinreichender Grund, auch die andren zwei Tage für den Kapitalisten zu arbeiten. Eine Seite der englischen Oekonomen denuncirte im Dienst des Kapitals diesen Eigensinn auf’s Wüthendste, eine andre Seite vertheidigte die Arbeiter. Hören wir z. B. die Polemik zwischen Postlethwaite, dessen Handels-Diktionnair damals denselben Ruf genoss wie heut zu Tage ähnliche Schriften von Mac Culloch und Mac
Gregor, und dem früher citirten Verfasser des „ Essay on Trade and Commerce“(FN 121).
Postlethwaite sagt u. a.: „Ich kann diese wenigen Bemerkungen nicht abschliessen, ohne Notiz zu nehmen von der trivialen Redensart in dem Munde zu vieler, dass wenn der Arbeiter (industrious poor) in 5 Tagen genug erhalten kann um zu leben, er nicht volle 6 Tage arbeiten will. Daher schliessen sie auf die Nothwendigkeit, selbst die nothwendigen Lebensmittel durch Steuern oder irgend welche andre Mittel zu vertheuern, um den Handwerker und Manufakturarbeiter zu unausgesetzter sechstägiger Arbeit in der Woche zu zwingen. Ich muss um die Erlaubniss bitten, andrer Meinung zu sein als diese grossen Politiker, welche für die beständige Sklaverei der Arbeiterbevölkerung dieses Königreichs („the perpetual slavery of the working people“) die Lanze einlegen; sie vergessen das Sprichwort „ all work and no play“ (nur Arbeit, und kein Spiel, macht dumm). Brüsten sich die Engländer nicht mit der Genialität und Gewandtheit ihrer Handwerker und Manufakturarbeiter, die bisher den britischen Waaren allgemeinen Kredit und Ruf verschafft haben? Welchem Umstand war diess geschuldet? Wahrscheinlich keinem andern als der Art und Weise, wie unser Arbeitsvolk, eigenlaunig, sich zu zerstreuen weiss. Wären sie gezwungen das ganze Jahr durchzuarbeiten, alle sechs Tage in der Woche, in steter Wiederholung desselben Werkes, würde das nicht ihre Genialität abstumpfen, und sie dumm-träg statt munter und gewandt machen; und
würden unsere Arbeiter in Folge solcher ewigen Sklaverei ihren Ruf nicht verlieren statt erhalten? Welche Art Kunstgeschick könnten wir erwarten von solch hart geplackten Thieren? (hard driven animals) . . . . Viele von ihnen verrichten soviel Arbeit in 4 Tagen als ein Franzose in 5 oder 6. Aber wenn Engländer ewige Schanzarbeiter sein sollen, so steht zu fürchten, dass sie noch unter die Franzosen entarten (degenerate) werden. Wenn unser Volk wegen seiner Tapferkeit im Krieg berühmt ist, sagen wir nicht, dass diess einerseits dem guten englischen Roastbeef und Pudding in seinem Leibe, andrerseits nicht minder unsrem konstitutionellen Geiste der Freiheit geschuldet ist? Und warum sollte die grössere Genialität, Energie und Gewandtheit unserer Handwerker und Manufakturarbeiter nicht der Freiheit geschuldet sein, womit sie sich in ihrer eignen Art und Weise zerstreuen? Ich hoffe, sie werden nie weder diese Privilegien verlieren, noch das gute Leben, woraus ihre Arbeitstüchtigkeit und ihr Muth gleichmässig herstammen“!(FN 122)
Darauf antwortet der Verfasser des „ Essay on Trade and Commerce“:
„Wenn es für eine göttliche Einrichtung gilt, den siebenten Tag der Woche zu feiern, so schliesst diess ein, dass die andern Wochentage der Arbeit (er meint dem Kapital, wie man gleich sehn wird) angehören, und es kann nicht grausam gescholten werden, diess Gebot Gottes zu erzwingen . . . . . Dass die Menschheit im Allgemeinen von Natur zur Bequemlichkeit und Trägheit neigt, davon machen wir die fatale Erfahrung im Betragen unsres Manufakturpöbels, der durchschnittlich nicht über 4 Tage die Wochearbeitet, ausser im Fall einer Theurung der Lebensmittel . . . . Gesetzt ein Bushel Weizen repräsentire alle Lebensmittel des Arbeiters, koste 5 sh., und der Arbeiter verdiene einen Shilling täglich durch seine Arbeit. Dann braucht er bloss 5 Tage in der Woche zu arbeiten; nur 4, wenn der Bushel 4 sh. beträgt . . . . Da aber der Arbeitslohn in diesem Königreich viel höher steht, verglichen mit dem Preise der Lebensmittel, so besitzt der Manufakturarbeiter, der 4 Tage arbeitet, einen Geldüberschuss, womit er während des Rests der Woche müssig lebt . . . . Ich hoffe, ich habe genug gesagt, um klar zu
machen, dass mässiges Arbeiten von 6 Tagen in der Woche keine Sklaverei ist. Unsere Agrikulturarbeiter thun diess und, allem Anschein nach, sind sie die Glücklichsten unter den Arbeitern (labouring poor)(FN 123), aber die Holländer thun es in den Manufakturen und scheinen ein sehr glückliches Volk. Die Franzosen thun es, so weit nicht die vielen Feiertage dazwischen kommen(FN 124) . . . . Aber unser Manufakturpöbel hat sich die fixe Idee in den Kopf gesetzt, dass sie als Engländer durch das Recht der Geburt das Privilegium besitzen, freier und unabhängiger zu sein als die Arbeiter in irgend einem andern Lande von Europa. Nun, diese Idee, so weit sie auf die Tapferkeit unserer Soldaten einwirkt, mag von einigem Nutzen sein; aber je weniger die Manufakturarbeiter davon haben, desto besser für sie selbst und den Staat. Arbeiter sollten sich nie für unabhängig von ihren Vorgesetzten („independent of their superiors“) halten . . . . Es ist ausserordentlich gefährlich, mobs in einem kommerziellen Staat wie dem unsrigen zu encouragiren, wo vielleicht 7 Theile von den 8 der Gesammtbevölkerung Leute mit wenig oder keinem Eigenthum sind(FN 125) . . . . . Die Kur wird nicht vollständig sein, bis unsre industriellen Armen sich bescheiden, 6 Tage für dieselbe Summe zu arbeiten, die sie nun in 4 Tagen verdienen“(FN 126). Zu diesem Zwecke, wie zur „Ausrottung der Faullenzerei, Ausschweifung und romantischen Freiheitsduselei“, ditto „zur Minderung der Armentaxe, Förderung des Geistes der Industrie und Herabdrückung des Arbeitspreises in den Manufakturen“, schlägt unser treuer Eckart des Kapitals das
probate Mittel vor, solche Arbeiter, die der öffentlichen Wohlthätigkeit anheimfallen, in einem Wort, paupers, einzusperren in ein „ ideales Arbeitshaus“ ( an ideal Workhouse). „Ein solches Haus muss zu einem Hause des Schreckens ( House of Terror) gemacht werden(FN 127). In diesem „ Hause des Schreckens“, diesem „ Ideal von einem Workhouse“, soll gearbeitet werden 14 Stunden täglich mit Einbegriff jedoch der passenden Mahlzeiten, so dass volle 12 Arbeitsstunden übrig bleiben“(FN 128).
Zwölf Arbeitsstunden täglich im „ Workhaus-Ideal“, im Hause des Schreckens von 1770! Drei und sechzig Jahre später, 1833, als das englische Parlament in vier Fabrikzweigen den Arbeitstag für Kinder von 13 bis 18 Jahren auf zwölf volle Arbeitsstunden herabsetzte, schien der jüngste Tag der englischen Industrie angebrochen! 1852, als L. Bonaparte bürgerlich Fuss zu fassen suchte durch Rütteln am gesetzlichen Arbeitstag, schrie das französische Arbeitervolk aus einem Munde: „Das Gesetz, das den Arbeitstag auf 12 Stunden verkürzt, ist das einzige Gut, das uns von der Gesetzgebung der Republik blieb“(FN 129)! In Zürich ist die Arbeit von Kindern über 10 Jahren auf 12 Stunden beschränkt; im Aargau wurde 1862 die Arbeit von Kindern zwischen 13 und 16 Jahren von
12½ auf 12 Stunden reducirt, in Oestreich 1860 für Kinder zwischen 14 und 16 Jahren ditto auf 12 Stunden(FN 130). Welch ein „ Fortschritt seit 1770“ würde Macaulay „mit Exultation“ aufjauchzen!
Das „ Haus des Schreckens“ für Paupers, wovon die Kapitalseele 1770 noch träumte, erhob sich wenige Jahre später als riesiges „ Arbeitshaus“ für die Manufakturarbeiter selbst. Es hiess Fabrik. Und diessmal erblasste das Ideal vor der Wirklichkeit.
Nachdem das Kapital Jahrhunderte gebraucht, um den Arbeitstag bis zu seinen normalen Maximalgrenzen und dann über diese hinaus, bis zu den Grenzen des natürlichen Tags von 12 Stunden zu verlängern(FN 131), erfolgte nun, seit der Geburt der grossen Industrie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts, eine lawinenartig gewaltsame und masslose Ueberstürzung. Jede Schranke von Sitte und
Natur, Alter und Geschlecht, Tag und Nacht, wurde zertrümmert. Selbst die Begriffe von Tag und Nacht, bäuerlich einfach in den alten Statuten, verschwammen so sehr, dass ein englischer Richter noch 1860 wahrhaft talmudistischen Scharfsinn aufbieten musste, um „urtheilskräftig“ zu erklären, was Tag und Nacht sei(FN 132). Das Kapital feierte seine Orgien.
Sobald die vom Produktionslarm übertölpelte Arbeiterklasse wieder einigermassen zur Besinnung kam, begann ihr Widerstand, zunächst im Geburtsland der grossen Industrie, in England. Während drei Decennien jedoch blieben die von ihr ertrotzten Konzessionen rein nominell. Das Parlament erliess 5 Arbeits-Akte von 1802 bis 1833, war aber so schlau keinen Pfennig für ihre zwangsmässige Ausführung, das nöthige Beamtenpersonal u. s. w. zu votiren(FN 133). Sie blieben ein todter Buchstabe. „Die Thatsache ist, dass vor dem Akt von 1833 Kinder und junge Personen abgearbeitet wurden („were worked“) die ganze Nacht, den ganzen Tag, oder beide ad libitum“(FN 134).
Erst seit dem Fabrikakt von 1833 — umfassend Baumwoll-, Wolle-, Flachsund Seidenfabriken — datirt für die moderne Industrie ein Normalarbeitstag. Nichts charakterisirt den Geist des Kapitals besser als die Geschichte der englischen Fabrikgesetzgebung von 1833 bis 1864!
Das Gesetz von 1833 erklärt, „ der gewöhnliche Fabrik
Arbeitstag solle beginnen um halb 6 Uhr Morgens und enden halb 9 Uhr Abends, und innerhalb dieser Schranken, einer Periode von 15 Stunden, solle es gesetzlich sein junge Personen (d. h. Personen zwischen 13 und 18 Jahren) zu irgend einer Zeit des Tages anzuwenden, immer vorausgesetzt, dass keine individuelle junge Person mehr als 12 Stunden innerhalb Eines Tags arbeite, mit Ausnahme gewisser speziell vorgesehner Fälle“. Die 6. Sektion des Akts bestimmt, „dass im Laufe jedes Tags jeder solchen Person von beschränkter Arbeitszeit mindestens 1½ Stunden für Mahlzeiten eingeräumt werden sollen“. Die Anwendung von Kindern unter 9 Jahren, mit später zu erwähnender Ausnahme, ward verboten, die Arbeit der Kinder von 9 bis 13 Jahren auf 8 Stunden täglich beschränkt. Nachtarbeit, d. h. nach diesem Gesetz, Arbeit zwischen halb 9 Uhr Abends und halb 6 Uhr Morgens, ward verboten für alle Personen zwischen 9 und 18 Jahren.
Die Gesetzgeber waren so weit entfernt, die Freiheit des Kapitals in Aussaugung der erwachsenen Arbeitskraft, oder, wie sie es nannten, „ die Freiheit der Arbeit“ antasten zu wollen, dass sie ein eignes System ausheckten, um solcher haarsträubenden Konsequenz des Fabrikakts vorzubeugen.
„Das grosse Uebel des Fabriksystems, wie es gegenwärtig eingerichtet ist“, heisst es im ersten Bericht des Centralraths der Kommission vom 25. Juni 1833, „besteht darin, dass es die Nothwendigkeit schafft, die Kinderarbeit zur äussersten Länge des Arbeitstags der Erwachsenen auszudehnen. Das einzige Heilmittel für diess Uebel, ohne Beschränkung der Arbeit der Erwachsenen, woraus ein Uebel entspringen würde grösser als das, dem vorgebeugt werden soll, scheint der Plan doppelte Reihen von Kindern zu verwenden“. Unter dem Namen Relaissystem („ System of Relays“; Relay heisst im Englischen wie im Französischen: das Wechseln der Postpferde auf verschiedenen Stationen) wurde daher dieser „Plan“ ausgeführt, so dass z. B. von halb 6 Uhr Morgens bis halb zwei Uhr Nachmittags eine Reihe von Kindern zwischen 9 und 13 Jahren, von halb zwei Uhr Nachmittags bis halb 9 Uhr Abend eine andre Reihe vorgespannt wird u. s. w.
Zur Belohnung dafür, dass die Herrn Fabrikanten alle während der letzten 22 Jahre erlassnen Gesetze über Kinderarbeit aufs frechste ignorirt
hatten, ward ihnen jetzt aber auch die Pille vergoldet. Das Parlament bestimmte, dass nach dem 1. März 1834 kein Kind unter 11 Jahren, nach dem 1. März 1835 kein Kind unter 12 Jahren, und nach dem 1. März 1836 kein Kind unter 13 Jahren über 8 Stunden in einer Fabrik arbeiten solle! Dieser für das „Kapital“ so schonungsvolle „Liberalismus“ war um so anerkennenswerther als Dr. Farre, Sir A. Carlisle, Sir B. Brodie, Sir C. Bell, Mr. Guthrie u. s. w., kurz die bedeutendsten physicians und surgeons London’s in ihren Zeugenaussagen vor dem Unterhaus erklärt hatten, dass periculum in mora! Dr. Farre drückte sich noch etwas gröber dahin aus: „Gesetzgebung ist gleich nothwendig für die Prävention des Tods in jeder Form, worin er vorzeitig angethan werden kann, und sicher dieser (der Fabrikmodus) muss als eine der grausamsten Methoden ihn anzuthun betrachtet werden(FN 135)“. Dasselbe „reformirte“ Parlament, das aus Zartsinn für die Herrn Fabrikanten Kinder unter 13 Jahren noch Jahre lang in die Hölle 72stündiger Fabrikarbeit per Woche festbannte, verbot dagegen in dem Emancipationsakt, der auch die Freiheit tropfenweise eingab, von vorn herein den Pflanzern irgend einen Negersklaven länger als 45 Stunden per Woche abzuarbeiten!
Aber keineswegs gesühnt, eröffnete das Kapital jetzt eine mehrjährige und geräuschvolle Agitation. Sie drehte sich hauptsächlich um das Alter der Kategorien, die unter dem Namen Kinder auf 8stündige Arbeit beschränkt und einem gewissen Schulzwang unterworfen worden waren. Nach der kapitalistischen Anthropologie hörte das Kindesalter im 10., oder, wenn es hoch ging, im 11. Jahre auf. Je näher der Termin der vollen Ausführung des Fabrikakts, das verhängnissvolle Jahr 1836 rückte, um so wilder raste der Fabrikantenmob. Es gelang ihm in der That, die Regierung so weit einzuschüchtern, dass diese 1835 den Termin des Kindesalters von 13 auf 12 Jahre herabzusetzen vorschlug. Indess wuchs die pressure from without drohend an. Der Muth versagte dem Unterhause. Es verweigerte Dreizehnjährige länger als 8 Stunden täglich unter das Juggernautrad des Kapitals zu werfen und der
Akt von 1833 trat in volle Wirkung. Er blieb unverändert bis Juni 1844.
Während des Decenniums, worin er erst theilweise, dann ganz die Fabrikarbeit regulirte, strotzen die officiellen Berichte der Fabrikinspektoren von Klagen über die Unmöglichkeit seiner Ausführung. Da das Gesetz von 1833 es nämlich den Herrn vom Kapital freistellte in der fünfzehnstündigen Periode von halb 6 Uhr Morgens bis halb 9 Uhr Abends jede „junge Person“ und „jedes Kind“ zu irgend beliebiger Zeit die zwölf-, respektive 8stündige Arbeit beginnen, unterbrechen, enden zu lassen, und ebenso den verschiednen Personen verschiedne Stunden der Mahlzeiten anzuweisen, fanden die Herrn bald ein neues „ Relaissystem“ aus, wonach die Arbeitspferde nicht nach bestimmter Zeit Stationen wechselten, sondern an wechselnden Stationen stets wieder von neuem vorgespannt wurden. Wir verweilen nicht weiter bei der Schönheit dieses Systems, da wir später darauf zurückkommen müssen. So viel ist aber auf den ersten Blick klar, dass es den ganzen Fabrikakt, nicht nur seinem Geist, sondern auch seinem Buchstaben nach aufhob. Wie sollten die Fabrikinspektoren, bei dieser komplizirten Buchführung über jedes einzelne Kind und jede junge Person, die gesetzlich bestimmte Arbeitszeit und die Gewährung der gesetzlichen Mahlzeiten erzwingen? In einem grossen Theil der Fabriken blühte der alte brutale Unfug bald wieder ungestraft auf. In einer Zusammenkunft mit dem Minister des Innern (1844) wiesen die Fabrikinspektoren die Unmöglichkeit aller Kontrole unter dem neuausgeheckten Relaissystem nach(FN 136). Unterdess hatten sich aber die Umstände sehr geändert. Die Fabrikarbeiter, namentlich seit 1838, hatten die Zehnstundenbill zu ihrem ökonomischen, wie die Charter zu ihrem politischen Wahlruf gemacht. Ein Theil der Fabrikanten selbst, der den Fabrikbetrieb dem Ak von 1833 gemäss geregelt hatte, überwarf das Parlament mit Denkschriften über die unsittliche „Konkurrenz“ der „falschen Brüder“, denen grössere Frechheit oder glücklichere Lokalumstände den Gesetzesbruch erlaubten. Zudem, wie sehr immerhin der einzelne Fabrikant der alten Raubgier den Zügel frei schiessen lassen mochte, die Wortführer und politischen Leiter der Fabrikantenklasse geboten eine veränderte Haltung und veränderte Sprache gegenüber den Arbeitern. Sie
hatten den Feldzug zur Abschaffung der Korngesetze eröffnet und bedurften der Hilfe der Arbeiter zum Siege! Sie versprachen daher nicht nur Verdopplung des Laibes Brod, sondern Annahme der Zehnstundenbill unter dem tausendjährigen Reich des Free Trade(FN 137). Sie durften also um so weniger eine Massregel bekämpfen, die nur den Akt von 1833 zur Wahrheit machen sollte. In ihrem heiligsten Interesse, der Grundrente, bedroht, donnerten endlich die Tories entrüstet philanthropisch über die „ infamen Praktiken“(FN 138) ihrer Feinde.
So kam der zusätzliche Fabrikakt vom 7. Juni 1844 zu Stande. Er trat am 10. September 1844 in Wirkung. Er gruppirt eine neue Kategorie von Arbeitern unter die Beschützten, nämlich die Frauenzimmer über 18 Jahre. Sie wurden in jeder Rücksicht den jungen Personen gleichgesetzt, ihre Arbeitszeit auf 12 Stunden beschränkt, Nachtarbeit ihnen untersagt u. s. w. Zum erstenmal sah sich die Gesetzgebung also gezwungen auch die Arbeit Volljähriger direkt und officiell zu kontroliren. In dem Fabrikbericht von 1844—45 heisst es ironisch: „Es ist kein einziger Fall zu unsrer Kenntniss gekommen, wo erwachsne Weiber sich über diesen Eingriff in ihre Rechte beschwert hätten“(FN 139). Die Arbeit von Kindern unter 13 Jahren wurde auf 6½ und, unter gewissen Bedingungen, 7 Stunden täglich reducirt(FN 140).
Um die Missbräuche des „ falschen Relaissystems“ zu beseitigen, traf das Gesetz u. a. folgende wichtige Detailbestimmungen: „Der Arbeitstag für Kinder und junge Personen ist von der Zeit an zu zählen, wo irgend ein Kind oder junge Person des Morgens in der Fabrik zu arbeiten anfängt.“ So dass wenn A z. B. um 8 Uhr Morgens die Arbeit beginnt, und B um 10 Uhr, der Arbeitstag dennoch für B zur selben Stunde enden muss wie für A. „Der Anfang des Arbeitstags soll angezeigt werden durch eine öffentliche Uhr, z. B. die nächste Eisenbahnuhr, wonach die Fabrikglocke zu richten. Der Fabrikant hat eine grossgedruckte
Notiz in der Fabrik aufzuhängen, worin Anfang, Ende, Pausen des Arbeitstags angegeben sind. Kinder, die ihre Arbeit des Vormittags vor 12 Uhr beginnen, dürfen nicht wieder nach 1 Uhr Mittags verwandt werden. Die Nachmittagsreihe muss also aus andern Kindern bestehn als die Vormittagsreihe. Die 1½ Stunden für Mahlzeit müssen allen beschützten Arbeitern zu denselben Tagesperioden eingeräumt werden, eine Stunde wenigstens vor 3 Uhr Nachmittags. Kein Kind oder junge Person darf länger als 5 Stunden vor 1 Uhr Mittags verwandt werden ohne eine mindestens halbstündige Pause für Mahlzeit. Kein Kind, junge Person, oder Frauenzimmer darf während irgend einer Mahlzeit in einer Fabrikstube bleiben, worin irgend ein Arbeitsprozess vorgeht u. s. w.“
Man hat gesehn: Diese minutiösen Bestimmungen, welche die Periode, Grenzen, Pausen der Arbeit so militärisch uniform nach dem Glockenschlag regeln, waren keineswegs Produkte parlamentarischer Hirnweberei. Sie entwickelten sich allmählig aus den Verhältnissen heraus, als Naturgesetze der modernen Produktionsweise. Ihre Formulirung, officielle Anerkennung und staatliche Proklamation waren Ergebniss langwieriger Klassenkämpfe. Eine ihrer nächsten Folgen war, dass die Praxis auch den Arbeitstag der erwachsnen männlichen Fabrikarbeiter denselben Schranken unterwarf, da in den meisten Produktionsprozessen die Cooperation der Kinder, jungen Personen und Frauenzimmer unentbehrlich. Im Grossen und Ganzen galt daher während der Periode von 1844—47 der zwölfstündige Arbeitstag allgemein und uniform in allen der Fabrikgesetzgebung unterworfenen Industriezweigen.
Die Fabrikanten erlaubten diesen „Fortschritt“ jedoch nicht ohne einen kompensirenden „Rückschritt“. Auf ihren Antrieb reducirte das Unterhaus das Minimalalter der zu verarbeitenden Kinder von 9 Jahren auf 8, zur Sicherung der dem Kapital von Gott und Rechtswegen geschuldeten „ additionellen Fabrikkinderzufuhr“(FN 141).
Die Jahre 1846—47 machen Epoche in der ökonomischen Geschichte Englands. Widerruf der Korngesetze, die Einfuhrzölle auf
Baumwolle und andre Rohmaterialien abgeschafft, der Freihandel zum Leitstern der Gesetzgebung erklärt! Kurz das tausendjährige Reich brach an. Andrerseits erreichten in denselben Jahren Chartistenbewegung und Zehnstundenagitation ihren Höhe unkt. Sie fanden Bundesgenossen an den racheschnaubenden Tories. Trotz des fanatischen Widerstands des wortbrüchigen Freihandelsheers mit Bright und Cobden an der Spitze, ging die so lang erstrebte Zehnstundenbill durch das Parlament. —
Der neue Fabrikakt vom 8. Juni 1847 setzte fest, dass am ersten Juli 1847 eine vorläufige Verkürzung des Arbeitstags der „ jungen Personen“ (von 13 bis zu 18 Jahren) und aller Arbeiterinnen auf 11 Stunden, am 1. Mai 1848 aber die definitive Beschränkung auf 10 Stunden eintreten solle. Im übrigen war der Akt nur ein amendirender Zusatz der Gesetze von 1833 und 1844.
Das Kapital unternahm zunächst einen vorläufigen Feldzug, dessen Ziel, die volle Ausführung des Akts am 1. Mai 1848 zu verhindern. Und zwar sollten die Arbeiter selbst, angeblich durch die Erfahrung gewitzigt, ihr eignes Werk wieder zerstören helfen. Der Augenblick war geschickt gewählt. „Man muss sich erinnern, dass, in Folge der furchtbaren Krise von 1846—47, grosses Leid unter den Fabrikarbeitern vorherrschte, da viele Fabriken nur für kurze Zeit gearbeitet, andre ganz still gestanden hatten. Eine beträchtliche Anzahl der Arbeiter befand sich daher in drückendster Lage, viele in Schulden. Man konnte daher mit ziemlicher Gewissheit annehmen, dass sie die längere Arbeitszeit vorziehn würden, um die vergangenen Verluste gut zu machen, vielleicht Schulden abzuzahlen, oder ihre Möbel aus dem Pfandhaus zu nehmen, oder verkaufte Habseligkeiten zu ersetzen, oder neue Kleidungsstücke sich selbst und ihren Familien zu verschaffen“(FN 142). Die Herrn Fabrikanten suchten die natürliche Wirkung dieser Umstände zu steigern durch eine allgemeine Lohnherabsetzung von 10 %. Diess geschah so zu sagen zur Einweihungsfeier der neuen Freihandelsära. Dann folgte weitere Herabsetzung um 8⅓ %, sobald der Arbeitstag auf 11, und um das Doppelte, sobald er definitiv auf 10 Stunden verkürzt wurde. Wo es daher irgendwie die Verhältnisse zuliessen, fand eine Lohnherabsetzung von wenig-
stens 25 % statt(FN 143). Unter so günstig vorbereiteten Chancen begann man die Agitation unter den Arbeitern zum Repeal des Akts von 1847. Kein Mittel des Betrugs, der Verführung und der Drohung wurde dabei verschmäht, aber alles umsonst. Von dem halben Dutzend Petitionen, worin die Arbeiter klagen mussten über „ihre Unterdrückung durch den Akt.“ erklärten die Bittsteller selbst, bei mündlichem Verhör, ihre Unterschriften seien abgenöthigt worden. „Sie seien unterdrückt, aber von Jemand anders als dem Fabrikakt“(FN 144). Wenn es aber den Fabrikanten nicht gelang, die Arbeiter in ihrem Sinn sprechen zu machen, schrieen sie selbst nur um so lauter in Presse und Parlament im Namen der Arbeiter. Sie denuncirten die Fabrikinspektoren als eine Art Konventskommissäre, die ihrer Weltverbesserungsgrille den unglücklichen Arbeiter unbarmherzig aufopferten. Auch diess Manöver schlug fehl. Fabrikinspektor Leonhard Horner stellte in eigner Person und durch seine Unterinspektoren zahlreiche Zeugenverhöre in den Fabriken Lancashire’s an. Ungefähr 70 % der verhörten Arbeiter erklärten sich für 10 Stunden, eine viel geringere Prozentzahl für 11 und eine ganz unbedeutende Minorität für die alten 12 Stunden(FN 145).
Ein andres „gütliches“ Manöver war die erwachsnen männlichen Arbeiter 12 bis 15 Stunden arbeiten zu lassen und dann diese Thatsache für den besten Ausdruck der proletarischen Herzenswünsche zu erklären. Aber der „unbarmherzige“ Fabrikinspektor Leonhard Horner war wieder an Ort und Stelle. Die meisten „Ueberstündigen“
sagten aus, „sie würden es bei weitem vorziehn 10 Stunden für geringern Arbeitslohn zu arbeiten, aber sie hätten keine Wahl; so viele von ihnen seien arbeitslos, so viele Spinner gezwungen als blosse piecers zu arbeiten, dass wenn sie die längere Arbeitszeit verweigerten, andre sofort ihre Stellen einnehmen würden, so dass die Frage so für sie stehe: entweder die längere Zeit arbeiten oder auf dem Pflaster liegen“(FN 146).
Der vorläufige Feldzug des Kapitals war missglückt und das Zehnstundengesetz trat am 1. Mai 1848 in Kraft. Unterdess hatte jedoch das Fiasko der Chartistenpartei, deren Führer eingekerkert und deren Organisation zersprengt, bereits das Selbstvertrauen der englischen Arbeiterklasse erschüttert. Bald darauf vereinigte die Pariser Juniinsurrektion und ihre blutige Erstickung, wie im kontinentalen Europa, so in England, alle Fraktionen der herrschenden Klassen, Grundeigenthümer und Kapitalisten, Börsenwölfe und Krämer, Protektionisten und Freihändler, Regierung und Opposition, Pfaffen und Freigeister, junge Huren und alte Nonnen, unter dem gemeinschaftlichen Ruf zur Rettung des Eigenthums, der Religion, der Familie, der Gesellschaft! Die Arbeiterklasse wurde überall verfehmt, in den Bann gethan, unter das „ loi des suspects“ gestellt. Die Herrn Fabrikanten brauchten sich also nicht länger zu geniren. Sie brachen in offne Revolte aus, nicht nur wider das Zehnstundengesetz, sondern die ganze Gesetzgebung, welche seit 1833 die „ freie“ Aussaugung der Arbeitskraft einigermassen zu zügeln suchte. Es war eine Proslavery Rebellion in Miniatur, während mehr als zwei Jahren durchgeführt mit cynischer Rücksichtslosigkeit, mit terroristischer Energie, beide um so wohlfeiler als der rebellische Kapitalist nichts riskirte ausser der Haut seiner Arbeiter.
Zum Verständniss des Nachfolgenden muss man sich erinnern, dass die Fabrikakte von 1833, 1844 und 1847 alle drei in Rechtskraft, so weit der eine nicht den andern amendirt; dass keiner derselben den Arbeitstag des männlichen Arbeiters über 18 Jahren beschränkt, und dass seit 1833 die fünfzehnstündige Periode von halb 6 Uhr Mor-
gens bis halb 9 Uhr Abends der gesetzliche „ Tag“ blieb, innerhalb dessen erst die zwölf-, später die 10stündige Arbeit der jungen Personen und Frauenzimmer unter den vorgeschriebnen Bedingungen zu verrichten war.
Die Fabrikanten begannen hier und da mit Entlassung eines Theils, manchmal der Hälfte, der von ihnen beschäftigten jungen Personen und Arbeiterinnen, und stellten dagegen die fast verschollene Nachtarbeit unter den erwachsnen männlichen Arbeitern wieder her. Das Zehnstundengesetz, riefen sie, lasse ihnen keine andre Alternative(FN 147)!
Der zweite Schritt bezog sich auf die gesetzlichen Pausen für Mahlzeiten. Hören wir die Fabrikinspektoren. „Seit der Beschränkung der Arbeitsstunden auf 10, behaupten die Fabrikanten, obgleich sie praktisch ihre Ansicht noch nicht bis zur letzten Konsequenz durchführen, dass wenn sie z. B. von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends arbeiten lassen, sie den gesetzlichen Vorschriften genug thun, indem sie eine Stunde für Mahlzeit vor 9 Uhr Morgens und eine halbe Stunde nach 7 Uhr Abends, also 1½ Stunden für Mahlzeiten geben. In einigen Fällen erlauben sie jetzt eine halbe Stunde für Mittagsessen, bestehn aber zugleich darauf, sie seien durchaus nicht verpflichtet, irgend einen Theil der 1½ Stunden im Lauf des zehnstündigen Arbeitstags einzuräumen“(FN 148). Die Herrn Fabrikanten behaupteten also, die peinlich genauen Bestimmungen des Akts von 1844 über Mahlzeiten gäben den Arbeitern nur die Erlaubniss, vor ihrem Eintritt in die Fabrik und nach ihrem Austritt aus der Fabrik, also bei sich zu Hause, zu essen und zu trinken! Und warum sollten die Arbeiter auch nicht vor 9 Uhr Morgens ihr Mittagsessen einnehmen? Die Kronjuristen entschieden jedoch, dass die vorgeschriebenen Mahlzeiten „in Pausen während des wirklichen Arbeitstags gegeben werden müssen und dass es ungesetzlich 10 Stunden nach einander von 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends ohne Unterbrechung arbeiten zu lassen“(FN 149).
Nach diesen gemüthlichen Demonstrationen leitete das Kapital seine Revolte ein durch einen Schritt, der dem Buchstaben des Gesetzes von 1844 entsprach, also legal war.
Das Gesetz von 1844 verbot allerdings, Kinder von 8 bis 13 Jahren, die vor 12 Uhr Vormittags beschäftigt würden, wieder nach 1 Uhr Mittags zu beschäftigen. Aber es regelte in keiner Weise die 6½stündige Arbeit der Kinder, deren Arbeitszeit um 12 Uhr Vormittags oder später begann! Achtjährige Kinder konnten daher, wenn sie die Arbeit um 12 Uhr Vormittags begannen, von 12 bis 1 Uhr verwandt werden, 1 Stunde; von 2 Uhr bis 4 Uhr Nachmittags, 2 Stunden; und von 5 Uhr bis halb 9 Uhr Abends, 3½ Stunden; alles in allem die gesetzlichen 6½ Stunden! Oder noch besser. Um ihre Verwendung der Arbeit erwachsner männlicher Arbeiter bis halb 9 Uhr Abends anzupassen, brauchten ihnen die Fabrikanten kein Werk zu geben vor 2 Uhr Nachmittags, und konnten sie dann ununterbrochen in der Fabrik halten bis halb 9 Uhr Abends! „Und es wird jetzt ausdrücklich zugestanden, dass neuerdings, in Folge der Fabrikantengier, ihre Maschinerie länger als 10 Stunden laufen zu lassen, sich die Praxis in England eingeschlichen hat, achtbis dreizehnjährige Kinder beiderlei Geschlechts, nach Entfernung aller jungen Personen und Weiber aus der Fabrik, allein mit den erwachsnen Männern, bis halb 9 Uhr Abends arbeiten zu lassen“(FN 150). Arbeiter und Fabrikinspektoren protestirten aus hygienischen und moralischen Gründen. Aber das Kapital antwortete: „Meine Thaten auf mein Haupt! Mein Recht verlang’ ich! Die Busse und Verpfändung meines Scheins!“
In der That waren, nach statistischer Vorlage an das Unterhaus vom 26. Juli 1850, trotz aller Proteste, am 15. Juli 1850 3742 Kinder in 275 Fabriken dieser „Praxis“ unterworfen(FN 151). Noch nicht genug! Das Luchsauge des Kapitals entdeckte, dass der Akt von 1844 fünfstündige Arbeit des Vormittags nicht ohne Pause von wenigstens 30 Minuten für Erfrischung erlaubt, aber nichts der Art für die Nachmittagsarbeit vorschreibt. Es verlangte und ertrotzte daher den Genuss, achtjährige Arbeiterkinder unausgesetzt von 2 bis halb 9 Uhr Abends nicht nur schanzen, sondern auch hungern zu lassen! „Ja, die Brust. So sagt der Schein“(FN 152).
Diess Shylocksche Festklammern am Buchstaben des Gesetzes von 1844, soweit es die Kinderarbeit regelt, sollte jedoch nur die offne Revolte gegen dasselbe Gesetz vermitteln, so weit es die Arbeit von „ jungen Personen und Frauenzimmern“ regelt. Man erinnert sich, dass die Abschaffung des „ falschen Relaissystems“ Hauptzweck und Hauptinhalt jenes Gesetzes bildet. Die Fabrikanten eröffneten ihre Revolte mit der einfachen Erklärung, die Sektionen des Akts von 1844, welche beliebigen Niessbrauch der jungen Personen und Frauenzimmer in beliebigen kürzeren Abschnitten des fünfzehnstündigen Fabriktags verbieten, seien „ vergleichungsweise harmlos (comparatively harmless) gewesen, so lange die Arbeitszeit auf 12 Stunden eingeschränkt war. Unter dem Zehnstundengesetz seien sie eine unerträgliche Unbill“ (hard ship)(FN 153). Sie zeigten daher den Inspektoren in der kühlsten Weise an, dass sie sich über den Buchstaben des Gesetzes hinwegsetzen und das alte System auf eigne Faust wieder einführen würden(FN 154). Es geschehe im Interesse der übelberathnen Arbeiter selbst, „um ihnen höhere Löhne zahlen zu können.“ „Es sei der einzig mögliche Plan, um unter dem Zehnstundengesetz die industrielle Suprematie Grossbritanniens zu erhalten“(FN 155). „Es möge etwas schwer sein Unregelmässigkeiten unter dem Relaissystem zu entdecken, aber was heisse das? (what of that?) Soll das grosse Fabrikinteresse dieses Landes als ein
sekundäres Ding behandelt werden, um den Fabrik-Inspektoren und Subinspektoren ein bischen mehr Mühe (some little trouble) zu sparen“(FN 156)?
Alle diese Flausen halfen natürlich nichts. Die Fabrikinspektoren schritten gerichtlich ein. Bald aber überschüttete eine solche Staubwolke von Fabrikantenpetitionen den Minister des Innern, Sir George Grey, dass er in einem Cirkular vom 5. August 1848 die Inspektoren anwies, „im Allgemeinen nicht einzuschreiten wegen Verletzung des Buchstabens des Akts, so oft das Relaissystem nicht erwiesnermassen missbraucht werde, um junge Personen und Frauenzimmer über 10 Stunden arbeiten zu lassen.“ Hierauf erlaubte Fabrikinspektor J. Stuart das sogenannte Ablösungssystem während der fünfzehnstündigen Periode des Fabriktags in ganz Schottland, wo es bald wieder in alter Weise aufblühte. Die englischen Fabrikinspektoren dagegen erklärten, der Minister besitze keine diktatorische Gewalt zur Suspension der Gesetze, und fuhren mit gerichtlicher Procedur wider die Proslavery Rebellen fort.
Wozu jedoch alle Citation vor’s Gericht, sobald die Gerichte, die county magistrates(FN 157), freisprachen? In diesen Gerichten sassen die Herrn Fabrikanten über sich selbst zu Gericht. Ein Beispiel. Ein gewisser Eskrigge, Baumwollspinner von der Firma Kershaw, Leese et Co., hatte dem Fabrikinspektor seines Distrikts das Schema eines für seine Fabrik bestimmten Relaissystems vorgelegt. Abschlägig beschieden, verhielt er sich zunächst passiv. Wenige Monate später stand ein Individuum Namens Robinson, ebenfalls Baumwollspinner, und wenn nicht der Freitag, so jedenfalls der Verwandte des Eskrigge, vor den Borough Justices zu Stockport, wegen Einführung des identischen, von Eskrigge ausgeheckten Relaisplans. Es sassen 4 Richter, darunter 3 Baumwollspinner, an ihrer Spitze derselbe unvermeidliche Eskrigge. Eskrigge sprach den Robinson frei, und erklärte nun, was dem Robinson recht, sei dem Eskrigge billig. Auf seine eigne rechtskräftige Entscheidung gestützt,
führte er sofort das System in seiner eignen Fabrik ein(FN 158). Allerdings war schon die Zusammensetzung dieser Gerichte offne Verletzung des Gesetzes(FN 159). „Diese Art gerichtlicher Farcen“, ruft Inspektor Howell aus, „schreien nach einem Heilmittel . . . . entweder passt das Gesetz diesen Urtheilssprüchen an oder lasst es verwalten durch ein minder fehlbares Tribunal, das seine Entscheidungen dem Gesetz anpasst . . . . In allen solchen Fällen, wie sehnt man sich nach einem bezahlten Richter“(FN 160)!
Die Kronjuristen erklärten die Fabrikanten-Interpretation des Akts von 1844 für abgeschmackt, aber die Gesellschaftsretter liessen sich nicht beirren. „Nachdem ich“, berichtet Leonhard Horner, „durch 10 Verfolgungen in 7 verschiednen Gerichtsbezirken versucht habe das Gesetz zu erzwingen und nur in einem Fall von den Magistraten unterstützt wurde, halte ich weitere Verfolgung wegen Umgehung des Gesetzes für nutzlos. Der Theil des Akts, der verfasst wurde, um Uniformität in den Arbeitsstunden zu schaffen, existirt nicht mehr in Lancashire. Auch besitze ich mit meinen Unteragenten durchaus kein Mittel uns zu versichern, dass Fabriken, wo das sog. Relaissystem herrscht, junge Personen und Frauenzimmer nicht über 10 Stunden beschäftigen . . . . Ende April 1849 arbeiten schon 118 Fabriken in meinem Distrikt nach dieser Methode und ihre Anzahl nimmt in der letzten Zeit reissend zu. Im Allgemeinen arbeiten sie jetzt 13½ Stunden, von 6 Uhr Morgens bis halb 8 Uhr Abends; in einigen Fällen 15 Stunden, von halb 6 Uhr Morgens bis halb 9 Uhr Abends“(FN 161). Schon December 1848 besass Leonhard Horner eine Liste von 65 Fabrikanten und 29 Fabrikaufsehern, die einstimmig erklärten, kein System der Oberaufsicht könne unter diesem Relaissystem die extensivste Ueberarbeit verhindern(FN 162). Bald wurden dieselben Kinder und
jungen Personen aus der Spinnstube in die Webstube u. s. w., bald, während 15 Stunden, aus einer Fabrik in die andre geschoben (shifted)(FN 163). Wie ein System kontroliren, „welches das Wort Ablösung missbraucht, um die Hände in endloser Mannichfaltigkeit wie Karten durcheinander zu mischen und die Stunden der Arbeit und der Rast für die verschiednen Individuen täglich so zu verschieben, dass ein und dasselbe vollständige Assortiment von Händen niemals an demselben Platz zur selben Zeit zusammenarbeitet“(FN 164)!
Aber ganz abgesehn von wirklicher Ueberarbeitung, war diess sog. Relaissystem eine Ausgeburt der Kapitalphantasie, wie sie Fourier in seinen genialsten Skizzen der „courtes séances“ nie übertroffen hat, nur dass die Attraktion der Arbeit verwandelt war in die Attraktion des Kapitals. Man sehe sich jene Fabrikantenschemas an, welche die gute Presse pries als Muster von dem, „was ein vernünftiger Grad von Sorgfalt und Methode ausrichten kann“ („what a reasonable degree of care and method can accomplish“). Das Arbeiterpersonal wurde manchmal in 12 bis 14 Kategorien vertheilt, die selbst wieder ihre Bestandtheile beständig wechselten. Während der fünfzehnstündigen Periode des Fabriktags zog das Kapital den Arbeiter jetzt für 30 Minuten, jetzt für eine Stunde an, und stiess ihn dann wieder ab, um ihn von neuem in die Fabrik zu ziehn und aus der Fabrik zu stossen, ihn hin und her hetzend in zerstreuten Zeitfetzen, ohne je den Halt auf ihn zu verlieren, bis die zehnstündige Arbeit vollgemacht. Wie auf der Bühne hatten dieselben Personen abwechselnd in den verschiednen Scenen der verschiednen Akte aufzutreten. Aber wie ein Schauspieler während der ganzen Dauer des Dramas der Bühne gehört, so gehörten die Arbeiter jetzt während 15 Stunden der Fabrik, nicht eingerechnet die Zeit, um von und zu ihr zu gehn. Die Stunden der Rast verwandelten sich so in Stunden erzwungenen Müssiggangs, welche den jungen Arbeiter in die Kneipe und die junge Arbeiterin in das Bordell trieben. Bei jedem neuen Einfall, den der Kapitalist täglich ausheckte, um seine Maschinerie ohne Vermehrung des Arbeiterpersonals 12 oder 15 Stunden im Gang zu halten, hatte der Arbeiter bald in diesem Stück Zeitabfall, bald in jenem seine Mahlzeit ein-
zuschlucken. Zur Zeit der Zehnstundenagitation schrien die Fabrikanten, das Arbeiterpack petitionire, in der Erwartung, zwölfstündigen Arbeitslohn für zehnstündige Arbeit zu erhalten. Sie hatten jetzt die Medaille umgekehrt. Sie zahlten 10stündigen Arbeitslohn für zwölfund fünfzehnstündige Verfügung über die Arbeitskräfte(FN 165)! Diess war des Pudels Kern, diess die Fabrikantenausgabe des Zehnstundengesetzes! Es waren dieselben salbungsvollen, Menschenliebe triefenden Freihändler, die den Arbeitern 10 volle Jahre, während der Anticornlaw-Agitation, auf Heller und Pfennig vorgerechnet, dass bei freier Korneinfuhr eine zehnstündige Arbeit, mit den Mitteln der englischen Industrie, vollständig genüge, um die Kapitalisten zu bereichern(FN 166).
Die zweijährige Kapitalrevolte wurde endlich gekrönt durch den Urtheilsspruch eines der vier höchsten Gerichtshöfe von England, des Court of Exchequer, der in einem vor ihn gebrachten Fall am 8. Februar 1850 entschied, dass die Fabrikanten zwar wider den Sinn des Akts von 1844 handelten, dieser Akt selbst aber gewisse Worte enthalte, die ihn sinnlos machten. „Mit dieser Entscheidung war das Zehnstundengesetz abgeschafft“(FN 167). Eine Masse Fabrikanten, die bisher noch das Relaissystem für junge Personen und Arbeiterinnen gescheut, griffen nun mit beiden Händen zu(FN 168).
Mit diesem scheinbar definitiven Sieg des Kapitals trat aber sofort ein Umschlag ein. Die Arbeiter hatten bisher passiven, obgleich unbeugsamen und täglich erneuten Widerstand geleistet. Sie protestirten jetzt
in laut drohenden Meetings in Lancashire und Yorkshire. Das angebliche Zehnstundengesetz sei also blosser Humbug, parlamentarische Prellerei, und habe nie existirt! Die Fabrikinspektoren warnten dringend die Regierung, der Klassenantagonismus sei zu einer unglaublichen Höhe gespannt. Ein Theil der Fabrikanten selbst murrte: „durch die widersprechenden Entscheidungen der Magistrate herrsche ein ganz abnormaler und anarchischer Zustand. Ein andres Gesetz gelte in Yorkshire, ein andres in Lancashire, ein andres Gesetz in einer Pfarrei von Lancashire, ein andres in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Der Fabrikant in grossen Städten könne das Gesetz umgehn, der in Landflecken finde nicht das nöthige Personal für das Relaissystem und noch minder zur Verschiebung der Arbeiter aus einer Fabrik in die andre u. s. w.“ Und gleiche Exploitation der Arbeitskraft ist das erste Menschenrecht des Kapitals.
Unter diesen Umständen kam es zu einem Kompromiss zwischen Fabrikanten und Arbeitern, der in dem neuen zusätzlichen Fabrikakt vom 5. August 1850 parlamentarisch versiegelt ist. Für „ junge Personen und Frauenzimmer“ wurde der Arbeitstag in den ersten 5 Wochentagen von 10 auf 10½ Stunden erhöht, für den Samstag auf 7½ Stunden beschränkt. Die Arbeit muss in der Periode von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends vorgehn(FN 169), mit 1½stündigen Pausen für Mahlzeiten, die gleichzeitig und gemäss den Bestimmungen von 1844 einzuräumen sind u. s. w. Damit war dem Relaissystem ein für allemal ein Ende gemacht(FN 170). Für die Kinderarbeit blieb das Gesetz von 1844 in Kraft.
Eine Fabrikantenkategorie sicherte sich diessmal, wie früher, besondere Seigneurialrechte auf Proletarierkinder. Es waren diess die Seidenfabrikanten. Im Jahr 1833 hatten sie drohend geheult, „wenn man ihnen die Freiheit raube, Kinder jeden Alters täglich
10 Stunden abzurackern, setze man ihre Fabriken still“ (if the liberty of working children of any age for 10 hours a day was taken away, it would stop their works). Es sei ihnen unmöglich, eine hinreichende Anzahl von Kindern über 13 Jahren zu kaufen. Sie erpressten das gewünschte Privilegium. Der Vorwand stellte sich bei späterer Untersuchung als baare Lüge heraus(FN 171), was sie jedoch nicht verhinderte, während eines Decenniums aus dem Blut kleiner Kinder, die zur Verrichtung ihrer Arbeit auf Stühle gestellt werden mussten, täglich 10 Stunden Seide zu spinnen(FN 172). Der Akt von 1844 „beraubte“ sie zwar der „Freiheit“, Kinder unter 11 Jahren länger als 6½ Stunden, sicherte ihnen dagegen das Privilegium, Kinder zwischen 11 und 13 Jahren 10 Stunden täglich zu verarbeiten, und kassirte den für andere Fabrikkinder vorgeschriebenen Schulzwang. Diessmal der Vorwand: „Die Delikatesse des Gewebes erheische eine Fingerzartheit, die nur durch frühen Eintritt in die Fabrik zu sichern“(FN 173). Der delikaten Finger wegen wurden die Kinder ganz geschlachtet, wie Hornvieh in Südrussland wegen Haut und Talg. Endlich, 1850, wurde das 1844 eingeräumte Privilegium auf die Departements der Seidenzwirnerei und Seidenhaspelei beschränkt, hier aber, zum Schadenersatz des seiner „Freiheit“ beraubten Kapitals, die Arbeitszeit für Kinder von 11 bis 13 Jahren von 10 auf 10½ Stunden erhöht. Vorwand: „Die Arbeit sei leichter in Seidenfabriken als in den andern Fabriken und in keiner Weise so nachtheilig für die Gesundheit“(FN 174). Offizielle ärztliche Untersuchung bewies hinterher, dass umgekehrt „die durchschnittliche Sterblichkeitsrate in den Seidendistrikten ausnahmsweise hoch und unter dem weiblichen Theil der Bevölkerung selbst höher ist als in den Baumwolldistrikten von Lancashire“(FN 175). Trotz des halbjährlich wieder-
holten Protests der Fabrikinspektoren, dauert der Unfug bis zur Stunde fort(FN 176).
Das Gesetz von 1850 verwandelte nur für „junge Personen und Frauenzimmer“ die fünfzehnstündige Periode von halb 6 Uhr Morgens bis halb 9 Uhr Abends in die zwölfstündige Periode von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends. Also nicht für Kinder, die immer noch eine halbe Stunde vor Beginn und 2½ Stunden nach Schluss dieser Periode verwerthbar blieben, wenn auch die Gesammtdauer ihrer Arbeit 6½ Stunden nicht überschreiten durfte. Während der Diskussion des Gesetzes wurde dem Parlament von den Fabrikinspektoren eine Statistik über die infamen Missbräuche jener Anomalie unterbreitet. Jedoch umsonst. Im Hintergrund lauerte die Absicht, den Arbeitstag der erwachsnen Arbeiter mit
Beihilfe der Kinder in Prosperitätsjahren wieder auf 15 Stunden zu schrauben. Die Erfahrung der folgenden 3 Jahre zeigte, dass solcher Versuch am Widerstand der erwachsnen männlichen Arbeiter scheitern müsse(FN 177). Der Akt von 1850 wurde daher 1853 endlich ergänzt durch das Verbot, „Kinder des Morgens vor und des Abends nach den jungen Personen und Frauenzimmern zu verwenden“. Von nun an regelte, mit wenigen Ausnahmen, der Fabrikakt von 1850 in den ihm unterworfenen Industriezweigen den Arbeitstag aller Arbeiter(FN 178). Seit dem Erlass des ersten Fabrikakts war jetzt ein halbes Jahrhundert verflossen(FN 179).
Ueber ihre ursprüngliche Sphäre griff die Fabrikgesetzgebung zuerst hinaus durch den ‚ Printwork’s Act‘ (Gesetz über Kattundruckereien u. s. w.) von 1845. Die Unlust, womit das Kapital diese neue „Extravaganz“ zuliess, spricht aus jeder Zeile des Acts! Er beschränkt den Arbeitstag für Kinder von 8—13 Jahren und für Frauenzimmer auf 16 Stunden zwischen 6 Uhr Morgens und 10 Uhr Abends, ohne irgend eine gesetzliche Pause für Mahlzeiten. Er erlaubt männliche Arbeiter
über 13 Jahre Tag und Nacht hindurch beliebig abzuarbeiten(FN 180). Er ist ein parlamentarischer Abort(FN 181).
Dennoch hatte das Prinzip gesiegt mit seinem Sieg in den grossen Industriezweigen, welche das eigenste Geschöpf der modernen Produktionsweise. Ihre wundervolle Entwicklung von 1853—1860, Hand in Hand mit der physischen und moralischen Wiedergeburt der Fabrikarbeiter. schlug das blödeste Auge. Die Fabrikanten selbst, denen die gesetzliche Schranke und Regel des Arbeitstags durch halbhundertjährigen Bürgerkrieg Schritt für Schritt abgetrotzt, wiesen prahlend auf den Kontrast mit den noch „freien“ Exploitationsgebieten hin(FN 182). Die Pharisäer der „politischen Oekonomie“ proklamirten nun die Einsicht in die Nothwendigkeit eines gesetzlich geregelten Arbeitstags als charakteristische Neuerrungenschaft ihrer „Wissenschaft“(FN 183). Man versteht leicht, dass nachdem sich die Fabrikmagnaten in das Unvermeidliche gefügt und mit ihm ausgesöhnt, die Widerstandskraft des Kapitals graduell abschwachte, während zugleich die Angriffskraft der Arbeiterklasse wuchs mit der Zahl ihrer Verbündeten in den nicht unmittelbar interessirten Gesellschaftsschichten. Daher vergleichungsweis rascher Fortschritt seit 1860.
Die Färbereien und Bleichereien(FN 184) wurden 1860, die Spitzenfabri-
ken und Strumpfwirkereien 1861 dem Fabrikakt von 1850 unterworfen. In Folge des ersten Berichts der „ Kommission über die Beschäftigung der Kinder“ (1863) theilten dasselbe Schicksal die Manufaktur aller Erdenwaaren (nicht nur Töpfereien), der Schwefelhölzer, Zündhütchen, Patronen, Tapetenfabrik, Baumwollsammt-Scheererei (fustian cutting) und zahlreiche Prozesse, die unter dem Ausdruck „finishing“ (letzte Appretur) zusammengefasst sind. Im Jahre 1863 wurden die „ Bleicherei in offener Luft“(FN 185) und die Bäckerei
unter eigne Akte gestellt, wovon der erste u. a. die Arbeit von Kindern, jungen Personen und Weibern zur Nachtzeit (von 8 Uhr Abends bis 6 Uhr Morgens) und der zweite die Anwendung von Bäckergesellen unter 18 Jahren zwischen 9 Uhr Abends und 5 Uhr Morgens verbietet. Auf die späteren Vorschläge der erwähnten Kommission, welche, mit Ausnahme des Ackerbaus, der Minen und des Transportwesens, alle wichtigern englischen Industriezweige der „Freiheit“ zu berauben drohen, kommen wir zurück.
Der Leser erinnert sich, dass die Produktion von Mehrwerth oder die Extraktion von Mehrarbeit den spezifischen Inhalt und Zweck der kapitalistischen Produktion bildet, abgesehn von einer jeden aus der Unterordnung der Arbeit unter das Kapital etwa entspringenden Umgestaltung der Produktionsweise selbst. Er erinnert sich, dass auf dem bisher entwickelten Standpunkt nur der selbstständige und daher gesetzlich mündige Arbeiter als Waaren-
verkäufer mit dem Kapitalisten kontrahirt. Wenn in unsrer historischen Skizze also einerseits die moderne Industrie eine Hauptrolle spielt andrerseits die Arbeit physisch und rechtlich Unmündige so galt uns die eine nur als besondre Sphäre, die andre nur als besonders schlagendes Beispiel der Arbeitsaussaugung. Ohne jedoch der spätern Entwicklung vorzugreifen, folgt aus dem blossen Zusammenhang der geschichtlichen Thatsachen:
Erstens: In den durch Wasser, Dampf und Maschinerie zunächst revolutionirten Industrien, in diesen ersten Schöpfungen der modernen Produktionsweise, den Baumwolle-, Wolle-, Flachs-, Seide-Spinnereien und Webereien wird der Trieb des Kapitals nach massund rücksichtsloser Verlängerung des Arbeitstags zuerst befriedigt. Die veränderte materielle Produktionsweise und die ihr entsprechend veränderten socialen Verhältnisse der Produzenten(FN 186) schaffen erst die masslose Ausschreitung und rufen dann im Gegensatz die gesellschaftliche Kontrole hervor, welche den Arbeitstag mit seinen Pausen gesetzlich beschränkt, regulirt und uniformirt. Diese Kontrole erscheint daher während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bloss als Ausnahmsgesetzgebung(FN 187). Sobald sie das Urgebiet der neuen Produktionsweise erobert hatte, fand sich, dass unter dess nicht nur viele andre Produktionszweige in das eigentliche Fabrikregime eingetreten, sondern dass Manufakturen mit mehr oder minder verjährter Betriebsweise, wie Töpfereien, Glasereien u. s. w., dass altmodische Handwerke, wie die Bäckerei, und endlich selbst die zerstreute s. g. Hausarbeit, wie Nägelmacherei u. s. w.(FN 188), seit lange der kapitalistischen Exploitation eben so sehr verfallen waren als
die Fabrik. Die Gesetzgebung ward daher gezwungen, ihren Ausnahmscharakter allmählig abzustreifen, oder, wo sie römisch kasuistisch verfährt, wie in England, irgend ein Haus, worin man arbeitet, nach Belieben für eine Fabrik (factory) zu erklären(FN 189).
Zweitens: Die Geschichte der Reglung des Arbeitstags in einigen Produktionsweisen, in andern der noch fortdauernde Kampf um diese Reglung, beweisen handgreiflich, dass der vereinzelte Arbeiter, der Arbeiter als „freier“ Verkäufer seiner Arbeitskraft, auf gewisser Reifestufe der kapitalistischen Produktion, widerstandslos unterliegt. Die Schöpfung eines Normal-Arbeitstags ist daher das Produkt eines langwierigen, mehr oder minder versteckten Bürgerkriegs zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse. Wie der Kampf eröffnet wird im Umkreis der modernen Industrie, so spielt er zuerst in ihrem Heimathsland, England(FN 190). Die englischen Fabrikarbeiter waren die Preisfechter nicht nur der englischen, sondern der modernen Arbeiterklasse überhaupt, wie auch ihre Theoretiker der Theorie des Kapitals zuerst den Fehdehandschuh hinwarfen(FN 191). Der Fabrikphilosoph Ure denunzirt es
daher als unauslöschliche Schmach der englischen Arbeiterklasse, dass sie „die Sklaverei der Fabrikakte“ auf ihre Fahne schrieb gegenüber dem Kapital, das männlich für „ vollkommene Freiheit der Arbeit“ stritt(FN 192).
Frankreich hinkt langsam hinter England her. Es bedarf der Februarrevolution zur Geburt des Zwölfstundengesetzes(FN 193), das viel mangelhafter ist als sein englisches Original. Trotzdem macht die französische revolutionäre Methode auch ihre eigenthümlichen Vorzüge geltend. Mit einem Schlag diktirt sie allen Ateliers und Fabriken ohne Unterschied dieselbe Schranke des Arbeitstags, während die englische Gesetzgebung bald an diesem Punkt, bald an jenem, dem Druck der Verhältnisse widerwillig weicht und auf dem besten Weg ist, einen neuen juristischen Rattenkönig auszubrüten(FN 194). Andrerseits proklamirt
das französische Gesetz prinzipiell, was in England nur im Namen von Kindern, Unmündigen und Frauenzimmern erkämpft und erst neuerdings als allgemeines Recht beansprucht wird(FN 195).
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika blieb jede selbstständige Arbeiterbewegung gelähmt, so lange die Sklaverei einen Theil der Republik verunstaltete. Die Arbeit in weisser Haut kann sich dort nicht emancipiren, wo sie in schwarzer Haut gebrandmarkt wird. Aber aus dem Tod der Sklaverei entspross sofort ein neu verjüngtes Leben. Die erste Frucht des Bürgerkriegs war die Achtstundenagitation, mit den Siebenmeilenstiefeln der Lokomotive vom atlantischen bis zum stillen Ocean ausschreitend, von Neuengland bis nach Kalifornien. Der allgemeine Arbeiterkongress zu Baltimore (16. August 1866) erklärt: „Das erste und grosse Erheischniss der Gegenwart, um die Arbeit dieses Landes von der kapitalistischen Sklaverei zu befreien, ist der Erlass eines Gesetzes, wodurch 8 Stunden den Normal-Arbeitstag in allen Staaten der amerikanischen Union bilden sollen. Wir sind entschlossen alle unsre Macht aufzubieten, bis diess glorreiche Resultat erreicht ist“(FN 196). Gleichzeitig (Anfang September
1866) beschloss der „ Internationale Arbeiterkongress“ zu Genf auf Vorschlag der Londoner Centralbehörde: „Wir erklären die Beschränkung des Arbeitstags für eine vorläufige Bedingung, ohne welche alle andern Bestrebungen nach Emancipation scheitern müssen … Wir schlagen 8 Arbeitsstunden als legale Schranke des Arbeitstags vor“.
So besiegelt die auf beiden Seiten des atlantischen Meers instinktiv aus den Produktionsverhältnissen selbst erwachsne Arbeiterbewegung den Ausspruch des englischen Fabrikinspektors R. J. Saunders: „Weitere Schritte zur Reform der Gesellschaft sind niemals mit irgend einer Aussicht auf Erfolg durchzuführen, wenn nicht zuvor der Arbeitstag beschränkt und seine vorgeschriebene Schranke strikt erzwungen wird“(FN 197).
Man muss gestehn, dass unser Arbeiter anders aus dem Produktionsprozess herauskömmt als er in ihn eintrat. Auf dem Markt trat er als Besitzer der Waare „Arbeitskraft“ andern Waarenbesitzern gegenüber, Waarenbesitzer dem Waarenbesitzer. Der Kontrakt, wodurch er dem Kapitalisten seine Arbeitskraft verkaufte, schien durch den freien Willen von Verkäufer und Käufer vereinbartes Produkt. Nach geschlossnem Handel wird entdeckt, dass er „ kein freier Agent“ war, dass die Zeit, wofür es ihm freisteht seine Arbeitskraft zu verkaufen, die Zeit ist, wofür er gezwungen ist sie zu verkaufen(FN 198), dass in der That sein Sauger nicht loslässt, „so lange noch ein Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts auszubeuten“(FN 199). Zum „Schutze“ gegen die Schlange ihrer Qualen müssen die Arbeiter ihre Köpfe zusammenrotten und als Klasse ein
Staatsgesetz erzwingen, ein übermächtiges gesellschaftliches Hinderniss, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen Kontrakt mit dem Kapital sich und ihre Generation in Tod und Sklaverei zu verkaufen(FN 200). An die Stelle des prunkvollen Katalogs der „unveräusserlichen Menschenrechte“ tritt die bescheidne Magna Charta eines gesetzlich beschränkten Arbeitstags, die „endlich klar macht, wann die Zeit, die der Arbeiter verkauft, endet, und wann die ihm selbst gehörige Zeit beginnt“(FN 201). Quantum mutatus ab illo!
Wie bisher, wird in diesem Paragraph der Werth der Arbeitskraft, also der zur Reproduktion oder Erhaltung der Arbeitskraft nothwendige Theil des Arbeitstags, als gegebne, constante Grösse unterstellt.
Diess also vorausgesetzt, ist mit der Rate zugleich die Masse des Mehrwerths gegeben, die der einzelne Arbeiter dem Kapitalisten in bestimmter Zeitperiode liefert. Beträgt z. B. die nothwendige Arbeit täglich 6 Stunden, ausgedrückt in einem Goldquantum von 3 sh. = 1 Thaler, so ist 1 Thaler der Tageswerth einer Arbeitskraft, oder der im Ankauf
einer Arbeitskraft vorgeschossene Kapitalwerth. Ist ferner die Rate des Mehrwerths 100 %, so producirt diess variable Kapital von 1 Thaler eine Masse Mehrwerth von 1 Thaler, oder der Arbeiter liefert täglich eine Masse Mehrarbeit von 6 Stunden.
Das variable Kapital ist aber der Geldausdruck für den Gesammtwerth aller Arbeitskräfte, die der Kapitalist gleichzeitig in einem bestimmten Produktionsprozess verwendet. Ist der Tageswerth einer Arbeitskraft 1 Thaler, so ist also ein Kapital von 100 Thalern vorzuschiessen um 100, und von n Thalern, um n Arbeitskräfte täglich zu exploitiren. Der Werth des vorgeschossenen variablen Kapitals ist also gleich dem Durchschnittswerth einer Arbeitskraft multiplicirt mit der Anzahl der verwandten Arbeitskräfte. Bei gegebnem Werth der Arbeitskraft wechselt also Werthumfang oder Grösse des variablen Kapitals mit der Masse der angeeigneten Arbeitskräfte oder der Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter.
Produzirt ein variables Kapital von 1 Thaler, der Tageswerth einer Arbeitskraft, einen täglichen Mehrwerth von 1 Thaler, so ein variables Kapital von 100 Thalern einen täglichen Mehrwerth von 100, und eins von n Thalern einen täglichen Mehrwerth von 1 Thaler × n. Die Masse des producirten Mehrwerths ist also gleich dem Mehrwerth, den der Arbeitstag des einzelnen Arbeiters liefert, multiplicirt mit der Anzahl der angewandten Arbeiter. Da aber ferner die Masse Mehrwerth, die der einzelne Arbeiter producirt, bei gegebenem Werth der Arbeitskraft, durch die Rate des Mehrwerths bestimmt ist, so folgt, unter derselben Voraussetzung: Die Masse des von einem gegebnen variablen Kapital producirten Mehrwerths ist gleich der Grösse des vorgeschossenen variablen Kapitals multiplicirt mit der Rate des Mehrwerths oder ist bestimmt durch das zusammengesetzte Verhältniss zwischen der Anzahl der gleichzeitig exploitirten Arbeitskräfte und dem Exploitationsgrad der einzelnen Arbeitskraft.
In der Produktion einer bestimmten Masse Mehrwerth kann daher die Abnahme des einen Faktors durch Zunahme des andern ersetzt werden. Wird das variable Kapital vermindert und gleichzeitig in demselben Verhältniss die Rate des Mehrwerths
erhöht, so bleibt die Masse des producirten Mehrwerths unverändert. Muss unter den früheren Annahmen der Kapitalist 100 Thaler vorschiessen, um 100 Arbeiter täglich zu exploitiren, und beträgt die Rate des Mehrwerths 50 %, so wirft diess variable Kapital von 100 einen Mehrwerth von 50 ab, oder von 100 × 3 Arbeitsstunden. Wird die Rate des Mehrwerths verdoppelt, oder der Arbeitstag statt von 6 zu 9, von 6 zu 12 Stunden verlängert, so wirft das um die Hälfte verminderte variable Kapital von 50 Thalern ebenfalls einen Mehrwerth von 50 Thalern ab oder von 50 × 6 Arbeitsstunden. Verminderung des variablen Kapitals ist also ausgleichbar durch proportionelle Erhöhung im Exploitationsgrad der Arbeitskraft oder Abnahme in der Anzahl der beschäftigten Arbeiter durch proportionelle Verlängerung des Arbeitstags. Innerhalb gewisser Grenzen wird die vom Kapital erpressbare Zufuhr der Arbeit also unabhängig von der Arbeiterzufuhr(FN 202). Umgekehrt lässt Abnahmein der Rate des Mehrwerths die Masse des producirten Mehrwerths unverändert, wenn proportionell die Grösse des variablen Kapitals oder die Anzahl der beschäftigten Arbeiter wächst.
Indess hat der Ersatz von Arbeiteranzahl oder Grösse des variablen Kapitals durch gesteigerte Rate des Mehrwerths oder Verlängerung des Arbeitstags unüberspringbare absolute Schranken. Welches immer der Werth der Arbeitskraft sei, ob daher die zur Erhaltung des Arbeiters nothwendige Arbeitszeit 2 oder 10 Stunden betrage, der Gesammtwerth, den ein Arbeiter, Tag aus Tag ein, produciren kann, ist immer kleiner als der Werth, worin sich 24 Arbeitsstunden vergegenständlichen, kleiner als 12 sh. oder 4 Thaler, wenn diess der Geldausdruck der 24 vergegenständlichten Arbeitsstunden. Unter unsrer früheren Annahme, wonach täglich 6 Arbeitsstunden erheischt, um die Arbeitskraft selbst zu reproduciren oder den in ihrem Ankauf vorgeschossenen Kapitalwerth zu ersetzen, producirt ein variables Kapital von 500 Thalern, das täglich 500 Arbeiter zur Mehrwerthsrate von 100 % oder mit zwölfstündigem Arbeitstag verwendet, täglich einen Mehrwerth von 500 Thalern
oder 6 × 500 Arbeitsstunden. Ein Kapital von 100 Thalern, das 100 Arbeiter täglich verwendet zur Mehrwerthsrate von 200 % oder mit 18stündigem Arbeitstag, producirt nur eine Mehrwerths masse von 200 Thalern oder 18 × 100 Arbeitsstunden. Und sein gesammtes Werthprodukt, Aequivalent des vorgeschossenen Kapitals plus Mehrwerth, kann Tag aus Tag ein, niemals die Summe von 400 Thalern oder 24 × 100 Arbeitsstunden erreichen. Die absolute Schranke des durchschnittlichen Arbeitstags, der von Natur immer kleiner ist als 24 Stunden, bildet eine absolute Schranke für den Ersatz von variablem Kapital durch gesteigerte Rate des Mehrwerths oder von exploitirter Arbeiteranzahl durch erhöhten Exploitationsgrad der Arbeitskraft. Diess handgreifliche Gesetz ist wichtig zur Erklärung vieler Erscheinungen, entspringend aus der später zu entwickelnden Tendenz des Kapitals, die von ihm beschäftigte Arbeiteranzahl oder seinen variablen in Arbeitskraft umgesetzten Bestandtheil auf die Minimalschranke zu reduciren, im Widerspruch zu seiner andern Tendenz, die möglichst grosse Masse von Mehrwerth zu produciren. Umgekehrt. Nimmt die Masse der verwandten Arbeitskräfte zu, oder die Grösse des variablen Kapitals, aber langsamer als die Rate des Mehrwerths abnimmt, so sinkt die Masse des producirten Mehrwerths.
Ein drittes Gesetz ergiebt sich aus der Bestimmung der Masse des producirten Mehrwerths durch die zwei Faktoren, Rate des Mehrwerths und Grösse des vorgeschossenen variablen Kapitals. Die Rate des Mehrwerths oder den Exploitationsgrad der Arbeitskraft, und den Werth der Arbeitskraft oder die Grösse der nothwendigen Arbeitszeit gegeben, ist es selbstverständlich, dass je grösser das variable Kapital, desto grösser die Masse des producirten Werths und Mehrwerths. Ist die Grenze des Arbeitstags gegeben, ebenso die Grenze seines nothwendigen Bestandtheils, so hängt die Masse von Werth und Mehrwerth, die ein einzelner Kapitalist producirt, offenbar ausschliesslich ab von der Masse Arbeit, die er in Bewegung setzt. Diese aber hängt, unter den gegebnen Annahmen, ab von der Masse Arbeitskraft oder der Arbeiteranzahl, die er exploitirt, und diese Anzahl ihrerseits ist bestimmt durch die Grösse des von ihm vorgeschossenen variablen Kapitals. Bei gegebner
Rate des Mehrwerths und gegebnem Werth der Arbeitskraft verhalten sich also die Massen des producirten Mehrwerths direkt wie die Grössen der vorgeschossenen variablen Kapitale. Nun weiss man aber, dass der Kapitalist sein Kapital in zwei Theile theilt. Einen Theil legt er aus in Produktionsmitteln. Diess ist der constante Theil seines Kapitals. Den andern Theil setzt er um in lebendige Arbeitskraft. Dieser Theil bildet sein variables Kapital. Auf Basis derselben Produktionsweise findet in verschiednen Produktionssphären verschiedne Theilung des Kapitals in constanten und variablen Bestandtheil statt. Innerhalb derselben Produktionssphäre wechselt diess Verhältniss mit wechselnder technologischer Grundlage und gesellschaftlicher Kombination des Produktionsprozesses. Wie aber ein gegebnes Kapital immer zerfalle in constanten und variablen Bestandtheil, ob der letztere sich zum ersteren verhalte wie 1 : 2, 1 : 10, oder 1 : x, das eben aufgestellte Gesetz wird nicht davon berührt, da, früherer Analyse gemäss, der Werth des constanten Kapitals im Produktenwerth zwar wiedererscheint, aber nicht in das neugebildete Werthprodukt eingeht. Um 1000 Spinner zu verwenden, sind natürlich mehr Rohmaterialien, Spindeln u. s. w. erheischt, als um 100 zu verwenden. Der Werth dieser zuzusetzenden Produktionsmittel aber mag steigen, fallen, unverändert bleiben, gross oder klein sein, er bleibt ohne irgend einen Einfluss auf den Verwerthungsprozess der sie bewegenden Arbeitskräfte. Das oben konstatirte Gesetz nimmt also die allgemeinere Form an: Die von verschiedenen Kapitalien producirten Massen von Werth und Mehrwerth verhalten sich, bei gegebnem Werth und gleich grossem Exploitationsgrad der Arbeitskraft, direkt wie die Grössen der variablen Bestandtheile dieser Kapitale, d. h. ihrer in lebendige Arbeitskraft umgesetzten Bestandtheile.
Diess Gesetz widerspricht offenbar aller auf den Augenschein gegründeten Erfahrung. Jedermann weiss, dass ein Baumwollspinner, der, die Prozenttheile des angewandten Gesammtkapitals berechnet, relativ viel constantes und wenig variables Kapital anwendet, desswegen keinen kleineren Gewinn oder Mehrwerth erbeutet als ein Bäcker, der relativ viel variables und wenig constantes Kapital in Bewegung setzt. Zur Lösung dieses schcinbaren Widerspruchs bedarf es noch vieler Mittelglieder,
wie es vom Standpunkt der elementaren Algebra vieler Mittelglieder bedarf, um zu verstehn, dass eine wirkliche Grösse darstellen kann. Obgleich sie das Gesetz nie formulirt hat, hängt die klassische Oekonomie instinktiv daran fest, weil es eine nothwendige Konsequenz des Werthgesetzes überhaupt ist. Sie sucht es durch gewaltsame Abstraktion vor den Widersprüchen der Erscheinung zu retten. Man wird später(FN 203) sehn, wie die Ricardo’sche Schule an diesem Stein des Anstosses gestolpert ist. Die Vulgärökonomie, die „wirklich auch nichts gelernt hat“, pocht hier, wie überall auf den Schein gegen das Gesetz der Erscheinung. Sie glaubt im Gegensatz zu Spinoza, dass „die Unwissenheit ein hinreichender Grund ist“.
Die Arbeit, die das Gesammtkapital einer Gesellschaft täglich in Bewegung setzt, kann als ein einziger Arbeitstag betrachtet werden. Ist z. B. die Zahl der Arbeiter eine Million und beträgt der DurchschnittsArbeitstag eines Arbeiters 10 Stunden, so besteht der gesellschaftliche Arbeitstag aus 10 Millionen Stunden. Bei gegebner Länge dieses Arbeitstags, seien seine Grenzen physisch oder social gezogen, kann die Masse des Mehrwerths nur vermehrt werden durch Vermehrung der Arbeiteranzahl, d. h. der Arbeiterbevölkerung. Das Wachsthum der Bevölkerung bildet hier die mathematische Grenze für Produktion des Mehrwerths durch das gesellschaftliche Gesammtkapital. Umgekehrt. Bei gegebner Grösse der Bevölkerung wird diese Grenze gebildet durch die mögliche Verlängerung des Arbeitstags(FN 204). Man wird im folgenden Kapital sehn, dass diess Gesetz nur für die bisher behandelte Form des Mehrwerths gilt.
Aus der bisherigen Betrachtung der Produktion des Mehrwerths ergiebt sich, dass nicht jede beliebige Geldoder Werthsumme in Kapital verwandelt werden kann, sondern zu dieser Verwandlung vielmehr ein be-
stimmtes Minimum von Geld oder Tauschwerth in der Hand des einzelnen Geldoder Waarenbesitzers vorausgesetzt ist. Das Minimum von variablem Kapital ist der Kostenpreis einer einzelnen Arbeitskraft, die das ganze Jahr durch, Tag aus Tag ein, zur Gewinnung von Mehrwerth vernutzt wird. Wäre dieser Arbeiter im Besitz seiner eignen Produktionsmittel, und begnügte er sich als Arbeiter zu leben, so genügte ihm die zur Reproduktion seiner Lebensmittel nothwendige Arbeitszeit, sage von 8 Stunden täglich. Er bedürfte also auch nur Produktionsmittel für 8 Arbeitsstunden. Der Kapitalist dagegen, der ihn ausser diesen 8 Stunden sage 4 Stunden Mehrarbeit verrichten lässt, bedarf einer zusätzlichen Geldsumme zur Beschaffung der zusätzlichen Produktionsmittel. Unter unserer Annahme jedoch müsste er schon zwei Arbeiter anwenden, um von dem täglich angeeigneten Mehrwerth wie ein Arbeiter leben, d. h. die nothwendigen Bedürfnisse befriedigen zu können. In diesem Fall wäre blosser Lebensunterhalt der Zweck seiner Produktion, nicht Vermehrung des Reichthums, und das letztre ist unterstellt bei der kapitalistischen Produktion. Damit er nur doppelt so gut lebe wie ein gewöhnlicher Arbeiter, und die Hälfte des producirten Mehrwerths in Kapital zurückverwandle, müsste er zugleich mit der Arbeiterzahl das Minimum des vorgeschossenen Kapitals um das Achtfache steigern. Allerdings kann er selbst, gleich seinem Arbeiter, unmittelbar Hand im Produktionsprozesse anlegen, aber ist dann auch nur ein Mittelding zwischen Kapitalist und Arbeiter, ein „ kleiner Meister“. Ein gewisser Höhegrad der kapitalistischen Produktion bedingt, dass der Kapitalist die ganze Zeit, während deren er als Kapitalist, d. h. als personificirtes Kapital funktionirt, zur Aneignung und daher Kontrole fremder Arbeit, und zum Verkauf der Produkte dieser Arbeit verwenden könne(FN 205). Die Verwandlung des Hand-
werksmeisters in den Kapitalisten suchte die zünftige Industrie des Mittelalters dadurch gewaltsam zu verhindern, dass sie die Arbeiteranzahl, die ein einzelner Meister beschäftigen durfte, auf ein sehr geringes Maximum beschränkte. Der Geldoder Waarenbesitzer verwandelt sich erst wirklich in einen Kapitalisten, wo die für die Produktion vorgeschossene Minimalsumme weit über dem mittelaltrigen Maximum steht. Hier, wie in der Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des von Hegel in seiner Logik entdeckten Gesetzes, dass bloss quantitative Veränderungen auf einem gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlagen(FN 205a).
Das Minimum der Werthsumme, worüber der einzelne Geldoder Waarenbesitzer verfügen muss, um sich in einen Kapitalisten zu entpuppen, wechselt auf verschiedenen Entwicklungsstufen der kapitalistischen Produktion und ist, bei gegebner Entwicklungsstufe, verschieden in verschiedenen Produktionssphären, je nach ihren besondern technologischen Bedingungen. Gewisse Produktionssphären erheischen schon in den Anfängen der kapitalistischen Produktion ein Minimum von Kapital, das sich noch nicht in der Hand einzelner Individuen vorfindet. Diess veranlasst theils Staatssubsidien an solche Private, wie in Frankreich zur Zeit Colberts und wie in manchen deutschen Staaten bis in unsre Epoche hinein, theils die Bildung von Gesellschaften mit gesetzlichem Monopol für den Betrieb gewisser Industrieund Handelszweige(FN 206), — die Vorläufer der modernen Aktiengesellschaften.
Wir halten uns nicht beim Detail der Veränderungen auf, die das Verhältniss von Kapitalist und Lohnarbeiter im Verlaufe des Produktionsprozesses erfuhr, also auch nicht bei den weiteren Fortbestimmungen des Kapitals selbst. Nur wenige Hauptpunkte seien hier betont.
Innerhalb des Produktionsprozesses entwickelte sich das Kapital zum Kommando über die Arbeit, d. h. über die sich bethätigende Arbeitskraft oder den Arbeiter selbst. Das personificirte Kapital, der Kapitalist, passt auf, dass der Arbeiter sein Werk ordentlich und mit dem gehörigen Grad von Intensivität verrichte.
Das Kapital entwickelte sich ferner zu einem Zwangsverhältniss, welches die Arbeiterklasse zwingt mehr Arbeit zu verrichten als der enge Umkreis ihrer eignen Lebensbedürfnisse vorschrieb. Und als Produzent fremder Arbeitsamkeit, als Auspumper von Mehrarbeit und Exploiteur von Arbeitskraft, übergipfelt es an Energie, Masslosigkeit und Wirksamkeit alle früheren auf direkter Zwangsarbeit beruhenden Produktionssysteme.
Das Kapital ordnet sich zunächst die Arbeit unter mit den gegebenen technologischen Bedingungen, worin es sie historisch vorfindet. Es verändert daher nicht unmittelbar die Produktionsweise. Die Produktion von Mehrwerth in der bisher betrachteten Form, durch einfache Verlängerung des Arbeitstags, erschien daher von jedem Wechsel der Produktionsweise selbst unabhängig. Sie war in der altmodischen Bäckerei nicht minder wirksam als in der modernen Baumwollspinnerei. Betrachteten wir den Produktionsprozess daher bloss unter dem Gesichtspunkt des Arbeitsprozesses, so verhielt sich der Arbeiter zu den Produktionsmitteln nicht als Kapital, sondern als blossem Mittel und Material seiner zweckmässigen produktiven Thätigkeit. In einer Gerberei z. B. behandelt er die Felle als seinen blossen Arbeitsgegenstand. Es ist nicht der Kapitalist, dem er das Fell gerbt. Anders, sobald wir den Produktionsprozess unter dem Gesichtspunkt des Verwerthungsprozesses betrachteten. Die Produktionsmittel verwandelten sich sofort in Mittel zur Einsaugung fremder Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Statt von ihm als stoffliche Elemente seiner produktiven Thätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn als Ferment ihres eignen Lebensprozesses, und der Lebensprozess des Kapitals besteht nur in seiner
Bewegung als sich selbst verwerthender Werth. Schmelzöfen und Arbeitsgebäude, die des Nachts ruhn und keine lebendige Arbeit einsaugen, sind „reiner Verlust“ („a mere loss“) für den Kapitalisten. Darum konstituiren Schmelzöfen und Arbeitsgebäude einen „Anspruch auf die Nachtarbeit“ der Arbeitskräfte. Die blosse Verwandlung des Geldes in gegenständliche Faktoren des Produktionsprozesses, in Produktionsmittel, verwandelt letztre in Rechtstitel und Zwangstitel auf fremde Arbeit und Mehrarbeit. Wie diese der kapitalistischen Produktion eigenthümliche und sie charakterisirende Verkehrung, ja Verrückung des Verhältnisses von todter und lebendiger Arbeit, von Werth und werthschöpferischer Kraft, sich im Bewusstsein der Kapitalistenköpfe abspiegelt, zeige schliesslich noch ein Beispiel. Während der englischen Fabrikantenrevolte von 1848—50 schrieb „der Chef der Leinenund Baumwollspinnerei zu Paisley, einer der ältesten und respektabelsten Firmen von Westschottland, der Herrn Carlile, Söhne und Co., deren Kompagnie seit 1752 besteht und Generation nach Generation von derselben Familie geführt wird“, — dieser äusserst intelligente Gentleman also schrieb in die „Glasgow Daily Mail“ vom 25. April 1849 einen Brief(FN 207) unter dem Titel: „ das Relaissystem“, worin u. a. folgende grotesk naive Stelle unterläuft: „Lasst uns nun die Uebel betrachten, die aus einer Reduktion der Arbeitszeit von 12 auf 10 Stunden fliessen . . . . Sie „belaufen“ sich auf die allerernsthafteste Beschädigung der Aussichten und des Eigenthums des Fabrikanten. Arbeitete er (d. h. seine „Hände“) 12 Stunden und wird er auf 10 beschränkt, dann schrumpfen je 12 Maschinen oder Spindeln seines Etablissements auf 10 zusammen, („then every 12 machines or spindles, in his establishment, shrink to 10“), und wollte er seine Fabrik verkaufen, so würden sie nur als 10 gewerthschätzt werden, so dass so ein sechster Theil vom Werth einer jeden Fabrik im ganzen Lande abgezogen würde“(FN 208).
Diesem erbangestammten Kapitalhirn von Westschottland verschwimmt der Werth der Produktionsmittel, Spindeln u. s. w., so sehr mit ihrer Kapitaleigenschaft, sich selbst zu verwerthen, oder täglich ein bestimmtes Quantum fremder Gratisarbeit einzuschlucken, dass der Chef des Hauses Carlile und Co. in der That wähnt, beim Verkauf seiner Fabrik werde ihm nicht nur der Werth der Spindeln gezahlt, sondern obendrein ihre Verwerthung, nicht nur die Arbeit, die in ihnen steckt und zur Produktion von Spindeln derselben Art nöthig ist, sondern auch die Mehrarbeit, die sie täglich aus den braven Westschotten von Paisley auspumpen, und eben desshalb, meint er, schrumpfe mit der Kontraktion des Arbeitstags um zwei Stunden der Verkaufspreis von je 12 Spinnmaschinen auf den von je 10 zusammen!
Viertes Kapitel. Die Produktion des relativen Mehrwerths.↑
1) Begriff des relativen Mehrwerths.↑Der Theil des Arbeitstags, der bloss ein Aequivalent für den vom Kapital gezahlten Werth der Arbeitskraft produzirt, galt uns bisher als constante Grösse, was er in der That ist unter gegebnen Produktionsbedingungen, auf einer vorhandnen ökonomischen Entwicklungsstufe der Gesellschaft. Ueber diese seine nothwendige Arbeitszeit hinaus konnte der Arbeiter 2, 3, 4, 6 u. s. w. Stunden arbeiten. Von der Grösse dieser Verlängerung hingen Rate des Mehrwerths und Grösse des Arbeitstags ab. War die nothwendige Arbeitszeit constant, so dagegen der Gesammtarbeitstag variabel. Unterstelle jetzt einen Arbeitstag, dessen Grösse und dessen Theilung in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit gegeben sind. Die Linie a c a-------------b---c stelle z. B. einen zwölfstündigen Arbeitstag vor, das Stück a b 10 Stunden nothwendige Arbeit, das Stück b c 2 Stunden Mehrarbeit. Wie kann nun die Produktion von Mehrwerth vergrössert, d. h. die Mehrarbeit verlängert werden, ohne jede weitere Verlängerung oder unabhängig von jeder weiteren Verlängerung von a c?
Trotz gegebner Grenzen des Arbeitstags a c scheint b c verlängerbar, wenn nicht durch Ausdehnung über seinen Endpunkt c, der zugleich der Endpunkt des Arbeitstags a c ist, so durch Verschiebung seines Anfangspunkts b in entgegengesetzter Richtung nach a hin. Nimm an, b' b a-------------b'--b----c sei gleich der Hälfte von b c oder gleich einer Arbeitsstunde. Wird nun in dem zwölfstündigen Arbeitstag a c der Punkt b nach b' verrückt, so dehnt sich b c aus zu b' c, die Mehrarbeit wächst um die Hälfte, von 2 auf 3 Stunden, obgleich der Arbeitstag nach wie vor nur 12 Stunden zählt. Diese Ausdehnung der Mehrarbeit von b c auf b' c, von 2 auf 3 Stunden, ist aber offenbar unmöglich ohne gleichzeitige Zusammenziehung der nothwendigen Arbeit von a b auf a b', von 10 auf 9 Stunden. Der Verlängerung der Mehrarbeit entspräche die Verkürzung der nothwendigen Arbeit, oder ein Theil der Arbeitszeit, die der Arbeiter bisher in der That für sich selbst verbraucht, verwandelt sich in Arbeitszeit für den Kapitalisten. Was verändert, wäre nicht die Länge des Arbeitstags, sondern seine Theilung in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit.
Andrerseits ist die Grösse der Mehrarbeit offenbar selbst gegeben mit gegebner Grösse des Arbeitstags und gegebnem Werth der Arbeitskraft. Der Werth der Arbeitskraft, d. h. die zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit, bestimmt die zur Reproduktion ihres Werths nothwendige Arbeitszeit. Stellt sich eine Arbeitsstunde in einem Goldquantum von einem halben Shilling oder 6 d. dar, und beträgt der Tageswerth der Arbeitskraft 5 sh., so muss der Arbeiter täglich 10 Stunden arbeiten, um den ihm vom Kapital gezahlten Tageswerth seiner Arbeitskraft zu ersetzen oder ein Aequivalent für den Werth seiner nothwendigen täglichen Lebensmittel zu produziren. Mit dem Werth dieser Lebensmittel ist der Werth seiner Arbeitskraft(FN 1), mit dem Werth seiner Arbeitskraft ist
die Grösse seiner nothwendigen Arbeitszeit gegeben. Die Grösse der Mehrarbeit aber wird erhalten durch Subtraktion der nothwendigen Arbeitszeit vom Gesammtarbeitstag. Zehn Stunden subtrahirt von zwölf lassen zwei, und es ist nicht abzusehn, wie die Mehrarbeit unter den gegebnen Bedingungen über zwei Stunden hinaus verlängert werden kann. Allerdings mag der Kapitalist statt 5 sh. dem Arbeiter nur 4 sh. 6 d. oder noch weniger zahlen. Zur Reproduktion dieses Werths von 4 sh. 6 d. würden 9 Arbeitsstunden genügen, von dem zwölfstündigen Arbeitstag daher 3 statt 2 Stunden der Mehrarbeit anheimfallen und der Mehrwerth selbst von 1 sh. auf 1 sh. 6 d. steigen. Diess Resultat wäre jedoch nur erzielt durch Herabdrückung des Lohns des Arbeiters unter den Werth seiner Arbeitskraft. Mit den 4 sh. 6 d., die er in 9 Stunden producirt, verfügt er über ⅒ weniger Lebensmittel als vorher und so findet nur eine verkümmerte Reproduktion seiner Arbeitskraft statt. Die Mehrarbeit würde hier nur verlängert durch Ueberschreitung ihrer normalen Grenzen, ihre Domäne nur ausgedehnt durch usurpatorischen Abbruch von der Domäne der nothwendigen Arbeitszeit. Trotz der wichtigen Rolle, welche diese Methode in der wirklichen Bewegung des Arbeitslohnes spielt, ist sie hier ausgeschlossen durch die Voraussetzung, dass die Waaren, also auch die Arbeitskraft, zu ihrem vollen Werth gekauft und verkauft werden. Diess einmal unterstellt, kann die zur Produktion der Arbeitskraft oder zur Reproduktion ihres Werths nothwendige Arbeitszeit nicht abnehmen, weil der Lohn des Arbeiters unter den Werth seiner Arbeitskraft, sondern nur weil dieser Werth selbst sinkt. Bei gegebner Länge des Arbeitstags muss die Verlängerung der Mehrarbeit aus der Verkürzung der nothwendigen Arbeitszeit entspringen, nicht umgekehrt die Verkürzung der nothwendigen Arbeitszeit aus der Verlängerung der Mehrarbeit. In unsrem Beispiel muss der Werth der Arbeitskraft wirklich um ⅒ sinken, damit die nothwendige
Arbeitszeit um ⅒ abnehme, von 10 auf 9 Stunden, und daher die Mehrarbeit sich von 2 auf 3 Stunden verlängere.
Eine solche Senkung des Werths der Arbeitskraft um ⅒ bedingt aber ihrerseits, dass dieselbe Masse Lebensmittel, die früher in 10, jetzt in 9 Stunden producirt wird. Diess ist jedoch unmöglich ohne eine Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit. Mit gegebnen Mitteln kann ein Schuster z. B. ein Paar Stiefel in einem Arbeitstag von 12 Stunden machen. Soll er in derselben Zeit zwei Paar Stiefel machen, so muss sich die Produktivkraft seiner Arbeit verdoppeln, und sie kann sich nicht verdoppeln ohne eine Aenderung in seinen Arbeitsmitteln oder seiner Arbeitsmethode oder beiden zugleich. Es muss daher eine Revolution in den Produktionsbedingungen seiner Arbeit, d. h. in seiner Produktionsweise und daher im Arbeitsprozess selbst eintreten. Unter Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir hier überhaupt eine Veränderung im Arbeitsprozess, wodurch die zur Produktion einer Waare gesellschaftlich erheischte Arbeitszeit verkürzt wird, ein kleineres Quantum Arbeit also die Kraft erwirbt ein grösseres Quantum Gebrauchswerth zu produciren(FN 2). Während also bei der Produktion des Mehrwerths in der bisher betrachteten Form die Produktionsweise als gegeben unterstellt war, genügt es für die Produktion von Mehrwerth durch Verwandlung nothwendiger Arbeit in Mehrarbeit keineswegs, dass das Kapital sich des Arbeitsprozesses in seiner historisch überlieferten oder vorhandenen Gestalt bemächtigt und nur seine Dauer verlängert. Es muss die technologischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses, also die Produktionsweise selbst umwälzen, um die Produktivkraft der Arbeit zu erhöhn, durch die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit den Werth der Arbeitskraft zu senken und so den zur Reproduktion dieses Werths nothwendigen Theil des Arbeitstages zu verkürzen.
Durch Verlängerung des Arbeitstags producirten Mehrwerth nenne ich absoluten Mehrwerth; den Mehrwerth dagegen, der aus Verkürzung der nothwendigen Arbeitszeit und entsprechender Veränderung im Grössenverhältniss der beiden Bestandtheile des Arbeitstags entspringt, — relativen Mehrwerth.
Um den Werth der Arbeitskraft zu senken, muss die Steigerung der Produktivkraft Industriezweige ergreifen, deren Produkte den Werth der Arbeitskraft bestimmen, also entweder dem Umkreis der gewohnheitsmässigen Lebensmittel angehören oder sie ersetzen können. Der Werth einer Waare ist aber nicht nur bestimmt durch das Quantum der Arbeit, welche ihr die letzte Form giebt, sondern ebensowohl durch die in ihren Produktionsmitteln enthaltene Arbeitsmasse. Z. B. der Werth eines Stiefels nicht nur durch die Schusterarbeit, sondern auch durch den Werth von Leder, Pech, Draht u. s. w. Steigerung der Produktivkraft und entsprechende Verwohlfeilerung der Waaren in den Industrien, welche die stofflichen Elemente des constanten Kapitals, die Arbeitsmittel und das Arbeitsmaterial, zur Erzeugung der nothwendigen Lebensmittel liefern, senken also ebenfalls den Werth der Arbeitskraft. In Produktionszweigen dagegen, die weder nothwendige Lebensmittel liefern, noch Produktionsmittel zu ihrer Herstellung, lässt die erhöhte Produktivkraft den Werth der Arbeitskraft unberührt.
Die verwohlfeilerte Waare senkt natürlich den Werth der Arbeitskraft nur pro tanto, d. h. nur im Verhältniss, worin sie in die Reproduktion der Arbeitskraft eingeht. Hemden z. B. sind ein nothwendiges Lebensmittel, aber nur eins von vielen. Ihre Verwohlfeilerung vermindert nur die Ausgabe des Arbeiters für Hemden. Die Gesammtsumme der nothwendigen Lebensmittel besteht zwar nur aus einzelnen Waaren, lauter Produkten besondrer Industrien, und der Werth jeder besondern Waare bildet immer nur einen aliquoten Theil vom Werth der Arbeitskraft. Die Gesammtabnahme dieses Werths, und daher der zu seiner Reproduktion nothwendigen Arbeitszeit, ist jedoch gleich der Summe der Verkürzungen der nothwendigen Arbeitszeit in allen jenen besondren Produktionszweigen. Wir behandeln diess allgemeine Resultat hier so, als wäre es unmittelbares Resultat und unmittelbarer Zweck in jedem einzelnen Fall, obgleich die Sache anders erscheint. Wenn ein einzel-
ner Kapitalist durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit z. B. Hemden verwohlfeilert, schwebt ihm keineswegs nothwendig der Zweck vor, den Werth der Arbeitskraft und daher die nothwendige Arbeitszeit pro tanto zu senken, aber nur soweit er schliesslich zu diesem Resultat beiträgt, trägt er bei zur Erhöhung der allgemeinen Rate des Mehrwerths(FN 3). Die allgemeinen und nothwendigen Tendenzen des Kapitals sind zu unterscheiden von ihren Erscheinungsformen.
Die Darstellung der Art und Weise, wie die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion in der äussern Bewegung der Kapitale erscheinen, sich als Zwangsgesetze der Konkurrenz geltend machen, und daher als treibende Motive dem individuellen Kapitalisten zum Bewusstsein kommen, fällt ausserhalb der Schranken dieser Schrift. Wissenschaftliche Analyse der Konkurrenz ist überhaupt nur möglich, sobald die innere Natur des Kapitals begriffen ist. Ganz wie die scheinbare Bewegung der Himmelskörper nur dem verständlich, der ihre wirkliche, aber sinnlich nicht wahrnehmbare Bewegung kennt. Dennoch ist zum Verständniss der Produktion des relativen Mehrwerths, und bloss auf Grundlage der bereits gewonnenen Resultate, Folgendes zu bemerken.
Stellt sich eine Arbeitsstunde in einem Goldquantum von 6 d. oder ½sh. dar, so wird in zwölfstündigem Arbeitstag ein Werth von 6 sh. producirt. Gesetzt mit der gegebnen Produktivkraft der Arbeit würden 12 Stück Waaren in diesen 12 Arbeitsstunden verfertigt. Der Werth der in jedem Stück vernutzten Produktionsmittel, Rohmaterial u. s. w., sei 6 d. Unter diesen Umständen kostet die einzelne Waare 1 sh., nämlich 6 d. für den Werth der Produktionsmittel, 6 d. für den in ihrer Verarbeitung neu zugesetzten Werth. Es gelinge nun einem Kapitalisten die Produktivkraft der Arbeit zu verdoppeln und daher 24 Stück dieser Waarenart statt 12 in dem zwölfstündigen Arbeitstag zu produciren. Bei unverändertem Werth der Produktionsmittel sinkt der Werth der einzelnen Waare jetzt auf 9 d., nämlich 6 d.
für den Werth der Produktionsmittel, 3 d. für den durch die letzte Arbeit neu zugesetzten Werth. Trotz der verdoppelten Produktivkraft schafft der Arbeitstag nach wie vor nur einen Neuwerth von 6 sh. Aber dieser Werth vertheilt sich auf doppelt so viel Produkte. Auf jedes einzelne Produkt fällt daher nur noch dieses Gesammtwerths statt früher
, 3 d. statt 6 d., oder, was dasselbe ist, den Produktionsmitteln wird bei ihrer Verwandlung in Produkt, jedes Stück berechnet, jetzt nur noch eine halbe statt wie früher eine ganze Arbeitsstunde zugesetzt. Der individuelle Werth dieser Waare steht nun unter ihrem gesellschaftlichen Werth, d. h. sie kostet weniger Arbeitszeit als der grosse Haufen derselben Artikel, producirt unter den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen. Das Stück kostet im Durchschnitt 1 sh. oder stellt 2 Stunden gesellschaftlicher Arbeit dar; mit der veränderten Produktionsweise kostet es nur 9 d. oder enthält nur 1½ Arbeitsstunden. Der wirkliche Werth einer Waare ist aber nicht durch ihren individuellen, sondern durch ihren gesellschaftlichen Werth bestimmt, d. h. nicht durch die Arbeitszeit, die sie im einzelnen Fall dem Produzenten thatsächlich kostet, sondern durch die gesellschaftlich zu ihrer Produktion erheischte Arbeitszeit. Verkauft also der Kapitalist, der die neue Methode anwendet, seine Waare zu ihrem gesellschaftlichen Werth von 1 sh., so verkauft er sie 3 d. über ihrem individuellen Werth und realisirt so einen Extra-Mehrwerth von 3 d. Andrerseits stellt sich aber der zwölfstündige Arbeitstag jetzt für ihn in 24 Stück Waare dar statt früher in 12. Um also das Produkt eines Arbeitstags zu verkaufen, bedarf er doppelten Absatzes oder eines zweifach grösseren Markts. Unter sonst gleichbleibenden Umständen erobern seine Waaren nur grösseren Marktraum durch Kontraktion ihrer Preise. Er wird sie daher über ihrem individuellen, aber unter ihrem gesellschaftlichen Werth verkaufen, sage zu 10 d. das Stück. So schlägt er an jedem einzelnen Stück immer noch einen Extra-Mehrwerth von 1 d. heraus. Diese Steigerung des Mehrwerths findet für ihn statt, ob oder ob nicht seine Waare dem Umkreis der nothwendigen Lebensmittel angehört und daher bestimmend in den allgemeinen Werth der Arbeitskraft eingeht. Vom letztren Umstand abgesehn, existirt also für jeden einzelnen Kapitalisten das Motiv die Waare durch erhöhte Produktivkraft der Arbeit zu verwohlfeilern.
Indess entspringt selbst in diesem Fall die gesteigerte Produktion von
Mehrwerth aus der Verkürzung der nothwendigen Arbeitszeit und entsprechender Verlängerung der Mehrarbeit(FN 3a). Die nothwendige Arbeitszeit betrug 10 Stunden oder der Tageswerth der Arbeitskraft 5 sh., die Mehrarbeit 2 Stunden, der täglich producirte Mehrwerth daher 1 sh. Unser Kapitalist producirt aber jetzt 24 Stück, die er zu 10 d. per Stück oder zusammen zu 20 sh. verkauft. Da der Werth der Produktionsmittel gleich 12 sh., ersetzen 14⅖ Stück Waare nur das vorgeschossene constante Kapital. Der zwölfstündige Arbeitstag stellt sich in den übrigbleibenden 9⅗ Stück dar. Da der Preis der Arbeitskraft = 5 sh., stellt sich im Produkt von 6 Stück die nothwendige Arbeitszeit dar und in 3⅗ Stück die Mehrarbeit. Die nothwendige Arbeitszeit beträgt jetzt weniger als ⅔, die Mehrarbeit mehr als ⅓ des Arbeitstags, während unter den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen die nothwendige Arbeit ⅚ und die Mehrarbeit nur ⅙ des Arbeitstags einnimmt. Dasselbe Resultat erhält man so: Der Produktenwerth des zwölfstündigen Arbeitstags ist 20 sh. Davon gehören 12 sh. dem nur wieder erscheinenden Werth der Produktionsmittel. Bleiben also 8 sh. als Geldausdruck des Werths, worin sich der Arbeitstag darstellt. Dieser Geldausdruck ist höher als der Geldausdruck der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit von derselben Sorte, wovon sich 12 Stunden nur in 6 sh. ausdrücken. Die Arbeit von ausnahmsweiser Produktivkraft wirkt als potenzirte Arbeit oder schafft in gleichen Zeiträumen höhere Werthe als die gesellschaftliche Durchschnittsarbeit derselben Art. Aber unser Kapitalist zahlt nach wie vor nur 5 sh. für den Tageswerth der Arbeitskraft. Der Arbeiter bedarf daher statt früher 10, jetzt weniger als 8 Stunden zur Reproduktion dieses Werths. Seine Mehrarbeit wächst daher von 2 Stunden auf mehr als 4, der von ihm producirte Mehrwerth von 1 sh. auf 3 sh. 6 d. Der Kapitalist, der die verbesserte Produktionsweise anwendet, eignet sich daher einen grösseren Theil des Arbeitstags für Mehrarbeit an, als die übrigen Kapita-
listen in demselben Geschäft. Er thut im Einzelnen, was das Kapital bei der Produktion des relativen Mehrwerths im Grossen und Ganzen thut. Andrerseits aber verschwindet jener Extra-Mehrwerth, sobald die neue Produktionsweise sich verallgemeinert und damit die Differenz zwischen dem individuellen Werth der wohlfeiler producirten Waaren und ihrem gesellschaftlichen Werth verschwindet. Dasselbe Gesetz der Werthbestimmung durch die Arbeitszeit, das dem Kapitalisten mit der neuen Methode in der Form fühlbar wird, dass er seine Waare unter ihrem gesellschaftlichen Werth verkaufen muss, treibt seine Mitbewerber als Zwangsgesetz der Konkurrenz zur Einführung der neuen Produktionsweise(FN 4). Die allgemeine Rate des Mehrwerths wird also durch den ganzen Prozess schliesslich nur berührt, wenn die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit Produktionszweige ergriffen, also Waaren verwohlfeilert hat, die in den Kreis der nothwendigen Lebensmittel eingehn, daher Elemente des Werths der Arbeitskraft bilden.
Der Werth der Waaren steht in umgekehrtem Verhältniss zur Produktivkraft der Arbeit. Ebenso, weil durch Waarenwerthe bestimmt, der Werth der Arbeitskraft. Dagegen steht der relative Mehrwerth in direktem Verhältniss zur Produktivkraft der Arbeit. Er steigt mit steigender und fällt mit fallender Produktivkraft. Ein gesellschaftlicher Durchschnittsarbeitstag von 12 Stunden, Geldwerth als gleichbleibend vorausgesetzt, producirt stets dasselbe Werthprodukt von 6 sh., wie diese Werthsumme sich immer vertheile zwischen Aequivalent für den Werth der Arbeitskraft und Mehrwerth. Fällt aber in Folge gesteigerter Produktivkraft der Werth der täglichen Lebensmittel und daher der Tageswerth der Arbeitskraft von 5 sh. auf 3 sh., so wächst der Mehrwerth von 1 sh. auf 3 sh. Um den Werth der Arbeitskraft zu reproduciren, waren 10 und sind jetzt nur noch 6 Ar-
beitsstunden nöthig. Vier Arbeitsstunden sind frei geworden und können der Domäne der Mehrarbeit annexirt werden. Es ist daher der immanente Trieb und die beständige Tendenz des Kapitals die Produktivkraft der Arbeit zu steigern, um die Waare und durch die Verwohlfeilerung der Waare den Arbeiter selbst zu verwohlfeilern(FN 5).
Der absolute Werth der Waare ist dem Kapitalisten, der sie producirt, an und für sich gleichgültig. Ihn interessirt nur der in ihr steckende und im Verkauf realisirbare Mehrwerth. Realisirung von Mehrwerth schliesst von selbst Ersatz des vorgeschossenen Werths ein. Da nun der relative Mehrwerth in direktem Verhältniss zur Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wächst, während der Werth der Waaren in umgekehrtem Verhältniss zur selben Entwicklung fällt, da also derselbe identische Prozess die Waaren verwohlfeilert und den in ihnen enthaltenen Mehrwerth steigert, löst sich das Räthsel, dass der Kapitalist, dem es nur um die Produktion von Tauschwerth zu thun ist, den Tauschwerth der Waaren beständig zu senken strebt, ein Widerspruch, womit einer der Gründer der politischen Oekonomie, Dr. Quesnay, seine Gegner quälte und worauf sie ihm die Antwort schuldig blieben. „Ihr gebt zu“, sagt Quesnay, „dass je mehr man, ohne Nachtheil für die Produktion, Kosten oder kostspielige Arbeiten in der Fabrikation industrieller Produkte ersparen kann, desto vortheilhafter diese Ersparung, weil sie den Preis des Machwerks vermindert. Und trotzdem glaubt ihr, dass die Produktion des Reich-
thums, der aus den Arbeiten der Industriellen resultirt, in der Vermehrung des Tauschwerths ihres Machwerks besteht“(FN 6).
Oekonomie der Arbeit durch Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit(FN 7) bezweckt in der kapitalistischen Produktion also durchaus nicht Verkürzung des Arbeitstags. Sie bezweckt nur Verkürzung der für Produktion eines bestimmten Waarenquantums nothwendigen Arbeitszeit. Dass der Arbeiter bei gesteigerter Produktivkraft seiner Arbeit in einer Stunde z. B. 10 mal mehr Waare als früher producirt, also für jedes Stück Waare 10 mal weniger Arbeitszeit braucht, verhindert durchaus nicht, ihn nach wie vor 12 Stunden arbeiten und in den 12 Stunden 1200 statt früher 120 Stück produciren zu lassen. Ja sein Arbeitstag mag gleichzeitig verlängert werden, so dass er jetzt in 14 Stunden 1400 Stück producirt u. s. w. Man kann daher bei Oekonomen vom Schlag eines Mac Culloch, Ure, Senior und tutti quanti auf einer Seite lesen, dass der Arbeiter dem Kapital für die Entwicklung der Produktivkräfte Dank schuldet, weil sie die nothwendige Arbeitszeit verkürzt, und auf der nächsten Seite, dass er diesen Dank beweisen muss, indem er statt 10 künftig 15 Stunden arbeitet. Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, innerhalb der kapitalistischen Produktion, bezweckt den Theil des Arbeitstags, den der Arbeiter für sich selbst arbeiten muss, zu verkürzen, um grade dadurch den andern Theil des Arbeitstags, den er
für den Kapitalisten umsonst arbeiten kann, zu verlängern. Wie weit diess Resultat auch ohne Verwohlfeilerung der Waaren erreichbar, wird sich zeigen in den besondern Produktionsmethoden des relativen Mehrwerths, zu deren Betrachtung wir jetzt übergehn.
Die kapitalistische Produktion, wie wir sahen, beginnt in der That erst, wo dasselbe individuelle Kapital eine grössere Anzahl Arbeiter gleichzeitig beschäftigt, der Arbeitsprozess also seinen Umfang erweitert und Produkt auf grösserer quantitativer Stufenleiter liefert. Nur wo die Arbeiteranzahl hinreicht, damit die von ihr producirte Masse von Mehrwerth den Arbeitsanwender selbst von der Arbeit entbinde, wird der letztere vollbürtiger Kapitalist. Das Wirken einer grössern Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (oder, wenn man will, auf demselben Arbeitsfeld), zur Produktion derselben Waarensorte, unter dem Kommando desselben Kapitalisten, bildet daher historisch und begrifflich den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Mit Bezug auf die Produktionsweise selbst unterscheidet sich z. B. die Manufaktur in ihren Anfängen kaum anders von der zünftigen Handwerksindustrie als durch die grössere Zahl der gleichzeitig von demselben Kapital beschäftigten Arbeiter. Die Werkstatt des Zunftmeisters ist nur erweitert.
Der Unterschied ist also zunächst bloss quantitativ. Man sah, dass die Masse des Mehrwerths, welche ein gegebnes Kapital producirt, gleich dem Mehrwerth, den der einzelne Arbeiter liefert, multiplicirt mit der Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter. Diese Anzahl ändert an und für sich nichts an der Rate des Mehrwerths oder dem Exploitationsgrad der Arbeitskraft. Was aber die Produktion von Waarenwerth überhaupt betrifft, so scheint für sie selbst jede qualitative Veränderung des Arbeitsprozesses gleichgültig. Es folgt diess aus der Natur des Tauschwerths, der nichts ist als ein bestimmtes Quantum vergegenständlichter Arbeit. Vergegenständlicht sich ein zwölfstündiger Arbeitstag in 6 sh., so 1200 solcher Arbeitstage in 6 sh. × 1200. In dem einen Fall haben sich 12 × 1200, in dem andern 12 Arbeitsstunden den Produkten einverleibt. In der Werthproduktion zählen Viele immer nur als viele Einzelne. Für die Werthproduktion macht es also keinen
qualitativen Unterschied, ob 1200 Arbeiter vereinzelt oder ob sie unter dem Kommando desselben Kapitals vereint produciren.
Indess findet doch innerhalb gewisser Grenzen eine Modifikation statt. Die im Werth vergegenständlichte Arbeit ist Arbeit von gesellschaftlicher Durchschnittsqualität und so ist der Werth der Arbeitskraft der Werth durchschnittlicher Arbeitskraft. Eine Durchschnittsgrösse existirt aber immer nur als Durchschnitt vieler verschiedner Grössenindividuen derselben Art. In jedem Industriezweig weicht der individuelle Arbeiter, Peter oder Paul, mehr oder minder vom Durchschnittsarbeiter ab. Diese individuellen Abweichungen oder was man mathematisch „Irrthümer“ nennt, kompensiren sich und verschwinden, sobald man eine grössere Anzahl Arbeiter zusammennimmt. Der berühmte Sophist und Sykophant Edmund Burke will aus seinen praktischen Erfahrungen als Pächter sogar wissen, dass schon „für ein so geringes Peloton“ wie 5 Ackerknechte aller individuelle Unterschied der Arbeit verschwindet, also die ersten besten im Mannesalter befindlichen fünf englischen Ackerknechte zusammengenommen in derselben Zeit grad so viel Arbeit verrichten als beliebige andre fünf englische Ackerknechte(FN 8). Die von ihm angegebne Zahl ist hier gleichgültig, aber es ist klar, dass der Gesammtarbeitstag einer grössern Anzahl gleichzeitig beschäftigter Arbeiter an und für sich ein Tag gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit ist. Der Arbeitstag des Einzelnen sei z. B. zwölfstündig. So bildet der Arbeitstag von 12 gleichzeitig beschäftigten Arbeitern einen Gesammtarbeitstag von 144 Stunden, und obgleich die Arbeit eines Jeden des Dutzend mehr oder minder von der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit abweichen, der Einzelne daher etwas mehr oder weniger Zeit zu derselben Verrichtung brauchen mag, besitzt der Arbeitstag jedes Einzelnen als ein Zwölftel des Ge-
sammtarbeitstags von 144 Stunden die gesellschaftliche Durchschnittsqualität. Für den Kapitalisten aber, der ein Dutzend beschäftigt, existirt der Arbeitstag als Gesammtarbeitstag des Dutzend. Der Arbeitstag jedes Einzelnen existirt als aliquoter Theil des Gesammtarbeitstags, ganz unabhängig davon, ob die Zwölf einander in die Hand arbeiten oder ob der ganze Zusammenhang ihrer Arbeiten nur darin besteht, dass sie für denselben Kapitalisten arbeiten. Werden dagegen von den 12 Arbeitern je zwei von einem kleinen Meister beschäftigt, so wird es zufällig, ob jeder einzelne Meister dieselbe Werthmasse producirt und daher die allgemeine Rate des Mehrwerths realisirt. Es fänden individuelle Abweichungen statt. Verbrauchte ein Arbeiter bedeutend mehr Zeit in der Produktion einer Waare als gesellschaftlich erheischt ist, wiche die für ihn individuell nothwendige Arbeitszeit bedeutend ab von der gesellschaftlich nothwendigen oder der Durchschnitts-Arbeitszeit, so gälte seine Arbeit nicht als Durchschnittsarbeit, seine Arbeitskraft nicht als durchschnittliche Arbeitskraft. Sie verkaufte sich gar nicht oder nur unter dem Durchschnittswerth der Arbeitskraft. Ein bestimmtes Minimum der Arbeitsfertigkeit ist also vorausgesetzt, und wir werden später sehn, dass die kapitalistische Produktion Mittel findet, diess Minimum zu messen. Nichts desto weniger weicht das Minimum vom Durchschnitt ab, obgleich auf der andern Seite der Durchschnittswerth der Arbeitskraft gezahlt werden muss. Von den sechs Kleinmeistern würde der eine daher mehr, der andre weniger als die allgemeine Rate des Mehrwerths herausschlagen. Die Ungleichheiten würden sich für die Gesellschaft kompensiren, aber nicht für den einzelnen Meister. Das Gesetz der Verwerthung überhaupt realisirt sich also für den einzelnen Produzenten erst vollständig, sobald er als Kapitalist producirt, viele Arbeiter gleichzeitig anwendet, also von vorn herein gesellschaftliche Durchschnittsarbeit in Bewegung setzt(FN 9).
Auch bei gleichbleibender Arbeitsweise bewirkt die gleich-
zeitige Anwendung einer grösseren Arbeiteranzahl eine Revolution in den gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses. Die Baulichkeiten, worin die Vielen arbeiten, die Lager für Rohmaterial, halbfertige Waaren u. s. w., die Gefässe, Instrumente, Apparate u. s. w., die von vielen gleichzeitig oder abwechselnd gebraucht werden können, kurz ein Theil der Produktionsmittel wird jetzt gemeinsam im Arbeitsprozess konsumirt. Einerseits wird der Tauschwerth von Waaren, also auch von Produktionsmitteln, durchaus nicht erhöht durch irgend welche erhöhte Ausbeutung ihres Gebrauchswerths. Andrerseits wächst zwar der Massstab der gemeinsam gebrauchten Produktionsmittel. Ein Zimmer, worin 20 Weber mit ihren 20 Webstühlen arbeiten, muss weiter gestreckt sein als das Zimmer eines unabhängigen Webers mit zwei Gesellen. Aber die Produktion einer Werkstatt für 20 Personen kostet weniger Arbeit als die von 10 Werkstätten für je zwei Personen, und so wächst überhaupt der Werth massenweise koncentrirter und gemeinsamer Produktionsmittel nicht verhältnissmässig mit ihrem Umfang und ihrem Nutzeffekt. Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben geringeren Werthbestandtheil an das einzelne Produkt ab, theils weil der Gesammtwerth, den sie abgeben, sich gleichzeitig auf eine grössere Produktenmasse vertheilt, theils weil sie in Folge ihres vergrösserten Umfangs zwar mit absolut grösserem, aber, im Verhältniss zu ihrem Wirkungskreis, mit relativ kleinerem Werth als vereinzelte Produktionsmittel in den Produktionsprozess eintreten. Damit sinkt ein Werthbestandtheil, welcher constantes Kapital ersetzt, also, proportionell zur Grösse dieses Bestandtheils, auch der Gesammtwerth der Waare. Die Wirkung ist dieselbe, als hätte sich die Produktivkraft der Arbeit vermehrt in solchen Industriezweigen, die Produktionsmittel liefern. Diese Oekonomie in der Anwendung der Produktionsmittel entspringt nur aus ihrem gemeinsamen Konsum im Arbeitsprozess Vieler. Und sie erhalten diesen Charakter als Bedingungen gesellschaftlicher Arbeit oder gesellschaftliche Bedingungen der Arbeit im Unterschied von den zersplitterten und relativ theureren Produktionsbedingungen vereinzelter selbstständiger Arbeiter oder Kleinmeister, selbst wenn die Vielen nur räumlich zusammen, nicht mit einander arbeiten. Ein Theil der Arbeitsmittel erwirbt diesen gesellschaftlichen Charakter, bevor ihn der Arbeitsprozess selbst erwirbt.
Die Oekonomie der Produktionsmittel ist überhaupt von doppeltem Gesichtspunkt zu betrachten. Das einemal, so weit sie Waaren verwohlfeilert und dadurch den Werth der Arbeitskraft senkt. Das andremal, so weit sie das Verhältniss des Mehrwerths zum vorgeschossnen Gesammtkapital, d. h. zur Werthsumme seiner constanten und variablen Bestandtheile, verändert. Der letztere Punkt wird erst im dritten Buch dieses Werks erörtert, wohin wir des Zusammenhangs wegen auch manches schon hierher gehörige verweisen. Einerseits gebietet der Gang der Analyse diese Zerreissung des Gegenstands. Andrerseits entspricht sie dem Geist der kapitalistischen Produktion. Da nämlich die Arbeitsbedingungen hier dem Arbeiter selbststäudig gegenübertreten, erscheint auch ihre Oekonomie als eine besondere Operation, die ihn nichts angeht und daher getrennt ist von den Methoden, wodurch die Produktivität der vom Kapital konsumirten Arbeitskraft erhöht wird.
Die Form der Arbeit Vieler, die in demselben Produktionsprozess oder in verschiedenen, aber zusammenhängenden Produktionsprozessen, planmässig neben und mit einander arbeiten, heisst Cooperation(FN 10).
Wie die Angriffskraft einer Kavalerieschwadron oder die Widerstandskraft eines Infanterieregiments wesentlich verschieden ist von der Summe der vereinzelten Angriffsund Widerstandskräfte, welche jeder Kavalerist und Infanterist für sich entwickeln könnte, so die mechanische Kraftsumme vereinzelter Arbeiter von der mechanischen Kraftpotenz, die sich entwickelt, wenn viele Hände gleichzeitig in derselben ungetheilten Operation zusammenwirken, z. B. wenn es gilt eine Last zu heben, eine Kurbel zu drehn oder einen Widerstand aus dem Weg zu räumen(FN 11). Die Wirkung der kombinirten Arbeit könnte hier von der vereinzelten gar nicht oder nur in viel längeren Zeiträumen oder nur auf einem Zwergmassstab hervorgebracht werden. Es handelt sich hier nicht
nur um Erhöhung der individuellen Produktivkraft durch die Cooperation, sondern um die Schöpfung einer Produktivkraft, die an und für sich Massenkraft ist(FN 11a).
Abgesehn von der neuen mechanischen Kraftpotenz, die aus der Verschmelzung vieler Kräfte in eine Gesammtkraft entspringt, erzeugt bei den meisten produktiven Arbeiten der blosse gesellschaftliche Kontakt einen Wetteifer und eine eigne Erregung der Lebensgeister (animal spirit), welche die individuelle Leistungsfähigkeit der Einzelnen erhöhen, so dass ein Dutzend Personen zusammen in einem gleichzeitigen Arbeitstag von 144 Stunden ein viel grösseres Gesammtprodukt liefern als zwölf vereinzelte Arbeiter, von denen jeder 12 Stunden, oder als ein Arbeiter, der 12 Tage nach einander arbeitet(FN 12). Diess rührt daher, dass der Mensch von Natur, wenn nicht, wie Aristoteles meint, ein politisches(FN 13), jedenfalls ein gesellschaftliches Thier ist.
Obgleich Viele Dasselbe oder Gleichartiges gleichzeitig mit einander verrichten, kann die individuelle Arbeit eines Jeden dennoch als Theil der Gesammtarbeit verschiedne Phasen des Arbeitsprozesses selbst darstellen, die der Arbeitsgegenstand, in Folge der Coo-
peration, rascher durchläuft. Z. B., wenn Maurer eine Reihe von Händen bilden, um Bausteine vom Fuss eines Gestells bis zu seiner Spitze zu befördern, thut jeder von ihnen dasselbe, aber dennoch bilden die einzelnen Verrichtungen continuirliche Theile einer Gesammtverrichtung, besondre Phasen, die jeder Baustein im Arbeitsprozess durchlaufen muss, und wodurch ihn etwa die 24 Hände des Gesammtarbeiters rascher befördern, als die zwei Hände jedes einzelnen Arbeiters, der das Gerüst aufund abstiege(FN 14). Der Arbeitsgegenstand durchläuft denselben Raum in kürzerer Zeit. Andrerseits findet Kombination der Arbeit statt, wenn ein Bau z. B. von verschiednen Seiten gleichzeitig angegriffen wird, obgleich die Cooperirenden Dasselbe oder Gleichartiges thun. Der kombinirte Arbeitstag von 144 Stunden, der den Arbeitsgegenstand vielseitig im Raum angreift, weil der kombinirte Arbeiter oder Gesammtarbeiter vorn und hinten Augen und Hände hat und in gewissem Grad Allgegenwart besitzt, fördert das Gesammtprodukt rascher als 12 zwölfstündige Arbeitstage mehr oder minder vereinzelter Arbeiter, die ihr Werk einseitiger angreifen müssen. In derselben Zeit reifen verschiedne Raumtheile des Produkts.
Wir betonten hier, dass die Vielen, die einander ergänzen, Dasselbe oder Gleichartiges thun, weil diese einfache Form der Cooperation, wie man später sehn wird, auch in ihrer ausgebildetsten Gestalt eine grosse Rolle spielt. Ist der Arbeitsprozess komplicirt, so erlaubt die blosse Masse der Zusammenarbeitenden die verschiedenen Operationen unter verschiedne Hände zu vertheilen, daher gleichzeitig zu verrichten, und dadurch die zur Herstellung des Gesammtprodukts nöthige Arbeitszeit zu verkürzen(FN 15).
In vielen Produktionssphären giebt es kritische Momente, d. h. durch die Natur des Arbeitsprozesses selbst bestimmte Zeitepochen, während deren bestimmte Arbeitsresultate erzielt werden müssen. Soll z. B. eine Heerde Schafe geschoren oder eine Morgenanzahl Kornland gemäht und geherbstet werden, so hängt Quantität und Qualität des Produkts davon ab, dass die Operation zu einer gewissen Zeit begonnen und zu einer gewissen Zeit beendet wird. Der Zeitraum, den der Arbeitsprozess einnehmen darf, ist hier vorgeschrieben, wie etwa beim Häringsfang. Der Einzelne kann aus einem Tag nur einen Arbeitstag herausschneiden, sage von 12 Stunden, aber die Cooperation von 100 z. B. erweitert einen zwölfstündigen Tag zu einem Arbeitstag von 1200 Stunden. Die Kürze der Arbeitsfrist wird kompensirt durch die Grösse der Arbeitsmasse, die im entscheidenden Augenblick auf das Produktionsfeld geworfen wird. Die rechtzeitige Wirkung hängt hier ab von der gleichzeitigen Anwendung vieler kombinirten Arbeitstage, der Umfang des Nutzeffekts von der Arbeiteranzahl, die jedoch stets kleiner bleibt als die Anzahl der Arbeiter, die vereinzelt in demselben Zeitraum denselben Wirkungsraum ausfüllen würden(FN 16). Es ist der Mangel dieser Cooperation, wodurch im Westen der Vereinigten Staaten eine Masse Korn, und in den Theilen Ostindiens, wo englische Herrschaft das alte Gemeinwesen zerstört hat, eine Masse Baumwolle jährlich verwüstet wird(FN 17).
Auf der einen Seite erweitert die Cooperation die Raumsphäre der Arbeit und wird daher für gewisse Arbeitsprozesse schon durch die räumliche Continuität des Arbeitsgegenstandes erheischt, wie bei Trockenlegung von Land, Eindämmung, Bewässerung, Kanal-, Strassen-, Eisenbahnbauten u. s. w. Andrerseits erlaubt sie, verhältnissmässig zur Stufenleiter der Produktion, räumliche Kontraktion des Produktionsgebiets. Diese Beschränkung der Raumsphäre der Arbeit bei gleichzeitiger Ausdehnung ihrer Wirkungssphäre, wodurch eine Masse falscher Kosten (faux frais) erspart werden, entspringt aus der Konglomeration der Arbeiter, dem Zusammenrücken verschiedner Arbeitsprozesse, und der Koncentration der Produktionsmittel(FN 18).
Verglichen mit einer gleich grossen Summe vereinzelter individueller Arbeitstage, producirt der kombinirte Arbeitstag grössere Massen von Gebrauchswerth und vermindert daher die zur Produktion eines bestimmten Nutzeffekts nöthige Arbeitszeit. Ob er im gegebenen Fall diese gesteigerte Produktivkraft erhält, weil er die mechanische Kraftpotenz der Arbeit erhöht, oder ihre räumliche Wirkungssphäre ausdehnt, oder das räumliche Produktionsfeld im Verhältniss zur Stufenleiter der Produktion kontrahirt, oder im kritischen Moment viel Arbeit in wenig Zeit flüssig macht, oder den Wetteifer der Einzelnen erregt und ihre Lebensgeister spannt, oder den gleichartigen Verrichtungen Vieler den Stempel der Kontinuität und Vielseitigkeit aufdrückt, oder verschiedene Operationen gleichzeitig verrichtet, oder die Produktionsmittel durch ihren gemeinschaftlichen Gebrauch ökonomisirt, oder der individuellen Arbeit den Cha-
rakter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit verleiht, unter allen Umständen ist die spezifische Produktivkraft des kombinirten Arbeitstags gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher Arbeit. Sie entspringt aus der Cooperation selbst. Im planmässigen Zusammenwirken mit Andern streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein Gattungsvermögen(FN 19).
Wenn Arbeiter überhaupt nicht unmittelbar zusammenwirken können, ohne zusammen zu sein, ihre Konglomeration auf bestimmtem Raum daher Bedingung ihrer Cooperation ist, können Lohnarbeiter nicht cooperiren, ohne dass dasselbe Kapital, derselbe Kapitalist sie gleichzeitig anwendet, also ihre Arbeitskräfte gleichzeitig kauft. Der Gesammtwerth dieser Arbeitskräfte, oder die Lohnsumme der Arbeiter für den Tag, die Woche u. s. w., muss daher in der Tasche des Kapitalisten vereint sein, bevor die Arbeitskräfte selbst im Produktionsprozess vereint werden. Zahlung von 300 Arbeitern auf einmal, auch nur für einen Tag, bedingt mehr Kapitalauslage als Zahlung weniger Arbeiter Woche für Woche während des ganzen Jahrs. Die Anzahl der cooperirenden Arbeiter, oder die Stufenleiter der Cooperation, hängt also zunächst ab von der Grösse des Kapitals, das der einzelne Kapitalist im Ankauf von Arbeitskraft auslegen kann, d. h. von dem Umfang, worin je ein Kapitalist über die Lebensmittel vieler Arbeiter verfügt.
Und wie mit dem variablen, verhält es sich mit dem constanten Kapital. Die Auslage für Rohmaterial z. B. ist 30 mal grösser für den einen Kapitalisten, der 300, als für jeden der 30 Kapitalisten, der je 10 Arbeiter beschäftigt. Werthumfang und Stoffmasse der gemeinsam benutzten Arbeitsmittel wachsen zwar nicht in demselben Mass wie die beschäftigte Arbeiteranzahl, aber sie wachsen beträchtlich. Koncentration grösserer Massen von Produktionsmitteln in der Hand einzelner Kapitalisten ist also materielle Bedingung für die Cooperation von Lohnarbeitern, und der Umfang der Cooperation, oder
die Stufenleiter der Produktion, hängt ab vom Umfang dieser Koncentration.
Ursprünglich erschien eine gewisse Minimalgrösse des Kapitals in der Hand des einzelnen Arbeitsanwenders nothwendig, damit die Anzahl der gleichzeitig ausgebeuteten Arbeiter, daher die Masse des producirten Mehrwerths hinreiche, ihn selbst von der Handarbeit zu entbinden, aus einem Kleinmeister in einen Kapitalisten zu verwandeln und so das Kapitalverhältniss formell herzustellen. Sie erscheint jetzt als materielle Bedingung für die Verwandlung vieler zersplitterter und von einander unabhängiger individueller Arbeitsprozesse in einen kombinirten gesellschaftlichen Arbeitsprozess.
Ebenso erschien ursprünglich das Kommando des Kapitals über die Arbeit nur als formelle Folge davon, dass der Arbeiter, statt für sich, für den Kapitalisten und daher unter dem Kapitalisten arbeitet. Mit der Cooperation vieler Lohnarbeiter entwickelt sich das Kommando des Kapitals zum Erheischniss für die Ausführung des Arbeitsprozesses selbst, zu einer wirklichen Produktionsbedingung. Der Befehl des Kapitalisten auf dem Produktionsfeld wird jetzt so unentbehrlich wie der Befehl des Generals auf dem Schlachtfeld.
Alle unmittelbar gesellschaftliche oder gemeinschaftliche Arbeit auf grösserem Massstab braucht mehr oder minder eine Direktion, welche die Harmonie der individuellen Thätigkeiten vermittelt und die allgemeinen Funktionen vollzieht, die aus der Bewegung des produktiven Gesammtkörpers im Unterschied von der Bewegung seiner selbstständigen Organe entspringen. Ein einzelner Violinspieler dirigirt sich selbst, ein Orchester bedarf des Musikdirektors. Diese Funktion der Leitung, Ueberwachung und Vermittlung wird zur Funktion des Kapitals, sobald die ihm untergeordnete Arbeit cooperativ wird. Als spezifische Funktion des Kapitals erhält die Funktion der Leitung spezifische Charaktermale.
Zunächst ist das treibende Motiv und der bestimmende Zweck des kapitalistischen Produktionsprozesses möglichst grosse Selbstverwerthung des Kapitals(FN 20), d. h. möglichst grosse Produktion von Mehrwerth, also möglichst grosse Ausbeutung der Arbeitskraft durch den Kapi-
talisten. Mit der Masse der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter wächst ihr Widerstand und damit nothwendig der Druck des Kapitals zur Bewältigung dieses Widerstands. Die Leitung des Kapitalisten ist nicht nur eine aus der Natur des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses entspringende und ihm angehörige besondere Funktion, sie ist zugleich Funktion der Ausbeutung eines gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und daher bedingt durch den unvermeidlichen Antagonismus zwischen dem Ausbeuter und dem Rohmaterial seiner Ausbeutung. Ebenso wächst mit dem Umfang der Produktionsmittel, die dem Lohnarbeiter als fremdes Eigenthum gegenüberstehn, die Nothwendigkeit der Kontrole über deren sachgemässe Verwendung(FN 21). Die Cooperation der Lohnarbeiter ist ferner blosse Wirkung des Kapitals, das sie gleichzeitig anwendet. Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver Gesammtkörper liegen ausser ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan des Kapitalisten, ihre eigne Einheit praktisch als seine Autorität gegenüber, die Macht des fremden Willens, der ihr Thun seinem Zweck unterwirft. Wenn daher die kapitalistische Leitung dem Inhalt nach zwieschlächtig, wegen der Zwieschlächtigkeit des zu leitenden Produktionsprozesses selbst, da er einerseits gesellschaftlicher Arbeitsprozess zur Herstellung eines Produkts, andrerseits Verwerthungsprozess des Kapitals ist, so ist sie der Form nach despotisch. Mit der Entwicklung der Cooperation auf grösserem Massstab entwickelt dieser
Despotismus seine eigenthümlichen Formen. Wie der Kapitalist zunächst entbunden wird von der Handarbeit, sobald sein Kapital jene Minimalgrösse erreicht hat, womit die eigentlich kapitalistische Produktion erst beginnt, so tritt er jetzt die Funktion unmittelbarer und fortwährender Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitergruppen selbst wieder ab an eine besondre Sorte von Lohnarbeitern. Wie eine Armee militärischer, bedarf eine unter dem Kommando desselben Kapitals zusammenwirkende Arbeitermasse industrieller Oberofficiere (Dirigenten, managers) und Unterofficiere (Arbeitsaufseher, foremen, overlookers, contre-maîtres), die während des Arbeitsprozesses selbst im Namen des Kapitals kommandiren. Die Arbeit der Oberaufsicht befestigt sich zu ihrer ausschliesslichen Funktion. Bei Vergleichung der Produktionsweise unabhängiger Bauern oder selbstständiger Handwerker mit der auf Sklaverei beruhenden Plantagenwirthschaft, zählt der politische Oekonom diese Arbeit der Oberaufsicht zu den faux frais de production(FN 21a). Bei Betrachtung der kapitalistischen Produktionsweise identificirt er dagegen die Funktion der Leitung, soweit sie aus der Natur des gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses entspringt, mit derselben Funktion, soweit sie durch den kapitalistischen und daher antagonistischen Charakter dieses Prozesses bedingt wird(FN 22). Der Kapitalist ist nicht Kapitalist, weil er industrieller Leiter ist, sondern er wird industrieller Befehlshaber, weil er Kapitalist ist. Der Oberbefehl in der Industrie wird Attribut des Kapitals, wie zur Feudalzeit der Oberbefehl in Krieg und Gericht Attribut des Grundeigenthums war(FN 22a).
Eigenthümer seiner Arbeitskraft ist der Arbeiter, so lange er als Verkäufer derselben mit dem Kapitalisten marktet, und er kann nur verkaufen, was er besitzt, seine individuelle, vereinzelte Arbeitskraft. Diess Verhältniss wird in keiner Weise dadurch verändert, dass der Kapitalist 100 Arbeitskräfte statt einer kauft oder mit 100 von einander unabhängigen Arbeitern Kontrakte schliesst statt mit einem einzelnen. Er kann die 100 Arbeiter anwenden ohne sie cooperiren zu lassen. Der Kapitalist zahlt daher den Werth der 100 selbstständigen Arbeitskräfte, aber er zahlt nicht die kombinirte Arbeitskraft der Hundert. Als unabhängige Personen sind die Arbeiter Vereinzelte, die in ein Verhältniss zu demselben Kapital, aber nicht zu einander treten. Ihre Cooperation beginnt erst im Arbeitsprozess, aber im Arbeitsprozess haben sie bereits aufgehört sich selbst zu gehören. Mit dem Eintritt in denselben sind sie dem Kapital einverleibt. Als Cooperirende, als Glieder eines werkthätigen Organismus, sind sie selbst nur eine besondre Existenzweise des Kapitals. Die Produktivkraft, die der Arbeiter als gesellschaftlicher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit entwickelt sich unentgeldlich, sobald die Arbeiter unter bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese Bedingungen. Weil die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit dem Kapital nichts kostet, weil sie andrerseits nicht von dem Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit selbst dem Kapital gehört, erscheint sie als Produktivkraft, die das Kapital von Natur besitzt, als seine immanente Produktivkraft.
Kolossal zeigt sich die Wirkung der einfachen Cooperation in den Riesenwerken der alten Asiaten, Aegypter, Etrusker u. s. w. „Es geschah in vergangnen Zeiten, dass diese asiatischen Staaten nach Bestreitung ihrer Civilund Militairausgaben, sich im Besitz eines Ueberschusses von Lebensmitteln befanden, die sie für Werke der Pracht und des Nutzens verausgaben konnten. Ihr Kommando über die Hände und Arme fast der
ganzen nicht ackerbauenden Bevölkerung und die ausschliessliche Verfügung des Monarchen und der Priesterschaft über jenen Ueberschuss boten ihnen die Mittel zur Errichtung jener mächtigen Monumente, womit sie das Land erfüllten … In der Bewegung der kolossalen Statuen und der enormen Massen, deren Transport Staunen erregt, wurde fast nur menschliche Arbeit verschwenderisch angewandt. Die Zahl der Arbeiter und die Koncentration ihrer Mühen genügte. So sehn wir mächtige Korallenriffe aus den Tiefen des Oceaus zu Inseln anschwellen und festes Land bilden, obgleich jeder individuelle Ablagerer (depositary) winzig, schwach und verächtlich ist. Die nicht ackerbauenden Arbeiter einer asiatischen Monarchie haben ausser ihren individuellen körperlichen Bemühungen wenig zum Werk zu bringen, aber ihre Zahl ist ihre Kraft, und die Macht der Direktion über diese Massen gab jenen Riesenwerken den Ursprung. Es war die Koncentration der Revenüen, wovon die Arbeiter leben, in eine Hand oder wenige Hände, welche solche Unternehmungen möglich machte“(FN 23). Diese Macht asiatischer und ägyptischer Könige oder etruskischer Theokraten u. s. w. ist in der modernen Gesellschaft auf den Kapitalisten übergegangen, ob er nun als vereinzelter Kapitalist auftritt, oder, wie bei Aktiengesellschaften, als kombinirter Kapitalist.
Die Cooperation im Arbeitsprozess, wie wir sie in den Kulturanfängen der Menschheit, bei Jägervölkern(FN 23a) oder etwa in der Agrikultur indischer Gemeinwesen vorherrschend finden, beruht einerseits auf dem Gemeineigenthum an den Produktionsbedingungen, andrerseits darauf, dass das einzelne Individuum sich von der Nabelschnur des Stammes oder des Gemeinwesens noch ebensowenig losgerissen hat, wie das Bienenindividuum vom Bienenstock. Beides unterscheidet sie von der kapitalistischen Cooperation. Die sporadische Anwendung der Cooperation auf grossem Massstab in der antiken Welt, dem Mittelalter und den modernen Kolonien, beruht auf unmittelbaren Herrschaftsund Knechtschafts-Verhältnissen, zumeist auf der Sklaverei. Die kapita-
listische Form setzt dagegen von vornherein den freien Lohnarbeiter voraus, der seine Arbeitskraft dem Kapital verkauft. Historisch jedoch entwickelt sie sich im Gegensatz zur Bauernwirthschaft und zum unabhängigen Handwerksbetrieb, ob dieser zünftige Form besitze oder nicht(FN 24). Ihnen gegenüber erscheint die kapitalistische Cooperation nicht als eine besondre historische Form der Cooperation, sondern die Cooperation selbst als eine dem kapitalistischen Produktionsprozess eigenthümliche und ihn spezifisch unterscheidende historische Form.
Wie die durch die Cooperation entwickelte gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit als Produktivkraft des Kapitals erscheint, so die Cooperation selbst als eine spezifische Form des kapitalistischen Produktionsprozesses im Gegensatz zum Produktionsprozess vereinzelter unabhängiger Arbeiter oder auch Kleinmeister. Es ist die erste Aenderung, welche der wirkliche Arbeitsprozess durch seine Subsumtion unter das Kapital erfährt. Diese Aenderung geht naturwüchsig vor sich. Ihre Voraussetzung, gleichzeitige Beschäftigung einer grösseren Anzahl von Lohnarbeitern in demselben Arbeitsprozess, bildet den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Dieser fällt mit dem Dasein des Kapitals selbst zusammen. Wenn sich die kapitalistische Produktionsweise daher einerseits als historische Nothwendigkeit für die Verwandlung des Arbeitsprozesses in einen gesellschaftlichen Prozess darstellt, so andrerseits diese gesellschaftliche Form des Arbeitsprozesses als eine vom Kapital angewandte Methode, um ihn durch Steigerung seiner Produktivkraft profitlicher auszubeuten.
In ihrer bisher betrachteten einfachen Gestalt fällt die Cooperation zusammen mit der Produktion auf grösserer Stufenleiter, bildet aber keine feste, charakteristische Form einer besondern Entwicklungs epoche der kapitalistischen Produktionsweise. Höchstens er-
scheint sie annähernd so in den noch handwerksmässigen Anfängen der Manufaktur(FN 25) und in jener Art grosser Agrikultur, welche der Manufakturperiode entspricht, und sich wesentlich nur durch die Masse der gleichzeitig angewandten Arbeiter und den Umfang der koncentrirten Produktionsmittel von der Bauernwirthschaft unterscheidet. Die einfache Cooperation ist stets noch vorherrschende Form solcher Produktionszweige, worin das Kapital auf grosser Stufenleiter operirt, ohne dass Theilung der Arbeit oder Maschinerie eine bedeutende Rolle spielte.
Die Cooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Produktionsweise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondere Form neben ihren weiter entwickelten Formen erscheint.
3) Theilung der Arbeit und Manufaktur.↑Die auf Theilung der Arbeit beruhende Cooperation schafft sich ihre klassische Gestalt in der Manufaktur. Als charakteristische Form des kapitalistischen Produktionsprozesses herrscht sie vor während der eigentlichen Manufakturperiode, die, rauh angeschlagen, von Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Dritttheil des achtzehnten währt.
Die Manufaktur entspringt auf doppelte Weise.
Entweder werden Arbeiter von verschiedenartigen, selbstständigen Handwerken, durch deren Hände ein Produkt bis zu seiner letzten Reife laufen muss, in eine Werkstatt unter dem Kommando desselben Kapitalisten vereinigt. Z. B. eine Kutsche war das Gesammtprodukt der Arbeiten einer grossen Anzahl unabhängiger Handwerker, wie Stellmacher, Sattler, Schneider, Schlosser, Gürtler, Drechsler, Posamentirer, Glaser, Maler, Lackirer, Vergolder u. s. w. In der Kutschenmanufaktur wurden alle diese verschiednen Handwerker in einem Arbeitshaus vereinigt, um einander gleichzeitig in die Hand zu arbeiten. Man kann eine Kutsche zwar nicht vergolden, bevor sie gemacht ist. Werden aber viele Kutschen gleichzeitig gemacht, so kann ein Theil beständig vergoldet werden, während ein andrer Theil eine frühere Phase des Produktionsprozesses durchläuft. Soweit stehn wir
noch auf dem Boden der einfachen Cooperation, die ihr Material an Menschen und Dingen vorfindet. Indess tritt sehr bald eine wesentliche Veränderung ein. Der Schneider, Schlosser, Gürtler u. s. w., der nur im Kutschenmachen beschäftigt ist, verliert nach und nach mit der Gewohnheit auch die Fähigkeit, sein altes Handwerk in seiner ganzen Ausdehnung zu betreiben. Andrerseits erhält sein vereinseitigtes Thun jetzt die zweckmässigste Form für die verengte Wirkungssphäre. Ursprünglich erschien die Kutschenmanufaktur als eine Kombination selbstständiger Handwerke. Sie wird allmälig Theilung der Kutschenproduktion in ihre verschiednen Sonderoperationen, wovon jede einzelne zur ausschliesslichen Funktion eines Arbeiters krystallisirt und deren Gesammtheit vom Verein dieser Theilarbeiter verrichtet wird. Ebenso entstand die Tuchmanufaktur, und eine ganze Reihe andrer Manufakturen, aus der Kombination verschiedner Handwerke unter dem Kommando desselben Kapitals(FN 26).
Die Manufaktur entspringt aber auch auf entgegengesetztem Wege. Es werden viele Handwerker, die Dasselbe oder Gleichartiges thun, z. B. Papier oder Typen oder Nadeln machen, von demselben Kapital gleichzeitig in derselben Werkstatt beschäftigt. Es ist diess Cooperation in der einfachsten Form. Jeder dieser Handwerker (vielleicht mit einem oder zwei Gesellen) macht die ganze Waare und vollbringt also die verschiednen zu ihrer Herstellung erheischten Operationen der Reihe nach. Er arbeitet in seiner alten handwerksmässigen Weise fort. Indess veranlassen bald äussere Umstände die Kon-
centration der Arbeiter in demselben Raum und die Gleichzeitigkeit ihrer Arbeiten anders zu vernutzen. Es soll z. B. ein grösseres Quantum fertiger Waare in einer bestimmten Zeitfrist geliefert werden. Die Arbeit wird daher vertheilt. Statt die verschiedenen Operationen von demselben Handwerker in einer zeitlichen Reihefolge verrichten zu lassen, werden sie von einander losgelöst, isolirt, räumlich neben einander gestellt, jede derselben einem andern Handwerker zugewiesen und alle zusammen von den Cooperirenden gleichzeitig ausgeführt. Diese zufällige Vertheilung wiederholt sich, zeigt ihre eigenthümlichen Vortheile, und verknöchert nach und nach zur systematischen Theilung der Arbeit. Aus dem individuellen Produkt eines selbstständigen Handwerkers, der vielerlei thut, verwandelt sich die Waare in das gesellschaftliche Produkt eines Vereins von Handwerkern, von denen jeder fortwährend nur eine und dieselbe Theiloperation verrichtet. Dieselben Operationen, die in einander flossen als successive Verrichtungen des deutschen zünftigen Papiermachers, verselbstständigten sich in der holländischen Papiermanufaktur zu nebeneinander laufenden Theiloperationen vieler cooperirenden Arbeiter. Der zünftige Nadler von Nürnberg bildet das Grundelement der englischen Nadelmanufaktur. Während aber jener eine Nadler eine Reihe von vielleicht 20 Operationen nach einander durchlief, verrichteten hier bald 20 Nadler neben einander, jeder nur eine der 20 Operationen, die in Folge von Erfahrungen noch viel weiter gespaltet, isolirt, und zu ausschliesslichen Funktionen einzelner Arbeiter verselbstständigt wurden.
Die Ursprungsweise der Manufaktur, ihre Herausbildung aus dem Handwerk, ist also zwieschlächtig. Einerseits geht sie von der Kombination verschiedenartiger, selbstständiger Handwerke aus, die bis zu dem Punkt verunselbstständigt und vereinseitigt werden, wo sie nur noch einander ergänzende Theiloperationen im Produktionsprozess einer und derselben Waare bilden. Andrerseits geht sie von der Cooperation gleichartiger Handwerker aus, zersetzt dasselbe individuelle Handwerk in seine verschiednen besondern Operationen, und isolirt und verselbstständigt diese bis zu dem Punkt, wo jede derselben zur ausschliesslichen Funktion eines besondern Arbeiters wird. Einerseits führt daher die Manufaktur Theilung der Arbeit in einen Produktionsprozess ein oder entwickelt sie weiter, andrerseits kombinirt sie früher geschiedene Handwerke. Welches aber immer ihr besondrer Ausgangs-
punkt, ihre Schlussgestalt ist dieselbe — ein Produktionsmechanismus, dessen Organe Menschen sind.
Zum richtigen Verständniss der Theilung der Arbeit in der Manufaktur ist es wesentlich folgende Punkte festzuhalten: Zunächst fällt die Analyse des Produktionsprozesses in seine besondern Phasen hier ganz und gar zusammen mit der Zersetzung einer handwerksmässigen Thätigkeit in ihre verschiedenen Theiloperationen. Zusammengesetzt oder einfach, die Verrichtung bleibt handwerksmässig und daher abhängig von Kraft, Geschick, Schnelle, Sicherheit des Einzelarbeiters in Handhabung seines Instruments. Das Handwerk bleibt die Basis. Diese enge technologische Basis schliesst wirklich wissenschaftliche Analyse des Produktionsprozesses aus, da jeder Theilprozess, den das Produkt untergeht, als handwerksmässige Theilarbeit ausführbar sein muss. Eben weil das handwerksmässige Geschick so die Grundlage des Produktionsprozesses bleibt, wird jeder Arbeiter ausschliesslich einer Theilfunktion angeeignet und seine Arbeitskraft in das lebenslängliche Organ dieser Theilfunktion verwandelt. Endlich ist diese Theilung der Arbeit eine besondere Art der Cooperation, und manche ihrer Vortheile entspringen aus dem allgemeinen Wesen, nicht aus dieser besonderen Form der Cooperation.
Gehn wir nun näher auf das Einzelne ein, so ist zunächst klar, dass ein Arbeiter, der lebenslang eine und dieselbe einfache Operation verrichtet, seinen ganzen Körper in ihr automatisch einseitiges Organ verwandelt und daher weniger Zeit dazu verbraucht als der Handwerker, der eine ganze Reihe von Operationen abwechselnd ausführt. Der kombinirte Gesammtarbeiter, der den lebendigen Mechanismus der Manufaktur bildet, besteht aber aus lauter solchen einseitigen Theilarbeitern. Im Vergleich zum selbstständigen Handwerk wird daher mehr in weniger Zeit producirt oder die Produktivkraft der Arbeit gesteigert(FN 27). Auch vervollkommnet sich die Methode der Theilarbeit, nachdem sie zur ausschliesslichen Funktion einer Person verselbstständigt ist. Die stete Wieder-
holung desselben beschränkten Thuns und die Koncentration der Aufmerksamkeit auf diess Beschränkte lehren erfahrungsmässig den bezweckten Nutzeffekt mit geringstem Kraftaufwand erreichen. Da aber immer verschiedne Arbeitergenerationen gleichzeitig zusammenleben und in denselben Manufakturen zusammenwirken, befestigen, häufen und übertragen sich bald die so gewonnenen technischen Kunstgriffe(FN 28). Die Manufaktur producirt in der That die Virtuosität des Detailarbeiters, indem sie die naturwüchsige Sonderung der Gewerbe, die sie in der Gesellschaft vorfand, im Innern der Werkstatt reproducirt und systematisch zum Extrem treibt. Andrerseits entspricht ihre Verwandlung der Theilarbeit in den Lebensberuf eines Menschen dem Trieb früherer Gesellschaften, die Gewerbe erblich zu machen, sie in Kasten zu versteinern, oder, wo bestimmte historische Bedingungen dem Kastenwesen widersprechende Variabilität des Individuums erzeugen, die Arbeitssonderung wenigstens in Zünfte zu verknöchern. Die Entstehung dieser Kasten und Zünfte folgt demselben Naturgesetz, das die Sonderung von Pflanzen und Thieren in Arten und Unterarten regelt, nur dass auf einem gewissen Entwicklungsgrad die Erblichkeit der Kasten oder die Ausschliesslichkeit der Zünfte als gesellschaftliches Gesetz dekretirt wird(FN 29). „Die Musline von Dakka sind an Feinheit, die Kattune und andre Zeuge von Koromandel an Pracht und Dauerhaftigkeit der Farben, niemals übertroffen worden. Und dennoch werden sie producirt ohne Kapital, Maschinerie, Theilung der Arbeit, oder irgend eins der andern Mittel, die der Fabrikation in
Europa so viele Vortheile bieten. Der Weber ist ein vereinzeltes Individuum, der das Gewebe auf Bestellung eines Kunden verfertigt und mit einem Webstuhl von der einfachsten Konstruktion, manchmal nur bestehend aus hölzernen Stangen, die roh zusammengefügt sind. Er besitzt selbst keinen Apparat zum Aufziehn der Kette, der Webstuhl muss daher in seiner ganzen Länge ausgestreckt bleiben und wird so unförmlich und weit, dass er keinen Raum findet in der Hütte des Producenten, der seine Arbeit daher in freier Luft verrichten muss, wo sie durch jede Wetteränderung unterbrochen wird“(FN 30). Es ist nur das von Generation auf Generation gehäufte und von Vater auf Sohn vererbte Sondergeschick, das dem Hindu wie der Spinne diese Virtuosität verleiht. Und dennoch verrichtet ein solcher indischer Weber sehr komplicirte Arbeit, verglichen mit der Mehrzahl der Manufakturarbeiter.
Ein Handwerker, der die verschiedenen Theilprozesse in der Produktion eines Machwerks nach einander ausführt, muss bald den Platz, bald die Instrumente wechseln. Der Uebergang von einer Operation zur andern unterbricht den Fluss seiner Arbeit und bildet gewissermassen Poren in seinem Arbeitstag. Diese Poren verdichten, sobald er den ganzen Tag ein und dieselbe Operation kontinuirlich verrichtet oder sie verschwinden in dem Masse, wie der Wechsel seiner Operationen abnimmt. Die gesteigerte Produktivität ist hier entweder der zunehmenden Ausgabe von Arbeitskraft in einem gegebnen Zeitraum geschuldet, also wachsender Intensivität der Arbeit, oder einer Abnahme des unproduktiven Verzehrs von Arbeitskraft. Der Ueberschuss von Kraftaufwand nämlich, den jeder Uebergang aus der Ruhe in die Bewegung erheischt, kompensirt sich bei längerer Fortdauer der einmal erreichten Normalgeschwindigkeit. Andrerseits zerstört die Kontinuität gleichförmiger Arbeit die Spannund Schwungkraft der Lebensgeister, die im Wechsel der Thätigkeit selbst ihre Erholung und ihren Reiz finden.
Die Produktivität der Arbeit hängt nicht nur von der Virtuosität des Arbeiters ab, sondern auch von der Vollkommenheit seiner Werk-
zeuge. Werkzeuge derselben Art, wie Schneide-, Bohr-, Stoss-, Schlaginstrumente u. s. w. werden in verschiedenen Arbeitsprozessen gebraucht, und in demselben Arbeitsprozess dient dasselbe Instrument zu verschiednen Verrichtungen. Sobald jedoch die verschiednen Operationen eines Arbeitsprozesses von einander losgelöst sind und jede Theiloperation in der Hand des Theilarbeiters eine möglichst entsprechende und daher ausschliessliche Form erhält, werden Veränderungen der vorher zu verschiednen Zwecken dienenden Werkzeuge nothwendig. Die Richtung ihres Formwechsels ergiebt sich aus der Erfahrung der besondern Schwierigkeiten, welche die unveränderte Form in den Weg legt. Die Differenzirung der Arbeitsinstrumente, wodurch Instrumente derselben Art besondre feste Formen für jede besondre Nutzanwendung erhalten, und ihre Spezialisirung, wodurch jedes solches Sonderinstrument nur in der Hand spezifischer Theilarbeiter in seinem ganzen Umfang wirkt, charakterisiren die Manufaktur. Zu Birmingham allein producirt man etwa 500 Varietäten von Hämmern, wovon jeder nicht nur für einen besondern Produktionsprozess, sondern eine Anzahl Varietäten oft nur für verschiedne Operationen in demselben Prozess dient. Die Manufakturperiode vereinfacht, verbessert und vermannigfacht die Arbeitswerkzeuge durch deren Anpassung an die ausschliesslichen Sonderfunktionen der Theilarbeiter(FN 31). Sie schafft damit zugleich eine der materiellen Bedingungen der Maschinerie, die aus einer Kombination einfacher Instrumente besteht.
Der Detailarbeiter und sein Instrument bilden die einfachen Elemente der Manufaktur. Wenden wir uns jetzt zu ihrem Gesammtmechanismus.
Die Gliederung der Manufaktur besitzt zwei Grundformen, die
trotz gelegentlicher Verschlingung zwei wesentlich verschiedne Arten bilden und namentlich auch bei der späteren Verwandlung der Manufaktur in die maschinenartig betriebene, grosse Industrie eine ganz verschiedne Rolle spielen. Dieser Doppelcharakter entspringt aus der Natur des Machwerks selbst. Es wird entweder gebildet durch bloss mechanische Zusammensetzung selbstständiger Theilprodukte oder verdankt seine fertige Gestalt einer Reihenfolge zusammenhängender Prozesse und Manipulationen.
Eine Lokomotive z. B. besteht aus mehr als 5000 selbstständigen Theilen. Sie kann jedoch nicht als Beispiel der ersten Art der eigentlichen Manufaktur gelten, weil sie ein Gebilde der grossen Industrie ist. Wohl aber die Uhr, an welcher auch William Petty die manufakturmässige Theilung der Arbeit veranschaulicht. Aus dem individuellen Werk eines Nürnberger Handwerkers verwandelte sich die Uhr in das gesellschaftliche Produkt einer Unzahl von Theilarbeitern, wie Rohwerkmacher, Uhrfedermacher, Zifferblattmacher, Spiralfedermacher, Steinlochund Rubinhebelmacher, Zeigermacher, Gehäusemacher, Schraubenmacher, Vergolder, mit vielen Unterabtheilungen, wie z. B. Räderfabrikant (Messingund Stahlräder wieder geschieden), Triebmacher, Zeigerwerkmacher, acheveur de pignon (befestigt die Räder auf den Trieben, polirt die facettes u. s. w.), Zapfenmacher, planteur de finissage (setzt verschiedne Räder und Triebe in das Werk), finisseur de barillet (lässt Zähne einschneiden, macht die Löcher zur richtigen Weite, härtet Stellung und Gesperr), Hemmungmacher, bei der Cylinderhemmung wieder Cylindermacher, Steigradmacher, Unruhemacher, Raquettemacher (das Rückwerk, woran die Uhr regulirt wird), planteur d’échappement (eigentliche Hemmungmacher); dann der repasseur de barillet (macht das Federhaus und Stellung ganz fertig), Stahlpolirer, Räderpolirer, Schraubenpolirer, Zahlenmaler, Blattmacher (schmelzen das Email auf das Kupfer), fabricant de pendants (macht bloss die Bügel des Gehäuses), finisseur de charnière (steckt das Messingstift in die Mitte des Gehäuses u. s. w.), faiseur de secret (macht die Federn im Gehäuse, die den Deckel aufspringen machen), graveur, ciliceur, polisseur de boite u. s. w., u. s. w., endlich der repasseur, der die ganze Uhr zusammensetzt und sie gehend abliefert. Nur wenige Theile der Uhr laufen durch verschiedne Hände und alle diese membra disjecta sammeln sich erst in der Hand, die sie schliesslich in ein
mechanisches Ganze verbindet. Diess äusserliche Verhältniss des fertigen Produkts zu seinen verschiedenartigen Elementen lässt hier, wie bei ähnlichem Machwerk, die Kombination der Theilarbeiter in derselben Werkstatt zufällig. Die Theilarbeiten können selbst wieder als von einander unabhängige Handwerke betrieben werden, wie im Kanton Waadt und Neufchatel, während in Genf z. B. grosse Uhrenmanufakturen bestehn, d. h. unmittelbare Cooperation der Theilarbeiter unter dem Kommando eines Kapitals stattfindet. Auch im letztren Fall werden Zifferblatt, Feder und Gehäuse selten in der Manufaktur selbst verfertigt. Der kombinirte manufakturmässige Betrieb ist hier nur unter ausnahmsweisen Verhältnissen profitlich, weil die Konkurrenz unter den Arbeitern, die zu Hause arbeiten wollen, am grössten ist, die Zersplitterung der Produktion in eine Masse heterogener Prozesse wenig Verwendung gemeinschaftlicher Arbeitsmittel erlaubt, und der Kapitalist bei der zerstreuten Fabrikation die Auslage für Arbeitsgebäude u. s. w. erspart(FN 32). Indess ist auch das Verhältniss dieser Detailarbeiter, die zu Hause, aber für einen Kapitalisten (Fabrikant, établisseur) arbeiten, ganz und gar verschieden von dem des selbstständigen Handwerkers, der für seine eignen Kunden arbeitet(FN 33).
Die zweite Art der Manufaktur, ihre vollendete Form, producirt Machwerke, die zusammenhängende Entwicklungsphasen, eine Reihenfolge von Stufenprozessen durchlaufen, wie z. B. der Draht in der Nähnadelmanufaktur die Hände von 72 und selbst 92 spezifischen Theilarbeitern durchläuft.
Soweit solche Manufaktur ursprünglich zerstreute Handwerke kombinirt, vermindert sie die räumliche Trennung zwischen den besondern Produktionsphasen des Machwerks. Die Zeit seines Uebergangs aus einem Stadium in das andre wird verkürzt, ebenso die Arbeit, welche diese Uebergänge vermittelt(FN 34). Im Vergleich zum Handwerk wird so Produktivkraft gewonnen, und zwar entspringt dieser Gewinn aus dem allgemeinen cooperativen Charakter der Manufaktur. Andrerseits bedingt ihr eigenthümliches Prinzip der Theilung der Arbeit eine Isolirung der verschiednen Produktionsphasen, die als eben so viele handwerksmässige Theilarbeiten gegen einander verselbstständigt sind. Die Herstellung und Erhaltung des Zusammenhangs zwischen den isolirten Funktionen ernöthigt beständigen Transport des Machwerks aus einer Hand in die andre und aus einem Prozess in den andern. Vom Standpunkt der grossen Industrie tritt diess als eine charakteristische, kostspielige und dem Prinzip der Manufaktur immanente Beschränktheit hervor(FN 35).
Betrachtet man ein bestimmtes Quantum Rohmaterial, z. B. von Lumpen in der Papiermanufaktur oder von Draht in der Nadelmanufaktur, so durchläuft es in den Händen der verschiednen Theilarbeiter eine zeitliche Stufenfolge von Produktionsphasen bis zu seiner Schlussgestalt. Betrachtet man dagegen die Werkstatt als einen Gesammtmechanismus, so befindet sich das Rohmaterial gleichzeitig in allen seinen Produktionsphasen auf einmal. Mit einem Theil seiner vielen instrumentbewaffneten Hände zieht der aus den Detailarbeitern kombinirte Gesammtarbeiter
den Draht, während er gleichzeitig mit andern Händen und Werkzeugen ihn streckt, mit andern schneidet, spitzt u. s. w. Aus einem zeitlichen Nacheinander sind die verschiednen Stufenprozesse in ein räumliches Nebeneinander verwandelt. Daher Lieferung von mehr fertiger Waare in demselben Zeitraum(FN 36). Jene Gleichzeitigkeit entspringt zwar aus der allgemeinen cooperativen Form des Gesammtprozesses, aber die Manufaktur findet nicht nur die Bedingungen der Cooperation vor, sondern schafft sie theilweise erst durch die Zerlegung der handwerksmässigen Thätigkeit. Andrerseits erreicht sie diese gesellschaftliche Organisation des Arbeitsprozesses nur durch Festschmieden desselben Arbeiters an dasselbe Detail.
Da das Theilprodukt jedes Theilarbeiters zugleich nur eine besondre Entwicklungsstufe desselben Machwerks ist, liefert jeder Arbeiter oder jede Arbeitergruppe der andern ihr Rohmaterial. Das Arbeitsresultat des einen bildet den Ausgangspunkt für die Arbeit des andern. Der eine Arbeiter beschäftigt daher hier unmittelbar den andern. Die nothwendige Arbeitszeit zur Erreichung des bezweckten Nutzeffekts in jedem Theilprozess wird erfahrungsmässig festgestellt und der Gesammtmechanismus der Manufaktur beruht auf der Voraussetzung, dass in gegebner Arbeitszeit ein gegebnes Resultat erzielt wird. Nur unter dieser Voraussetzung können die verschiednen, einander ergänzenden Arbeitsprozesse ununterbrochen, gleichzeitig und räumlich neben einander fortgehn. Es ist klar, dass diese unmittelbare Abhängigkeit der Arbeiten und daher der Arbeiter von einander jeden Einzelnen zwingt, nur die nothwendige Zeit zu seiner Funktion zu verwenden, und so eine ganz andere Kontinuität, Gleichförmigkeit, Regelmässigkeit, Ordnung(FN 37) und namentlich auch Intensivität der Arbeit erzeugt wird als im unabhängigen Handwerk oder selbst der einfachen Cooperation. Dass
auf eine Waare nur die zu ihrer Herstellung gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit verwandt wird, erscheint bei der Waarenproduktion überhaupt als äusserer Zwang der Konkurrenz, weil, oberflächlich ausgedrückt, jeder einzelne Producent die Waare zu ihrem Marktpreis verkaufen muss. Lieferung von gegebnem Produktenquantum in gegebner Arbeitszeit wird dagegen hier in der Manufaktur technologisches Gesetz des Produktionsprozesses selbst(FN 38).
Verschiedne Operationen bedürfen jedoch ungleicher Zeitlängen und liefern daher in gleichen Zeiträumen ungleiche Quanta von Theilprodukten. Soll also derselbe Arbeiter Tag aus Tag ein stets nur dieselbe Operation verrichten, so müssen für verschiedne Operationen verschiedne Verhältnisszahlen von Arbeitern verwandt werden, z. B. 4 Giesser und 2 Abbrecher auf einen Frottirer in einer Typenmanufaktur, wo der Giesser stündlich 2000 Typen giesst, der Abbrecher 4000 abbricht und der Frottirer 8000 blank reibt. Hier kehrt das Prinzip der Cooperation in seiner einfachsten Form zurück, gleichzeitige Beschäftigung Vieler, die Gleichartiges thun, aber jetzt als Ausdruck eines organischen Verhältnisses. Die manufakturmässige Theilung der Arbeit vereinfacht und vermannigfacht also nicht nur die qualitativ unterschiednen Organe des gesellschaftlichen Gesammtarbeiters, sondern schafft auch ein mathematisch festes Verhältniss für den quantitativen Umfang dieser Organe, d. h. für die relative Arbeiteranzahl oder relative Grösse der Arbeitergruppen in jeder Sonderfunktion. Sie entwickelt mit der qualitativen Gliederung die quantitative Regel und Proportionalität des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses.
Ist die passendste Verhältnisszahl der verschiednen Gruppen von Theilarbeitern erfahrungsmässig festgesetzt für eine bestimmte Stufenleiter der Produktion, so kann man diese Stufenleiter nur ausdehnen, indem man ein Multipel jeder besondern Arbeitergruppe verwendet(FN 39). Es
kommt hinzu, dass dasselbe Individuum gewisse Arbeiten eben so gut auf grösserer als kleinerer Staffel ausführt, z. B. die Arbeit der Oberaufsicht, den Transport der Theilprodukte aus einer Produktionsphase in die andre u. s. w. Die Verselbstständigung dieser Funktionen, oder ihre Zuweisung an besondere Arbeiter, wird also erst vortheilhaft mit Vergrösserung der beschäftigten Arbeiterzahl, aber diese Vergrösserung muss sofort alle Gruppen proportionell ergreifen.
Die einzelne Gruppe, als eine Anzahl von Arbeitern, die dieselbe Theilfunktion verrichten, besteht aus homogenen Elementen und bildet ein einfaches Organ des Gesammtmechanismus. In verschiednen Manufakturen jedoch ist die Gruppe selbst ein gegliederter Arbeitskörper, während der Gesammtmechanismus durch die Wiederholung oder Vervielfältigung dieser produktiven Elementarorganismen gebildet wird. Nehmen wir z. B. die Manufaktur von Glasflaschen. Sie zerfällt in drei wesentlich unterschiedne Phasen. Erstens die vorbereitende Phase, wie Bereitung der Glaskomposition, Mengung von Sand, Kalk u. s. w. und Schmelzung dieser Komposition zu einer flüssigen Glasmasse(FN 40). In dieser ersten Phase sind verschiedne Theilarbeiter beschäftigt, ebenso in der Schlussphase, der Entfernung der Flaschen aus den Trockenöfen, ihrer Sortirung, Verpackung u. s. w. Zwischen beiden Phasen steht in der Mitte die eigentliche Glasmacherei oder Verarbeitung der flüssigen Glasmasse. An demselben Munde eines Glasofens arbeitet eine Gruppe, die in England das „hole“ (Loch) heisst, und aus einem bottle maker oder finisher, einem blower, einem gatherer, einem putter up oder whetter off und einem taker in zusammengesetzt ist. Diese fünf Theilarbeiter bilden eben so viele Sonderorgane eines einzigen Arbeitskörpers, der nur als Einheit, also nur durch unmittelbare Cooperation der Fünf wirken kann. Fehlt ein Glied des fünftheiligen Körpers, so ist er paralysirt. Derselbe Glasofen hat aber verschiedne Oeffnungen, in Eng-
land z. B. 4—6, deren jede einen irdenen Schmelztiegel mit flüssigem Glas birgt, und wovon jede eine eigne Arbeitergruppe von derselben fünfgliedrigen Form beschäftigt. Die Gliederung jeder einzelnen Gruppe beruht hier unmittelbar auf der Theilung der Arbeit, während das Band zwischen den verschiednen gleichartigen Gruppen einfache Cooperation ist, die eins der Produktionsmittel, hier den Glasofen, durch gemeinsamen Konsum ökonomischer verbraucht. Ein solcher Glasofen mit seinen 4—6 Gruppen bildet eine Glashütte, und eine Glasmanufaktur umfasst eine Mehrzahl solcher Hütten, zugleich mit den Vorrichtungen und Arbeitern für die einleitenden und abschliessenden Produktionsphasen.
Endlich kann die Manufaktur, wie sie theilweis aus der Kombination verschiedner Handwerke entspringt, sich zu einer Kombination verschiedner Manufakturen entwickeln. Die grösseren englischen Glashütten z. B. fabriciren ihre irdenen Schmelztiegel selbst, weil von deren Güte das Gelingen oder Misslingen des Produkts wesentlich abhängt. Die Manufaktur eines Produktionsmittels wird hier mit der Manufaktur des Produkts verbunden. Umgekehrt kann die Manufaktur des Produkts verbunden werden mit Manufakturen, worin es selbst wieder als Rohmaterial dient, oder mit deren Produkten es später zusammengesetzt wird. So findet man z. B. die Manufaktur von Flintglas kombinirt mit der Glasschleiferei und der Gelbgiesserei, letztere für die metallische Einfassung mannigfacher Glasartikel. Die verschiednen kombinirten Manufakturen bilden dann mehr oder minder räumlich getrennte Departemente einer Gesammtmanufaktur, zugleich von einander unabhängige Produktionsprozesse, jeder mit eigner Theilung der Arbeit. Trotz mancher technischer und ökonomischer Vortheile, welche die kombinirte Manufaktur bietet, gewinnt sie, auf eigner Grundlage, keine wirklich technologische Einheit. Diese entsteht erst bei ihrer Verwandlung in den maschinenmässigen Betrieb.
Die Manufakturperiode, welche Verminderung der zur Waarenproduktion nothwendigen Arbeitszeit bald als bewusstes Prinzip ausspricht(FN 41), entwickelt sporadisch auch den Gebrauch von Maschinen, namentlich für gewisse einfache erste Prozesse, die massenhaft
und mit grossem Kraftaufwand auszuführen sind. So wird z. B. bald in der Papiermanufaktur das Zermalmen der Lumpen durch Papiermühlen und in der Metallfabrik das Zerstossen der Erze durch sogenannte Pochmühlen verrichtet(FN 42). Die elementarische Form aller Maschinerie hatte das römische Kaiserreich überliefert in der Wassermühle(FN 43). Die Handwerksperiode vermachte die grossen Erfindungen des Kompasses, des Pulvers, der Buchdruckerei und der automatischen Uhr. Im Grossen und Ganzen jedoch spielt die Maschinerie jene Nebenrolle, die Adam Smith ihr neben der Theilung der Arbeit anweist(FN 44). Sehr wichtig wurde die sporadische Anwendung der Maschinerie im 17. Jahrhundert, weil sie den grossen Mathematikern jener Zeit praktische Anhaltspunkte und Reizmittel zur Schöpfung der modernen Mechanik darbot.
Die spezifische Maschinerie der Manufakturperiode bleibt der aus vielen Theilarbeitern kombinirte Gesammtarbeiter selbst. Die verschiednen Operationen, die der Producent einer Waare abwechselnd verrichtet und die sich im Ganzen seines Arbeitsprozesses verschlingen, nehmen ihn verschiedenartig in Anspruch. In der einen muss er mehr Kraft entwickeln, in der andern mehr Gewandtheit, in der dritten
mehr geistige Aufmerksamkeit u. s. w., und dasselbe Individuum besitzt diese Eigenschaften nicht in gleichem Grad. Nach der Trennung, Verselbstständigung und Isolirung der verschiednen Operationen werden die Arbeiter ihren vorwiegenden Eigenschaften gemäss getheilt, klassificirt und gruppirt. Bilden ihre Naturbesonderheiten die Grundlage, worauf sich die Theilung der Arbeit pfropft, so entwickelt die Manufaktur, einmal eingeführt, Arbeitskräfte, die von Natur nur zu einseitiger Sonderfunktion taugen. Der Gesammtarbeiter besitzt jetzt alle produktiven Eigenschaften in gleich hohem Grad der Virtuosität und verausgabt sie zugleich auf’s ökonomischste, indem er alle seine Organe, individualisirt in besondern Arbeitern oder Arbeitergruppen, ausschliesslich zu ihren spezifischen Funktionen verwendet(FN 45). Die Einseitigkeit und selbst die Unvollkommenheit des Theilarbeiters werden zu seiner Vollkommenheit als Glied des Gesammtarbeiters(FN 46). Die Gewohnheit einer einseitigen Funktion verwandelt ihn in ihr naturgemäss sicher wirkendes Organ, während der Zusammenhang des Gesammtmechanismus ihn zwingt, mit der Regelmässigkeit eines Maschinentheils zu wirken(FN 47). Da die verschiednen Funktionen des Gesammtarbeiters einfacher oder zusammengesetzter, niedriger oder höher, erheischen seine Organe, die individuellen Arbeitskräfte, sehr verschiedne Grade der Ausbildung und besitzen daher sehr verschiedne Werthe. Die Manufaktur entwickelt also eine Hierarchie der Arbeitskräfte, der eine Stufenleiter der Arbeitslöhne entspricht. Wird einerseits der individuelle Arbeiter einer einseitigen Funktion angeeignet und lebens-
lang annexirt, so werden eben so sehr die verschiednen Arbeitsverrichtungen jener Hierarchie der natürlichen und erworbnen Geschicklichkeiten angepasst(FN 48). Jeder Produktionsprozess bedingt indess gewisse einfache Hanthierungen, deren jeder Mensch, wie er geht und steht, fähig ist. Auch sie werden jetzt von ihrem flüssigen Zusammenhang mit den inhaltvolleren Momenten der Thätigkeit losgelöst und zu ausschliesslichen Funktionen verknöchert. Die Manufaktur erzeugt daher in jedem Handwerk, das sie ergreift, eine Klasse sogenannter ungeschickter Arbeiter, die der Handwerksbetrieb streng ausschloss. Wenn sie die durchaus vereinseitigte Spezialität auf Kosten des ganzen Arbeitsvermögens zur Virtuosität entwickelt, beginnt sie auch schon den Mangel aller Entwicklung zu einer Spezialität zu machen. Neben die hierarchische Abstufung tritt die einfache Scheidung der Arbeiter in geschickte und ungeschickte. Für letztere fallen die Erlernungskosten ganz weg, für erstere sinken sie, im Vergleich zum Handwerker, in Folge vereinfachter Funktion. In beiden Fällen sinkt der Werth der Arbeitskraft(FN 49). Ausnahme findet statt, soweit die Zersetzung des Arbeitsprozesses neue zusammenfassende Funktionen erzeugt, die im Handwerksbetrieb gar nicht oder nicht in demselben Umfang vorkamen. Die relative Entwerthung der Arbeitskraft, die aus dem Wegfall oder der Verminderung der Erlernungskosten entspringt, schliesst unmittelbar höhere Verwerthung des Kapitals ein, denn alles, was die zur Reproduktion der
Arbeitskraft nothwendige Zeit verkürzt, verlängert die Domaine der Mehrarbeit.
Wir betrachteten erst den Ursprung der Manufaktur aus der Cooperation, dann ihre einfachen Elemente, den Theilarbeiter und sein Werkzeug, endlich ihren Gesammtmechanismus. Wir berühren jetzt kurz das Verhältniss zwischen der manufakturmässigen Theilung der Arbeit und der gesellschaftlichen Theilung der Arbeit, welche die allgemeine Grundlage aller Waarenproduktion bildet.
Hält man nur die Arbeit selbst im Auge, so kann man die Trennung der gesellschaftlichen Produktion in ihre grossen Gattungen, wie Agrikultur, Industrie u. s. w., als Theilung der Arbeit im Allgemeinen, die Sonderung dieser Produktionsgattungen in Arten und Unterarten als Theilung der Arbeit im Besondern, und die Theilung der Arbeit innerhalb einer Werkstatt als Theilung der Arbeit im Einzelnen bezeichnen(FN 50).
Die Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft, und die entsprechende Beschränkung der Individuen auf besondre Berufssphären, entwickelt sich, wie die Theilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur, von entgegengesetzten Ausgangspunkten. Innerhalb einer Familie, weiter entwickelt eines Stammes, entspringt eine naturwüchsige Theilung der Arbeit aus den Geschlechtsund Altersverschiedenheiten, also auf rein physiologischer Grundlage, die mit der Ausdehnung des Gemeinwesens, der Zunahme der Bevölkerung, und namentlich dem Konflikt zwischen verschiednen Stämmen und der Unterjochung eines Stamms durch
den andern ihr Material ausweitet. Andrerseits, wie ich früher bemerkt, entspringt der Produktenaustausch an den Punkten, wo verschiedne Familien, Stämme, Gemeinwesen in Kontakt kommen, denn nicht Privatpersonen, sondern Familien, Stämme u. s. w. treten sich in den Anfängen der Kultur selbstständig gegenüber. Verschiedne Gemeinwesen finden verschiedne Produktionsmittel und verschiedne Lebensmittel in ihrer Naturumgebung vor. Ihre Produktionsweise, Lebensweise und Produkte sind daher verschieden. Es ist diese naturwüchsige Verschiedenheit, die bei dem Kontakt der Gemeinwesen den Austausch der wechselseitigen Produkte und daher die allmälige Verwandlung dieser Produkte in Waaren hervorruft. Der Austausch schafft nicht den Unterschied der Produktionssphären, sondern bezieht die unterschiednen auf einander und verwandelt sie so in mehr oder minder von einander abhängige Zweige einer gesellschaftlichen Gesammtproduktion. Hier entsteht die gesellschaftliche Theilung der Arbeit durch den Austausch ursprünglich verschiedner, aber gegen einander selbstständiger Produktionssphären. Dort, wo die physiologische Theilung der Arbeit den Ausgangspunkt bildet, lösen sich die besondern Organe eines unmittelbar zusammengehörigen Ganzen von einander ab, zersetzen sich, zu welchem Zersetzungsprozess der Waarenaustausch mit fremden Gemeinwesen den Hauptanstoss giebt, und verselbstständigen sich bis zu dem Punkt, wo der Zusammenhang der verschiednen Arbeiten durch den Austausch der Produkte als Waaren vermittelt wird. Es ist in dem einen Fall Verunselbstständigung der früher Selbstständigen, in dem andern Verselbstständigung der früher Unselbstständigen.
Die Grundlage aller entwickelten und durch Waarenaustausch vermittelten Theilung der Arbeit ist die Scheidung von Stadt und Land(FN 51). Man kann sagen, dass die ganze ökonomische Geschichte der Gesellschaft sich in der Bewegung dieses Gegensatzes resümirt, auf den wir jedoch hier nicht weiter eingehn.
Wie für die Theilung der Arbeit innerhalb der Manufaktur eine gewisse Anzahl gleichzeitig angewandter Arbeiter die materielle Voraussetzung bildet, so für die Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft die Grösse der Bevölkerung und ihre Dichtigkeit, die hier an die Stelle der Agglomeration in derselben Werkstatt tritt(FN 52). Indess ist diese Dichtigkeit etwas relatives. Ein relativ spärlich bevölkertes Land mit entwickelten Kommunikationsmitteln besitzt eine dichtere Bevölkerung als ein mehr bevölkertes Land mit unentwickelten Kommunikationsmitteln, und in dieser Art sind z. B. die nördlichen Staaten der amerikanischen Union dichter bevölkert als Indien(FN 53).
Da Waarenproduktion und Waarencirkulation die allgemeine Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise, erheischt manufakturmässige Theilung der Arbeit eine schon bis zu gewissem Entwicklungsgrad gereifte Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft. Umgekehrt entwickelt und vervielfältigt die manufakturmässige Theilung der Arbeit rückwirkend jene gesellschaftliche Theilung der Arbeit. Mit der Differenzirung der Arbeitsinstrumente differenziren sich mehr und mehr die Gewerbe, welche diese Instrumente produciren(FN 54). Ergreift der manufakturmässige Betrieb ein Gewerb, das bisher als Hauptoder Nebengewerb mit andern zusammenhing und von demselben Producenten ausgeführt wurde, so findet sofort Scheidung und gegenseitige Verselbstständigung statt. Ergreift er eine besondre Produktionsstufe einer Waare, so verwandeln sich ihre verschiednen Produktionsstufen in verschiedne unabhängige Ge-
werbe. Es ward bereits angedeutet, dass wo das Machwerk ein bloss mechanisch zusammengesetztes Ganze von Theilprodukten, die Theilarbeiten sich selbst wieder zu eignen Handwerken verselbstständigen können. Um die Theilung der Arbeit vollkommner innerhalb einer Manufaktur auszuführen, wird derselbe Produktionszweig, je nach der Verschiedenheit seiner Rohstoffe oder den verschiednen Formen, die derselbe Rohstoff erhalten kann, in verschiedne zum Theil ganz neue Manufakturen gespaltet. So wurden bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Frankreich allein über 100 verschiedenartige Seidenzeuge gewebt, und in Avignon z. B. war es Gesetz, dass „jeder Lehrling sich immer nur einer Fabrikationsart widmen und nicht die Verfertigung mehrerer Zeugarten zugleich lernen durfte.“ Die territoriale Theilung der Arbeit, welche besondre Produktionszweige an besondre Distrikte eines Landes bannt, erhält neuen Anstoss durch den manufakturmässigen Betrieb, der alle Besonderheiten ausbeutet(FN 55). Reiches Material zur Theilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft liefert der Manufakturperiode die Erweiterung des Weltmarkts und das Kolonialsystem, die zum Umkreis ihrer allgemeinen Existenzbedingungen gehören. Es ist hier nicht der Ort weiter nachzuweisen, wie sie neben der ökonomischen jede andre Sphäre der Gesellschaft inficirt und überall die Grundlage zu jener Ausbildung des Fachwesens, der Specialitäten, und zu einer Parcellirung des Menschen legt, die schon A. Ferguson, den Lehrer A. Smiths, in den Ausruf ausbrechen liess: „Wir sind ganze Nationen von Heloten, und es giebt keine Freien unter uns“(FN 56).
Trotz der zahlreichen Analogien jedoch und der Zusammenhänge zwischen der Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und der Theilung innerhalb einer Werkstatt, sind beide nicht nur graduell, sondern wesentlich unterschieden. Am schlagendsten scheint die Analogie unstreitig, wo ein inneres Band verschiedne Geschäftszweige ver-
schlingt. Der Viehzüchter z. B. producirt Häute, der Gerber verwandelt die Häute in Leder, der Schuster das Leder in Stiefel. Jeder producirt hier ein Stufenprodukt und die letzte fertige Gestalt ist das kombinirte Produkt ihrer Sonderarbeiten. Es kommen hinzu die mannigfachen Arbeitszweige, die dem Viehzüchter, Gerber, Schuster Produktionsmittel liefern. Man kann sich nun mit A. Smith einbilden, diese gesellschaftliche Theilung der Arbeit unterscheide sich von der manufakturmässigen nur subjektiv, nämlich für den Beobachter, der hier die mannigfachen Theilarbeiten auf einen Blick räumlich zusammensieht, während dort ihre Zerstreuung über grosse Flächen und die grosse Zahl der in jedem Sonderzweig Beschäftigten den Zusammenhang verdunklen(FN 57). Was aber stellt den Zusammenhang her zwischen den unabhängigen Arbeiten von Viehzüchter, Gerber, Schuster? Das Dasein ihrer respektiven Produkte als Waaren. Was charakterisirt dagegen die manufakturmässige Theilung der Arbeit? Dass der Theilarbeiter keine Waare producirt(FN 58). Erst das gemeinsame Produkt der Theilarbeiter verwandelt sich in Waare.
Die Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft ist vermittelt durch den Kauf und Verkauf der Produkte verschiedner Arbeitszweige, der Zusammenhang der Theilarbeiten in der Manufaktur durch den Verkauf verschiedner Arbeitskräfte an denselben Kapitalisten, der sie als kombinirte Arbeitskraft verwendet. Die manufakturmässige Theilung der Arbeit unterstellt Koncentration der Produktionsmittel in der Hand eines Kapitalisten, die gesellschaftliche Theilung der Arbeit Zersplitterung der Produktionsmittel unter viele von einander unabhängige Waarenproducenten. Statt dass in der Manufaktur das eherne Gesetz der Verhältnisszahl oder Proportionalität bestimmte Arbeitermassen unter bestimmte Funktionen subsumirt, treiben Zufall und Willkühr ihr buntes Spiel in der Vertheilung der Waarenproducenten und ihrer Produktionsmittel unter die verschiednen gesellschaftlichen Arbeitszweige. Zwar suchen sich die verschiednen Produktionssphären beständig ins Gleichgewicht zu setzen, indem einerseits jeder Waarenproducent einen Gebrauchswerth produciren, also ein besondres gesellschaftliches Bedürfniss befriedigen muss, der Umfang dieser Bedürfnisse aber quantitativ verschieden ist und ein innres Band die verschiedenen Bedürfnissmassen zu einem naturwüchsigen System verkettet; indem andrerseits das Werthgesetz der Waaren bestimmt, wie viel die Gesellschaft von ihrer ganzen disponiblen Arbeitszeit auf die Produktion jeder besondern Waarenart verausgaben kann. Aber diese beständige Tendenz der verschiednen Produktionssphären sich ins Gleichgewicht zu setzen, bethätigt sich nur als Reaktion gegen die beständige Aufhebung dieses Gleichgewichts. Bei der Theilung der Arbeit im Innern der Werkstatt beherrscht die Verhältnisszahl die jeder Sonderfunktion zugewiesne Arbeitermasse a priori als bewusste und planmässig befolgte Regel; bei der Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft wirkt sie nur a posteriori als innere, stumme, im Barometerwechsel der Marktpreise wahrnehmbare, die regellose Willkühr der Waarenproducenten überwältigende Naturnothwendigkeit. Die manufakturmässige Theilung der Arbeit unterstellt die unbedingte Autorität des Kapitalisten über Menschen, die blosse Glieder eines ihm gehörigen Gesammtmechanismus bilden; die gesellschaftliche Theilung der Arbeit stellt unabhängige Waarenproducenten einander gegenüber, die keine andere Autorität anerkennen als die der Konkurrenz, den Zwang, den der Druck ihrer wechselseitigen Interessen auf sie ausübt, wie auch im Thierreich das bellum omnium contra omnes die
Existenzbedingungen aller Arten mehr oder minder erhält. Dasselbe bürgerliche Bewusstsein, das die manufakturmässige Theilung der Arbeit, die lebenslängliche Annexation des Arbeiters an eine Detailverrichtung und die unbedingte Unterordnung der Theilarbeiter unter das Kapital, als eine Organisation der Arbeit feiert, welche ihre Produktivkraft steigere, denuncirt daher eben so laut jede bewusste gesellschaftliche Kontrole und Reglung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses als einen Eingriff in die unverletzlichen Eigenthumsrechte, Freiheit und sich selbst bestimmende „Genialität“ des individuellen Kapitalisten. Es ist sehr charakteristisch, dass die begeisterten Apologeten des Fabriksystems nichts ärgeres gegen jede allgemeine Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als dass sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würde.
Wenn die Anarchie der gesellschaftlichen und die Despotie der manufakturmässigen Arbeitstheilung einander in der Gesellschaft der kapitalistischen Produktionsweise bedingen, bieten dagegen frühere Gesellschaftsformen, worin die Besonderung der Gewerbe sich naturwüchsig entwickelt, dann krystallisirt und endlich gesetzlich befestigt, einerseits das Bild einer planund autoritätsmässigen Organisation der gesellschaftlichen Arbeit, während sie anderseits die Theilung der Arbeit innerhalb der Werkstatt ganz ausschliessen, oder nur auf einem Zwergmassstab, oder nur sporadisch und zufällig entwickeln(FN 59).
Jene uralterthümlichen, kleinen indischen Gemeinwesen z. B., die zum Theil noch fortexistiren, beruhn auf gemeinschaftlichem Besitz des Grund und Bodens, auf unmittelbarer Verbindung von Agrikultur und Handwerk, und auf einer festen Theilung der Arbeit, die bei Anlage neuer Gemeinwesen als gegebner Plan und Grundriss dient. Sie bilden sich selbst genügende Produktionsganze, deren Produktionsgebiet von 100 bis auf einige 1000 Acres wechselt. Die Hauptmasse der Produkte wird für den unmittelbaren Selbstbedarf der Gemeinde producirt, nicht als Waare, und die Produktion selbst ist daher unabhängig von der durch Waaren-
austausch vermittelten Theilung der Arbeit im Grossen und Ganzen der indischen Gesellschaft. Nur der Ueberschuss der Produkte verwandelt sich in Waare, zum Theil selbst wieder erst in der Hand des Staats, dem ein bestimmtes Quantum seit undenklichen Zeiten als Naturalrente zufliesst. In verschiedenen Theilen Indiens besitzt diess Gemeinwesen verschiedne herrschende Formen. In der einfachsten Form bebaut die Gemeinde das Land gemeinschaftlich und vertheilt seine Produkte unter ihre Glieder, während jede Familie Spinnen, Weben u. s. w. als häusliches Nebengewerb treibt. Neben dieser gleichartig beschäftigten Masse finden wir den „ Haupteinwohner“, Richter, Polizei und Steuereinnehmer in einer Person; den Buchhalter, der die Rechnung über den Ackerbau führt und alles darauf Bezügliche katastrirt und registrirt; einen dritten Beamten, der Verbrecher verfolgt und fremde Reisende beschützt und von einem Dorf zum andern geleitet; den Grenzmann, der die Grenzen der Gemeinde gegen die Nachbargemeinden bewacht; den Wasseraufseher, der das Wasser aus den gemeinschaftlichen Wasserbehältern zu Ackerbauzwecken vertheilt; den Braminen, der die Funktionen des religiösen Kultus verrichtet; den Schulmeister, der die Gemeindekinder im Sand schreiben und lesen lehrt; den Kalenderbraminen, der als Astrolog die Zeiten für Saat, Ernte und die guten oder bösen Stunden für alle besondern Ackerbauarbeiten angiebt; einen Schmidt und einen Zimmermann, welche alle Ackerbauwerkzeuge verfertigen und ausbessern; den Töpfer, der alle Gefässe für das Dorf macht; den Barbier, den Wäscher für die Reinigung der Kleider, den Silberschmidt, hier und da den Poeten, der in einigen Gemeinden den Silberschmidt, in andern den Schulmeister ersetzt. Diess Dutzend Personen wird auf Kosten der ganzen Gemeinde erhalten. Wächst die Bevölkerung, so wird eine neue Gemeinde nach dem Muster der alten auf unbebautem Boden angesiedelt. Den Gesammtmechanismus der Gemeinde betrachtet, findet sich hier planmässige Theilung der Arbeit, aber ihre manufakturmässige Theilung ist unmöglich, indem der Markt für Schmidt, Zimmermann u. s. w. unverändert bleibt und höchstens, je nach dem Grössenunterschied der Dörfer, statt eines Schmidts, Töpfers u. s. w. ihrer zwei oder drei vorkommen(FN 60). Das Gesetz, das die Theilung der Gemeinde-
arbeit regelt, wirkt hier mit der unverbrüchlichen Autorität eines Naturgesetzes, während jeder besondre Handwerker, wie Schmidt u. s. w., nach überlieferter Art, aber selbstständig, und ohne Anerkennung irgend einer Autorität in seiner Werkstatt, alle zu seinem Fach gehörigen Operationen verrichtet. Der einfache produktive Organismus dieser selbstgenügenden Gemeinwesen, die sich beständig in derselben Form reproduciren, und, wenn zufällig zerstört, an demselben Ort, mit demselben Namen, wieder aufbauen(FN 61), liefert den Schlüssel zum Geheimniss der Unveränderlichkeit asiatischer Gesellschaften, so auffallend kontrastirt durch die beständige Auflösung und Neubildung asiatischer Staaten und rastlosen Dynastenwechsel. Die Struktur der ökonomischen Grundelemente der Gesellschaft bleibt von den Stürmen der politischen Wolkenregion unberührt.
Die Zunftgesetze, wie schon früher bemerkt, verhinderten planmässig, durch äusserste Beschränkung des Maximums der Gesellenzahl, die ein einzelner Zunftmeister beschäftigen durfte, seine Verwandlung in einen Kapitalisten. Ebenso konnte er Gesellen nur beschäftigen in dem ausschliesslichen Handwerk, worin er selbst Meister war. Die Zunft wehrte eifersüchtig jeden Uebergriff des Kaufmannskapitals ab, der einzig freien Form des Kapitals, die ihr gegenüberstand. Der Kaufmann konnte alle Waaren kaufen, nur nicht die Arbeit als Waare. Er war nur geduldet als Verleger der Handwerksprodukte. Riefen äussere Umstände eine fortschreitende Theilung der Arbeit hervor, so zerspalteten sich bestehende Zünfte in Unterarten oder lagerten sich neue Zünfte neben die alten hin,
jedoch ohne Zusammenfassung verschiedner Handwerke in eine Werkstatt. Die Zunftorganisation, so sehr ihre Besonderung, Isolirung und Ausbildung der Gewerbe zu den materiellen Existenzbedingungen der Manufakturperiode gehören, schloss daher die manufakturmässige Theilung der Arbeit aus. Im Grossen und Ganzen blieben der Arbeiter und seine Produktionsmittel mit einander verbunden, wie die Schnecke mit dem Schneckenhaus, und so fehlte die erste Grundlage der Manufaktur, die Verselbstständigung der Produktionsmittel als Kapital gegenüber dem Arbeiter.
Während die Theilung der Arbeit im Ganzen einer Gesellschaft, ob vermittelt oder unvermittelt durch den Waarenaustausch, den verschiedenartigsten ökonomischen Gesellschaftsformationen angehört, ist die manufakturmässige Theilung der Arbeit eine ganz spezifische Schöpfung der kapitalistischen Produktionsweise.
Eine grössere Arbeiteranzahl unter dem Kommando desselben Kapitals bildet den naturwüchsigen Ausgangspunkt, wie der Cooperation überhaupt, so der Manufaktur. Umgekehrt entwickelt die manufakturmässige Theilung der Arbeit das Wachsthum der angewandten Arbeiterzahl zur technologischen Nothwendigkeit. Das Arbeiterminimum, das ein einzelner Kapitalist anwenden muss, ist ihm jetzt durch die vorhandene Theilung der Arbeit vorgeschrieben. Andrerseits sind die Vortheile weiterer Theilung bedingt durch weitere Vermehrung der Arbeiteranzahl, die nur noch in Multiplen ausführbar. Mit dem variablen muss aber auch der constante Bestandtheil des Kapitals wachsen, neben dem Umfang der gemeinsamen Produktionsbedingungen, wie Baulichkeiten, Oefen u. s. w., namentlich auch und viel rascher als die Arbeiteranzahl, das Rohmaterial. Seine Masse, verzehrt in gegebner Zeit durch gegebnes Arbeitsquantum, nimmt in demselben Verhältniss zu wie die Produktivkraft der Arbeit in Folge ihrer Theilung. Wachsender Minimalumfang von Kapital in der Hand der einzelnen Kapitalisten, oder wachsende Verwandlung der gesellschaftlichen Lebensmittel und Produktionsmittel in Kapital ist also ein aus dem technologischen Charakter der Manufaktur entspringendes Gesetz(FN 62).
Wie in der einfachen Cooperation ist in der Manufaktur der funktionirende Arbeitskörper eine Existenzform des Kapitals. Der aus vielen individuellen Theilarbeitern zusammengesetzte gesellschaftliche Produktionsmechanismus gehört dem Kapitalisten. Die aus der Kombination der Arbeiten entspringende Produktivkraft erscheint daher als Produktivkraft des Kapitals. Die eigentliche Manufaktur unterwirft nicht nur den früher selbstständigen Arbeiter dem Kommando und der Disciplin des Kapitals, sondern schafft überdem eine hierarchische Gliederung unter den Arbeitern selbst. Während die einfache Cooperation die Arbeitsweise der Einzelnen im Grossen und Ganzen unverändert lässt, revolutionirt die Manufaktur sie von Grund aus und ergreift die individuelle Arbeitskraft an ihrer Wurzel. Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick treibhausmässig fördert durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und Anlagen, wie man in den La Plata Staaten ein ganzes Thier abschlachtet, um sein Fell oder seinen Talg zu erbeuten. Die besondren Theilarbeiten werden nicht nur unter verschiedne Individuen vertheilt, sondern das Individuum selbst wird getheilt, in das automatische Triebwerk einer Theilarbeit verwandelt(FN 63) und die abgeschmackte Fabel des Menenius Agrippa verwirklicht, die einen Menschen als blosses Fragment seines eignen Körpers darstellt(FN 64). Wenn der Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, weil ihm die materiellen Produktionsbedin-
gungen einer Waare fehlen, existirt seine individuelle Arbeitskraft jetzt überhaupt nur noch, wann und sofern sie an das Kapital verkauft wird. Sie funktionirt nur noch in einem Zusammenhang, der erst nach ihrem Verkauf, in der Werkstatt des Kapitalisten, existirt. Seiner natürlichen Beschaffenheit nach verunfähigt, etwas Selbstständiges zu machen, entwickelt der Manufakturarbeiter produktive Thätigkeit nur noch als Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten(FN 65). Wie dem auserwählten Volk auf der Stirn geschrieben stand, dass es das Eigenthum Jehovas, so drückt die Theilung der Arbeit dem Manufakturarbeiter einen Stempel auf, der ihn zum Eigenthum des Kapitals brandmarkt.
Die Kenntnisse, die Einsicht und der Wille, die der selbstständige Bauer oder Handwerker, wenn auch auf kleinem Massstab entwickelt, wie der Wilde alle Kunst des Kriegs als persönliche List ausübt, sind jetzt nur noch für das Ganze der Werkstatt erheischt. Die geistigen Potenzen der Produktion erweitern ihren Massstab auf der einen Seite, weil sie auf vielen Seiten verschwinden. Was die Theilarbeiter verlieren, koncentrirt sich ihnen gegenüber im Kapital(FN 66). Es ist ein Produkt der manufakturmässigen Theilung der Arbeit ihnen die geistigen Potenzen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigenthum und sie beherrschende Macht gegenüberzustellen. Dieser Scheidungsprozess beginnt in der einfachen Cooperation, wo der Kapitalist den einzelnen Arbeitern gegenüber die Einheit und den Willen des gesellschaftlichen Arbeitskörpers vertritt. Er entwickelt sich in der Manufaktur, die den Arbeiter zum Theilarbeiter verstümmelt. Er vollendet sich in der grossen Industrie, welche die Wissenschaft als selbstständige Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals presst(FN 67).
In der Manufaktur ist die Bereicherung des Gesammtarbeiters, und daher des Kapitals, an gesellschaftlicher Produktivkraft bedingt durch die Verarmung des Arbeiters an individuellen Produktivkräften. „Die Unwissenheit ist die Mutter der Industrie wie des Aberglaubens. Nachdenken und Einbildungskraft sind dem Irrthum unterworfen; aber die Gewohnheit den Fuss oder die Hand zu bewegen hängt weder von dem einen, noch von der andern ab. So könnte man sagen, dass mit Bezug auf Manufakturen ihre Vollkommenheit darin besteht, sich des Geistes entschlagen zu können, in der Art, dass die Werkstatt als eine Maschine betrachtet werden kann, deren Theile Menschen sind“(FN 68). In der That wandten einige Manufakturen in der Mitte des 18. Jahrhunderts für gewisse einfache Operationen, welche aber Fabrikgeheimnisse bildeten, mit Vorliebe halbe Idioten an(FN 69).
„Der Geist der grossen Mehrzahl der Menschen“, sagt A. Smith, „entwickelt sich nothwendig aus und an ihren Alltagsverrichtungen. Ein Mensch, der sein ganzes Leben in der Verrichtung weniger einfacher Operationen verausgabt … hat keine Gelegenheit seinen Verstand zu üben … Er wird im Allgemeinen so stupid und unwissend, wie es für eine menschliche Kreatur möglich ist.“ Nachdem Smith den Stumpfsinn des Theilarbeiters geschildert, fährt er fort: „Die Einförmigkeit seines stationären Lebens verdirbt natürlich auch den Muth seines Geistes … Sie zerstört selbst die Energie seines Körpers und verunfähigt ihn, seine Kraft schwunghaft und ausdauernd anzuwenden ausser in der Detailbeschäftigung, wozu er herangezogen ist. Sein Geschick in seinem besondern Gewerke scheint so erworben auf Kosten seiner intellektuellen, socialen und kriegerischen Tugenden. Aber in jeder industriellen und civilisirten Gesellschaft ist diess der Zustand, worin der arbeitende Arme (the labouring poor), d. h. die grosse Masse des Volks nothwendig verfallen muss“(FN 70). Um
die aus der Theilung der Arbeit entspringende völlige Verkümmerung der Volksmasse zu verhindern, empfiehlt A. Smith Volksunterricht von Staatswegen, wenn auch in vorsichtig homöopathischen Dosen. Konsequent polemisirt dagegen sein französischer Uebersetzer und Kommentator, G. Garnier, der sich unter dem ersten französischen Kaiserthum naturgemäss zum Senator entpuppte. Volksunterricht verstosse wider die ersten Gesetze der Theilung der Arbeit und mit demselben „ proscribire man unser ganzes Gesellschaftssystem“. „Wie alle andern Theilungen der Arbeit“, sagt er, „wird die zwischen Handarbeit und Verstandesarbeit(FN 71) ausgesprochner und entschiedner im Masse wie die Gesellschaft (er wendet richtig diesen Ausdruck an für das Kapital, das Grundeigenthum und ihren Staat) reicher wird. Gleich jeder andern ist diese Theilung der Arbeit eine Wirkung vergangner und eine Ursache künftiger Fortschritte … Darf die Regierung denn dieser Theilung der Arbeit entgegenwirken und sie in ihrem naturgemässen Gang aufhalten? Darf sie einen Theil der Staatseinnahme zum Versuch verwenden, zwei Klassen von Arbeit, die ihre Theilung und Trennung erstreben, zu verwirren und zu vermischen“?(FN 72)
Eine gewisse geistige und körperliche Verkrüppelung ist unzertrennlich selbst von der Theilung der Arbeit im Ganzen und Grossen der Gesellschaft. Da aber die Manufakturperiode diese gesellschaftliche Zerspaltung der Arbeitszweige viel weiter führt, andrerseits erst mit der ihr eigenthümlichen Theilung das Individuum an seiner Lebenswurzel ergreift,
liefert sie auch zuerst das Material und den Anstoss zur industriellen Pathologie(FN 73).
„Einen Menschen unterabtheilen, heisst ihn hinrichten, wenn er das Todesurtheil verdient, ihn meuchelmorden, wenn er es nicht verdient. Die Unterabtheilung der Arbeit ist der Meuchelmord eines Volks“(FN 74).
Die auf Theilung der Arbeit beruhende Cooperation oder die Manufaktur ist in ihren Anfängen ein naturwüchsiges Gebild der kapitalistischen Produktion. Sobald sie einige Konsistenz und Breite des Daseins gewonnen, wird sie zur bewussten, planmässigen und systematischen Form der kapitalistischen Produktionsweise. Die Geschichte der eigentlichen Manufaktur zeigt, wie die ihr eigenthümliche Theilung der Arbeit zunächst erfahrungsmässig, gleichsam hinter dem Rücken der handelnden Personen, die sachgemässen Formen gewinnt, dann aber, gleich dem zünftigen Handwerke, die einmal gefundene Form traditionell festzuhalten strebt und in einzelnen Fällen Jahrhundertlang festhält. Aendert sich diese Form, so, ausser in Nebendingen, immer nur in Folge einer Revolution der Arbeitsinstrumente. Die moderne Manufaktur — ich spreche hier nicht von der auf Maschinerie beruhenden grossen Industrie — findet entweder, wie
z. B. die Kleidermanufaktur, in den grossen Städten, wo sie entsteht, die disjecta membra poetae bereits fertig vor und hat sie nur aus ihrer Zerstreuung zu sammeln, oder das Prinzip der Theilung liegt auf flacher Hand, indem einfach die verschiednen Verrichtungen der handwerksmässigen Produktion (z. B. beim Buchbinden) besondern Arbeitern ausschliesslich angeeignet werden. Es kostet noch keine Woche Erfahrung in solchen Fällen die Verhältnisszahl zwischen den für jede Funktion nöthigen Händen zu finden(FN 75).
Die manufakturmässige Theilung der Arbeit schafft durch Analyse der handwerksmässigen Thätigkeit, Spezificirung der Arbeitsinstrumente, Bildung der Theilarbeiter, ihre Gruppirung und Kombination in einem Gesammtmechanismus, die qualitative Gliederung und die quantitative Proportionalität gesellschaftlicher Produktionsprozesse, also eine bestimmte Organisation gesellschaftlicher Arbeit und entwickelt damit zugleich neue, gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit. Als spezifisch kapitalistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses — und auf den vorgefundnen Grundlagen konnte sie sich nicht anders als in der kapitalistischen Form entwickeln — ist sie nur eine besondre Methode relativen Mehrwerth zu erzeugen oder die Selbstverwerthung des Kapitals — was man gesellschaftlichen Reichthum, „ Wealth of Nations“ u. s. w. nennt — auf Kosten der Arbeiter zu erhöhn. Sie entwickelt die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit nicht nur für den Kapitalisten, statt für den Arbeiter, sondern durch die Verkrüpplung des individuellen Arbeiters. Sie producirt neue Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. Wenn sie daher einerseits als historischer Fortschritt und nothwendiges Entwicklungsmoment im ökonomischen Bildungsprozess der Gesellschaft erscheint, so andrerseits als ein Mittel civilisirter und raffinirter Exploitation.
Die politische Oekonomie, die als eigne Wissenschaft erst in der Manufakturperiode aufkommt, betrachtet die gesellschaftliche Theilung der Arbeit überhaupt nur vom Standpunkt der manufakturmässigen Theilung der Arbeit(FN 76), als Mittel mit demselben Quantum Arbeit mehr Waare zu produciren, daher die Waaren zu verwohlfeilern und die Accumulation des Kapitals zu beschleunigen. Im strengsten Gegensatz zu dieser Accentuirung der Quantität und des Tauschwerths halten sich die Schriftsteller des klassischen Alterthums ausschliesslich an Qualität und Gebrauchswerth(FN 77). In Folge der Scheidung der gesellschaftlichen Produktionszweige werden die Waaren besser gemacht, die verschiedenen Triebe und Talente der Menschen wählen sich entsprechende Wirkungssphären(FN 78) und ohne Beschränkung ist nirgendwo Bedeutendes zu leisten(FN 79). Also Produkt und Producent werden verbessert durch die
Theilung der Arbeit. Wird gelegentlich auch das Wachsthum der Produktenmasse erwähnt, so nur mit Bezug auf die grössere Fülle des Gebrauchswerths. Es wird mit keiner Silbe des Tauschwerths, der Verwohlfeilerung der Waaren gedacht. Dieser Standpunkt des Gebrauchswerths herrscht sowohl bei Plato(FN 80), der die Theilung der Arbeit als Grundlage der gesellschaftlichen Scheidung der Stände behandelt, als bei Xenophon(FN 81), der mit seinem charakteristisch bürgerlichen In-
stinkt schon der Theilung der Arbeit innerhalb einer Werkstatt näher rückt. Plato’s Republik, soweit in ihr die Theilung der Arbeit als das gestaltende Prinzip des Staats entwickelt wird, ist nur atheniensische Idealisirung des ägyptischen Kastenwesens, wie Aegypten als industrielles Musterland auch andern seiner Zeitgenossen gilt, z. B. dem Isokrates(FN 82), und diese Bedeutung selbst noch für die Griechen der römischen Kaiserzeit behielt(FN 83).
Während der eigentlichen Manufakturperiode, d. h. der Periode, worin die Manufaktur die herrschende Form der kapitalistischen Produktionsweise, stösst die volle Ausführung ihrer eigenen Tendenzen auf vielseitige Hindernisse. Obgleich sie, wie wir sahen, neben der hierarchischen Gliederung der Arbeiter eine einfache Scheidung zwischen geschickten und ungeschickten Arbeitern schafft, bleibt die Zahl der letztern durch den überwiegenden Einfluss der erstern sehr beschränkt. Obgleich sie die Sonderoperationen dem verschiednen Grad von Reife, Kraft und Entwick-
lung ihrer lehendigen Arbeitsorgane anpasst und daher zu produktiver Ausbeutung von Weibern und Kindern drängt, scheitert diese Tendenz im Grossen und Ganzen an den Gewohnheiten und dem Widerstand der männlichen Arbeiter. Obgleich die Zersetzung der handwerksmässigen Thätigkeit die Bildungskosten und daher den Werth der Arbeiter senkt, bleibt für schwierigere Detailarbeit eine längere Erlernungszeit nöthig und wird auch da, wo sie vom Ueberfluss, eifersüchtig von den Arbeitern aufrecht erhalten. Wir finden z. B. in England die laws of apprenticeship mit ihrer siebenjährigen Lernzeit bis zum Ende der Manufakturperiode in Vollkraft und erst von der grossen Industrie über Haufen geworfen. Da das Handwerksgeschick die Grundlage der Manufaktur bleibt, und der in ihr funktionirende Gesammtmechanismus kein von den Arbeitern selbst unabhängiges objektives Skelett besitzt, ringt das Kapital beständig mit der Insubordination der Arbeiter. „Die Schwäche der menschlichen Natur,“ ruft Freund Ure aus, „ist so gross, dass der Arbeiter; je geschickter, desto eigenwilliger und schwieriger zu behandeln wird, und folglich dem Gesammtmechanismus durch seine rappelköpfigen Capricen schweren Schaden zufügt“(FN 84). Durch die ganze Manufakturperiode läuft daher die Klage über den Disciplinmangel der Arbeiter(FN 85). Und hätten wir nicht die Zeugnisse gleichzeitiger Schriftsteller, die einfachen Thatsachen, dass es vom 16. Jahrhundert bis zur Epoche der grossen Industrie dem Kapital misslingt, sich der ganzen disponiblen Arbeitszeit der Manufakturarbeiter zu bemächtigen, dass die Manufakturen kurzlebig sind und mit der Einoder Auswanderung der Arbeiter ihren Sitz in dem einen Land verlassen und in dem andern aufschlagen, würden Bibliotheken sprechen. „ Ordnung muss auf die eine oder die andre Weise gestiftet werden“, ruft 1770 der wiederholt citirte Verfasser des „ Essay on Trade and Commerce“. Ordnung, hallt es 66 Jahre später zurück aus dem Mund des Dr. Andrew Ure, „Ordnung“ fehlte in der auf „dem scholastischen Dogma der Theilung der Arbeit“ beruhenden Manufaktur, und „ Arkwright schuf die Ordnung.“
Zugleich konnte die Manufaktur die gesellschaftliche Produktion weder in ihrem ganzen Umfang ergreifen, noch in ihrer Tiefe umwälzen. Sie
gipfelte als ökonomisches Kunstwerk auf der breiten Grundlage des städtischen Handwerks und der ländlich häuslichen Nebenindustrie. Ihre eigne enge technologische Basis trat auf einem gewissen Entwicklungsgrad mit den von ihr selbst geschaffenen Produktionsbedürfnissen in Widerspruch.
Eins ihrer vollendetsten Gebilde war die Werkstatt zur Produktion der Arbeitsinstrumente selbst, und namentlich auch der bereits angewandten komplicirteren mechanischen Apparate. „Ein solches Atelier“, sagt Ure, „bot dem Auge die Theilung der Arbeit in ihren mannigfachen Abstufungen. Bohrer, Meisel, Drechselbank hatten jede ihre eignen Arbeiter, hierarchisch gegliedert nach dem Grad ihrer Geschicklichkeit.“ Diess Produkt der manufakturmässigen Theilung der Arbeit producirte seinerseits — Maschinen. Sie heben die handwerksmässige Thätigkeit als das regelnde Princip der gesellschaftlichen Produktion auf. So wird einerseits der technologische Grund der lebenslangen Annexation des Arbeiters an eine Theilfunktion weggeräumt. Andrerseits fallen die Schranken, welche dasselbe Princip der Herrschaft des Kapitals noch auferlegte.
4) Maschinerie und grosse Industrie.↑John Stuart Mill sagt in seinen „ Principien der politischen Oekonomie“: „Es ist fraglich, ob alle bisher gemachten mechanischen Erfindungen die Tagesmühe irgend eines menschlichen Wesens erleichtert haben“(FN 86). Solches ist jedoch auch keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten Maschinerie. Gleich jeder andern Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit soll sie Waaren verwohlfeilern und den Theil des Arbeitstags, den der Arbeiter für sich selbst braucht, verkürzen, um den andern Theil seines Arbeitstags, den er dem Kapitalisten umsonst giebt, zu verlängern. Sie ist Mittel zur Produktion von Mehrwerth.
Die Umwälzung der Produktionsweise geht in der Manufaktur von der Arbeitskraft aus, in der grossen Industrie vom Arbeitsmittel. Es ist also zunächst zu untersuchen, wodurch sich das Arbeitsmittel aus einem Werkzeug in eine Maschine verwandelt, oder wodurch sich die Maschine vom Handwerksinstrument unterscheidet. Es handelt sich hier nur um
grosse, allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt strenge Grenzlinien scheiden ebensowenig die Epochen der Gesellschaftswie die der Erdgeschichte.
Mathematiker und Mechaniker — und man findet diess hier und da von englischen Oekonomen wiederholt — erklären das Werkzeug für eine einfache Maschine und die Maschine für ein zusammengesetztes Werkzeug. Nach ihnen findet hier also kein wesentlicher Unterschied statt. In diesem Sinn heissen sogar die einfachen mechanischen Potenzen, wie Hebel, schiefe Ebne, Schraube, Keil u. s. w. Maschinen(FN 87). Diess ist richtig vom mathematischen Standpunkt, denn jede Maschine besteht aus jenen einfachen Potenzen, wie immer verkleidet und kombinirt. Vom ökonomischen Standpunkt taugt die Erklärung nichts, denn ihr fehlt das Entscheidende, das historische Element. Andrerseits sucht man den Unterschied zwischen Werkzeug und Maschine darin, dass beim Werkzeug der Mensch die Bewegungskraft, bei der Maschine eine von der menschlichen verschiedne Naturkraft, wie Thier, Wasser, Wind u. s. w.(FN 88) Danach wäre ein mit Ochsen bespannter Pflug, der den verschiedensten Produktionsepochen angehört, eine Maschine, Claussen’s Circular Loom, der, von der Hand eines einzigen Arbeiters bewegt, 96,000 Maschen in einer Minute verfertigt, ein blosses Werkzeug. Ja, derselbe loom wäre Werkzeug, wenn mit der Hand, und Maschine, wenn mit Dampf bewegt. Da die Anwendung von Thierkraft eine der ältesten Erfindungen der Menschheit, ginge in der That die Maschinenproduktion der Handwerksproduktion voraus. Als John Wyalt 1735 seine Spinnmaschine und mit ihr die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts ankündigte, erwähnte er mit keinem Wort, dass statt eines Menschen ein Esel die Maschine treibe, und
dennoch fiel diese Rolle dem Esel zu. Eine Maschine, „ um ohne Finger zu spinnen,“ lautete sein Programm(FN 89).
Alle entwickelte Maschinerie besteht aus drei wesentlich verschiedenen Theilen, der Bewegungsmaschine, dem Transmissionsmechanismus, endlich der Werkzeugmaschine oder Arbeitsmaschine. Die Bewegungsmaschine wirkt als Triebkraft des ganzen Mechanismus. Sie erzeugt ihre eigne Bewegungskraft, wie die Dampfmaschine, kalorische Maschine, elektro-magnetische Maschine u. s. w., oder sie empfängt den Anstoss von einer Naturkraft ausser ihr, wie das Wasserrad vom Wassergefäll, der Windflügel vom Wind u. s. w. Der Transmissionsmechanismus, zusammengesetzt aus Schwungrädern, Treibwellen, Zahnrädern, Kreiselrädern, Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr und Vorgelege der verschiedensten Art, regelt die Bewegung, verwandelt, wo es nöthig, ihre Form, z. B. aus einer perpendikulären in eine kreisförmige, vertheilt und überträgt sie auf die Werkzeugmaschinerie. Beide
Theile des Mechanismus sind nur vorhanden, um der Werkzeugmaschine die Bewegung mitzutheilen, wodurch sie den Arbeitsgegenstand anpackt und zweckgemäss verändert. Dieser Theil der Maschinerie, die Werkzeugmaschine ist es, wovon die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert ausgeht. Sie bildet noch jeden Tag von neuem den Ausgangspunkt, so oft Handwerksbetrieb oder Manufakturbetrieb in Maschinenbetrieb übergeht.
Sehn wir uns nun die Werkzeugmaschine oder eigentliche Arbeitsmaschine näher an, so erscheinen im Grossen und Ganzen, wenn auch oft in sehr modificirter Form, die Apparate und Werkzeuge wieder, womit der Handwerker oder Manufakturarbeiter arbeitet, aber statt als Werkzeuge des Menschen jetzt als Werkzeuge eines Mechanismus oder als mechanische Werkzeuge. Entweder ist die ganze Maschine nur eine mehr oder minder veränderte mechanische Ausgabe des alten Handwerksinstruments, wie bei dem mechanischen Webstuhl(FN 90), oder die am Gerüst der Arbeitsmaschine angebrachten thätigen Organe sind alte Bekannte, wie Spindeln bei der Spinnmaschine, Nadeln beim Strumpfwirkerstuhl, Sägeblätter bei der Sägemaschine, Messer bei der Zerhackmaschine u. s. w. Der Unterschied dieser Werkzeuge von dem eigentlichen Körper der Arbeitsmaschine erstreckt sich bis auf ihre Geburt. Sie werden nämlich immer noch grossentheils handwerksmässig oder manufakturmässig producirt und später erst an den maschinenmässig producirten Körper der Arbeitsmaschine befestigt(FN 91). Die Werkzeugmaschine ist also ein Mechanismus, der, nach Mittheilung der entsprechenden Bewegung, mit seinen Werkzeugen dieselben Operationen verrichtet, welche früher der Arbeiter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtete. Ob die Triebkraft nun vom Menschen ausgeht oder selbst wieder von einer Maschine, ändert am Wesen der Sache nichts. Nach Uebertragung des eigentlichen Werk-
zeugs vom Menschen auf einen Mechanismus, tritt eine Maschine an die Stelle eines blossen Werkzeugs. Der Unterschied springt sofort ins Auge, auch wenn der Mensch selbst noch der erste Motor bleibt. Die Anzahl von Arbeitsinstrumenten, womit er gleichzeitig wirken kann, ist durch die Anzahl seiner natürlichen Produktionsinstrumente, seiner eignen körperlichen Organe, beschränkt. Man versuchte in Deutschland erst einen Spinner zwei Spinnräder treten, ihn also gleichzeitig mit zwei Händen und zwei Füssen arbeiten zu lassen. Diess war zu anstrengend. Später erfand man ein Tret-Spinnrad mit zwei Spindeln, aber die Spinnvirtuosen, die zwei Fäden gleichzeitig spinnen konnten, waren fast so selten als zweiköpfige Menschen. Die Jenny spinnt dagegen von vorn herein mit 12—18 Spindeln, der Strumpfwirkerstuhl strickt mit viel 1000 Nadeln auf einmal u. s. w. Die Anzahl der Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugmaschine gleichzeitig spielt, ist von vorn herein emancipirt von der organischen Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters beengt wird.
An vielem Handwerkszeug besitzt der Unterschied zwischen dem Menschen als blosser Triebkraft und als Arbeiter mit dem eigentlichen Operateur eine sinnlich besonderte Existenz. Z. B. beim Spinnrad wirkt der Fuss nur als Triebkraft, während die Hand, die an der Spindel arbeitet, zupft und dreht, die eigentliche Spinnoperation verrichtet. Grade diesen letzten Theil des Handwerksinstruments ergreift die industrielle Revolution zuerst und überlässt dem Menschen, neben der neuen Arbeit die Maschine mit seinem Auge zu überwachen und ihre Irrthümer mit seiner Hand zu verbessern, zunächst noch die rein mechanische Rolle der Triebkraft. Werkzeuge dagegen, auf die der Mensch von vorn herein nur als einfache Triebkraft wirkt, wie z. B. beim Drehn der Kurbel einer Mühle(FN 92), bei Pumpen, beim Aufund Abbewegen der Arme eines Blasbalgs, beim Stossen eines Mörsers u. s. w., rufen zwar zuerst die Anwendung von Thieren, Wasser, Wind(FN 93) als Bewegungskräften hervor. Sie recken sich,
theilweise innerhalb, sporadisch schon lange vor der Manufakturperiode, zu Maschinen, aber sie revolutioniren die Produktionsweise nicht. Dass sie selbst in ihrer handwerksmässigen Form bereits Maschinen sind, zeigt sich in der Periode der grossen Industrie. Die Pumpen z. B., womit die Holländer 1836—37 den See von Harlem auspumpten, waren nach dem Princip gewöhnlicher Pumpen konstruirt, nur dass cyklopische Dampfmaschinen statt der Menschenhände ihre Kolben trieben. Der gewöhnliche und sehr unvollkommene Blasbalg des Grobschmidts wird noch zuweilen in England durch blosse Verbindung seines Arms mit einer Dampfmaschine in eine mechanische Luftpumpe verwandelt. Die Dampfmaschine selbst, wie sie Ende des 17. Jahrhunderts, während der Manufakturperiode, erfunden ward und bis zum Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts fortexistirte(FN 94), rief keine industrielle Revolution hervor. Es war vielmehr umgekehrt die Schöpfung der Werkzeugmaschinen, welche die revolutionirte Dampfmaschine nothwendig und darum möglich machte. Sobald der Mensch, statt mit dem Werkzeug auf den Arbeitsgegenstand, nur noch als Triebkraft auf eine Werkzeugmaschine wirkt, wird die Verkleidung der Triebkraft in menschliche Muskel zufällig und kann Wind, Wasser, Dampf u. s. w. an die Stelle treten. Diess schliesst natürlich nicht aus, dass solcher Wechsel oft grosse technische Aenderungen des ursprünglich für menschliche Triebkraft allein konstruirten Mechanismus bedingt. Heutzutage werden alle Maschinen, die sich erst Bahn brechen müssen, wie Nähmaschinen, Brodbereitungsmaschinen u. s. w., wenn sie den kleinen Massstab nicht von vorn herein durch ihre Bestimmung ausschliessen, für menschliche und rein mechanische Triebkraft zugleich konstruirt.
Die Maschine, wovon die industrielle Revolution ausgeht, ersetzt den Arbeiter, der ein einzelnes Werkzeug handhabt, durch einen Mechanismus, der mit einer Masse derselben oder gleichartiger Werkzeuge auf einmal operirt, und von einer einzigen Triebkraft, welches immer ihre Form, bewegt wird(FN 95). Hier haben wir die Maschine, aber erst als einfaches Element der maschinenmässigen Produktion.
Die Erweiterung des Umfangs der Arbeitsmaschine und der Zahl ihrer gleichzeitig operirenden Werkzeuge bedingt einen massenhafteren Bewegungsmechanismus, und dieser Mechanismus, zur Ueberwältigung seines eignen Widerstands, eine mächtigere Triebkraft als die menschliche, abgesehn davon, dass der Mensch ein sehr unvollkommenes Produktionsinstrument gleichförmiger und kontinuirlicher Bewegung ist. Vorausgesetzt, dass er nur noch als einfache Triebkraft wirkt, also an die Stelle seines Werkzeugs eine Werkzeugmaschine getreten ist, können Naturkräfte ihn jetzt auch als Triebkraft ersetzen. Von allen aus der Manufakturperiode überlieferten grossen Bewegungskräften war die Pferdekraft die schlechteste, theils weil ein Pferd seinen eignen Kopf hat, theils wegen seiner Kostspieligkeit und des beschränkten Umfangs, worin es in Fabriken allein anwendbar ist(FN 96). Dennoch wurde das Pferd häufig während der Kinder-
zeit der grossen Industrie angewandt, wie, ausser dem Jammer gleichzeitiger Agronomen, schon der bis heute überlieferte Ausdruck der mechanischen Kraft in Pferdekraft bezeugt. Der Wind war zu unstät und unkontrolirbar, und die Anwendung der Wasserkraft überwog ausserdem in England, dem Geburtsland der grossen Industrie, schon während der Manufakturperiode. Man hatte bereits im 17. Jahrhundert versucht, zwei Läufer und also auch zwei Mahlgänge mit einem Wasserrad in Bewegung zu setzen. Der geschwollne Umfang des Transmissionsmechanismus gerieth aber jetzt in Konflikt mit der nun unzureichenden Wasserkraft und diess ist einer der Umstände, der zur genaueren Untersuchung der Friktionsgesetze trieb. Ebenso führte das ungleichförmige Wirken der Bewegungskraft bei Mühlen, die durch Stossen und Ziehen mit Schwengeln in Bewegung gesetzt wurden, auf die Theorie und Anwendung des Schwungrads(FN 97), das später eine so wichtige Rolle in der grossen Industrie spielt. In dieser Art entwickelte die Manufakturperiode die ersten wissenschaftlichen und technologischen Elemente der grossen Industrie. Arkwright’s Throstlespinnerei wurde von vorn herein mit Wasser getrieben. Indess war auch der Gebrauch der Wasserkraft als herrschender Triebkraft mit erschwerenden Umständen verbunden. Sie konnte nicht beliebig erhöht und ihrem Mangel nicht abgeholfen werden, sie versagte zuweilen und war vor allem rein lokaler Natur(FN 98). Erst mit Watt’s zweiter, s. g. doppelt wirkender Dampfmaschine war ein erster Motor gefunden, der seine Bewegungskraft selbst aus der Verspeisung von Kohlen und Wasser erzeugt, dessen Kraftpotenz ganz unter menschlicher Kontrole steht, der mobil und ein Mittel der Lokomotion, städtisch, und nicht gleich dem Wasserrad ländlich, die Koncentration der Produktion in Städten erlaubt, statt sie wie das Wasserrad über das Land zu zer-
streuen(FN 99), universell in seiner technologischen Anwendung, in seiner Residenz verhältnissmässig wenig durch lokale Umstände bedingt. Das grosse Genie Watt’s zeigte sich in der Specifikation des Patents, das er April 1784 nahm, und worin seine Dampfmaschine nicht als eine Erfindung zu besondern Zwecken, sondern als allgemeiner Agent der grossen Industrie geschildert wird. Er deutet hier Anwendungen an, wovon manche, wie z. B. der Dampfhammer, mehr als ein halbes Jahrhundert später erst eingeführt wurden. Jedoch bezweifelte er die Anwendbarkeit der Dampfmaschine auf Seeschifffahrt. Seine Nachfolger, Boulton und Watt, stellten 1851 die kolossalste Dampfmaschine für Ocean steamers auf der Londoner Industrieausstellung aus.
Nachdem erst die Werkzeuge aus Werkzeugen des menschlichen Organismus in Werkzeuge eines mechanischen Apparats, der Werkzeugmaschine, verwandelt, erhielt nun auch die Bewegungsmaschine eine selbstständige, von den Schranken menschlicher Kraft völlig emancipirte Form. Damit sinkt die einzelne Werkzeugmaschine, die wir bisher betrachtet, zu einem blossen Element der maschinenmässigen Produktion herab. Eine Bewegungsmaschine konnte jetzt viele Arbeitsmaschinen gleichzeitig treiben. Mit der Anzahl der gleichzeitig bewegten Arbeitsmaschinen wächst die Bewegungsmaschine und dehnt sich der Transmissionsmechanismus zu einem weitläufigen Apparat aus.
Es ist nun zweierlei zu unterscheiden, Cooperation vieler gleichartiger Maschinen und Maschinensystem.
In dem einen Fall wird das ganze Machwerk von derselben Arbeitsmaschine verrichtet. Sie führt alle die verschiedenen Operationen
aus, welche ein Handwerker mit seinem Werkzeng, z. B. der Weber mit seinem Webstuhl verrichtete, oder welche Handwerker mit verschiednen Werkzeugen, sei es selbstständig oder als Glieder einer Manufaktur, der Reihe nach ausführten(FN 100). Z. B. in der modernen Manufaktur von Enveloppes faltete ein Arbeiter das Papier mit dem Falzbein, ein andrer legte den Gummi auf, ein dritter schlug die Klappe um, auf welche die Devise aufgedrückt wird, ein vierter bossirte die Devise u. s. w. und bei jeder dieser Theiloperationen musste jede einzelne Enveloppe die Hände wechseln. Eine einzige Enveloppemaschine verrichtet alle diese Operationen auf einen Schlag und macht 3000 und mehr Enveloppen in einer Stunde. Eine auf der Londoner Industrieausstellung von 1862 ausgestellte amerikanische Maschine zur Bereitung von Papiertuten schneidet das Papier, kleistert, faltet und vollendet 300 Stück per Minute. Der innerhalb der Manufaktur getheilte und in einer Reihenfolge ausgeführte Gesammtprozess wird hier von einer Arbeitsmaschine vollbracht, die durch Kombination verschiedner Werkzeuge wirkt. Ob nun eine solche Arbeitsmaschine nur mechanische Wiedergeburt eines komplicirteren Handwerkszeugs sei, oder Kombination verschiedenartiger manufakturmässig partikularisirter einfacher Instrumente, in der Fabrik, der neuen Form der auf Maschinenbetrieb gegründeten Werkstatt, erscheint jedesmal die einfache Cooperation wieder, zunächst, wir sehn hier vom Arbeiter ab, als räumliche Konglomeration gleichartiger und gleichzeitig zusammenwirkender Arbeitsmaschinen. So wird eine Webfabrik durch das Nebeneinander vieler mechanischen Webstühle und eine Nähfabrik durch das Nebeneinander vieler Nähmaschinen in demselben Arbeitsgebäude gebildet. Aber es existirt hier eine technologische Einheit, indem die vielen
gleichartigen Arbeitsmaschinen gleichzeitig und gleichmässig ihren Impuls empfangen vom Herzschlag des gemeinsamen ersten Motors, auf sie übertragen durch den Transmissionsmechanismus, der ihnen auch theilweis gemeinsam ist, indem sich nur besondere Ausläufe davon für jede einzelne Werkzeugmaschine verästeln. Ganz wie viele Werkzenge die Organe einer Arbeitsmaschine, bilden viele Arbeitsmaschinen jetzt nur noch viele gleichartige Organe desselben Bewegungsmechanismus.
Ein eigentliches Maschinensystem tritt aber erst an die Stelle der einzelnen selbstständigen Maschine, wo der Arbeitsgegenstand eine zusammenhängende Reihe verschiedner Stufenprozesse, ausgeführt von einer Kette verschiedenartiger, aber mit einander kombinirter Werkzeugsmaschinen, durchläuft. Hier erscheint die der Manufaktur eigenthümliche Cooperation durch Theilung der Arbeit wieder, aber jetzt als Kombination von Theilarbeitsmaschinen. Die specifischen Werkzeuge der verschiednen Theilarbeiter, in der Wollmanufaktur z. B. von Wollschläger, Wollkämmer, Wollscheerer, Wollspinner u. s. w., verwandeln sich jetzt in die Werkzeuge spezificirter Arbeitsmaschinen, von denen jede ein besondres Organ für eine besondre Funktion im System des kombinirten Werkzeugsmechanismus bildet. Die Manufaktur selbst liefert dem Maschinensystem in den Zweigen, worin es zuerst eingeführt wird, im Grossen und Ganzen die naturwüchsige Grundlage der Theilung und daher der Organisation des Produktionsprozesses(FN 101). Indess tritt sofort ein wesentlicher Unterschied ein. Bei der
Manufaktur muss jeder besondre Theilprozess von Arbeitern, einzeln oder in Gruppen, mit ihrem Handwerkszeug ausführbar sein. Wird der Arbeiter dem Prozess angeeignet, so ist aber auch vorher der Prozess dem Arbeiter angepasst. Diess subjektive Princip der Theilung fällt weg für die maschinenartige Produktion. Der Gesammtprozess wird hier objektiv, an und für sich betrachtet, in seine konstituirenden Phasen analysirt, und das Problem jeden Theilprozess auszuführen und die verschiednen Theilprozesse zu verbinden, durch technische Anwendung der Mechanik, Chemie u. s. w. gelöst(FN 102), wobei natürlich nach wie vor die theoretische Konception durch gehäufte praktische Erfahrung auf grosser Stufenleiter vervollkommnet werden muss. Jede Theilmaschine liefert der zunächst folgenden ihr Rohmaterial, und da sie alle gleichzeitig wirken, befindet sich das Produkt eben so fortwährend auf den verschiednen Stufen seines Bildungsprozesses, wie im Uebergang aus einer Produktionsphase in die andre. Wie in der Manufaktur die unmittelbare Cooperation der Theilarbeiter bestimmte Verhältnisszahlen zwischen den besondern Arbeitergruppen schafft, so in dem gegliederten Maschinensystem die beständige Beschäftigung der Theilmaschinen durch einander ein bestimmtes Verhältniss zwischen ihrer Anzahl, ihrem Umfang und ihrer Geschwindigkeit. Die kombinirte Arbeitsmaschine, jetzt ein gegliedertes System von verschiedenartigen einzelnen Arbeitsmaschinen und von Gruppen derselben, ist um so vollkommner, je kontinuirlicher ihr Gesammtprozess, d. h. mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von seiner ersten Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr also der Mechanismus selbst, statt der Menschenhand, es von einer Produktionsphase in die andre fördert. Wenn daher in der Manufaktur die Isolirung der Sonderprozesse ein durch die Theilung der Arbeit selbst gegebnes Princip ist, so in der entwickelten Fabrik die Kontinuität der Sonderprozesse.
Ein System der Maschinerie, beruhe es nun auf blosser Cooperation gleichartiger Arbeitsmaschinen, wie in der Weberei, oder auf einer Kombination verschiedenartiger, wie in der Spinnerei, bildet an und für sich einen grossen Automaten, sobald es von einem sich selbst bewegenden ersten Motor getrieben wird. Indess kann das ganze System z. B. von der Dampfmaschine getrieben werden, obgleich einzelne Werkzeugmaschinen entweder für gewisse Bewegungen noch den Arbeiter brauchen, wie die zum Einfahren der Mule nöthige Bewegung vor der Einführung der selfacting mule und immer noch bei Feinspinnerei, oder indem bestimmte Theile der Maschine zur Verrichtung ihres Werks gleich einem Werkzeug vom Arbeiter gelenkt werden müssen, wie beim Maschinenbau vor der Verwandlung des slide rest (ein Drehapparat) in einen selfactor. Sobald die Arbeitsmaschine alle zur Bearbeitung des Rohstoffs nöthigen Bewegungen ohne menschliche Beihilfe verrichtet und nur noch menschlicher Nachhilfe bedarf, haben wir ein automatisches System der Maschinerie, das indess beständiger Ausarbeitung im Detail fähig ist, wie z. B. ein Apparat, der die Spinnmaschine von selbst still setzt, sobald ein einzelner Faden reisst, und der selfacting stop, der den verbesserten Dampfwebstuhl still setzt, sobald der Spule des Weberschiffs der Einschlagsfaden ausgeht, ganz moderne Erfindungen sind. Als ein Beispiel sowohl der Kontinuität der Produktion als der Durchführung des automatischen Princips kann die moderne Papierfabrik gelten. An der Papierproduktion kann überhaupt der Unterschied verschiedner Produktionsweisen, auf Basis verschiedner Produktionsmittel, wie der Zusammenhang der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse mit dieser Produktionsweise, im Einzelnen vortheilhaft studirt werden, da uns die ältere deutsche Papiermacherei Muster der handwerksmässigen Produktion, Holland im 17. und Frankreich im 18. Jahrhundert Muster der eigentlichen Manufaktur, und das moderne England Muster der automatischen Fabrikation in diesem Zweig liefern, ausserdem in China und Indien noch zwei verschiedne uraltasiatische Formen derselben Industrie existiren.
Als gegliedertes System automatischer Arbeitsmaschinen, die ihre Bewegung durch Transmissionsmaschinerie von einem centralen Automaten empfangen, besitzt der Maschinenbetrieb seine entwickeltste Gestalt. An die Stelle der einzelnen Maschine tritt hier ein mechanisches Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude füllt, und dessen dämonische Kraft, erst
versteckt durch die fast feierlich gemessne Bewegung seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht.
Es gab Mules, Dampfmaschinen u. s. w., bevor es Arbeiter gab, deren ausschliessliches Geschäft es war, Dampfmaschinen, Mules u. s. w. zu machen, ganz wie der Mensch Kleider trug, bevor es Schneider gab. Die Erfindungen von Vauconson, Arkwright, Watt u. s. w. waren jedoch nur ausführbar, weil jene Erfinder ein von der Manufakturperiode fertig geliefertes und beträchtliches Quantum geschickter mechanischer Arbeiter vorfanden. Ein Theil dieser Arbeiter bestand aus selbstständigen Handwerkern verschiedner Profession, ein andrer Theil war in Manufakturen vereinigt, worin, wie früher erwähnt, die Theilung der Arbeit mit besondrer Strenge durchgeführt. Mit der Zunahme der Erfindungen und der wachsenden Nachfrage nach den neu erfundnen Maschinen entwickelte sich mehr und mehr einerseits die Sonderung der Maschinenfabrikation in mannichfaltige selbstständige Zweige, andrerseits die Theilung der Arbeit im Innern der maschinenbauenden Manufakturen. Wir erblicken hier also die Manufaktur als unmittelbare technologische Grundlage der grossen Industrie. Jene producirte die Maschinerie, womit diese, in den Produktionssphären, die sie zunächst ergriff, den handwerksund manufakturmässigen Betrieb aufhob. Der Maschinenbetrieb erhob sich also naturwüchsig auf einer ihm unangemessnen materiellen Grundlage. Auf einem gewissen Entwicklungsgrad musste er diese erst fertig vorgefundne und dann in ihrer alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst revolutioniren und sich eine seiner eignen Produktionsweise entsprechende neue Basis schaffen. Wie die einzelne Maschine zwergmässig bleibt, so lange sie nur durch Menschen bewegt wird, wie das Maschinensystem sich nicht frei entwickeln konnte, bevor an die Stelle der vorgefundnen Triebkräfte, Thier, Wind und selbst Wasser, die Dampfmaschine trat, ebenso war die grosse Industrie in ihrer ganzen Entwicklung gelähmt, so lange ihr charakteristisches Produktionsmittel, die Maschine selbst, seine Existenz persönlicher Kraft und persönlichem Geschick verdankte, also abhing von der Muskelentwicklung, der Schärfe des Blicks, und der Virtuosität der Hand, womit der Theilarbeiter in der Manufaktur und der Handwerker ausserhalb derselben ihr Zwerginstrument führten. Abgesehn von der Vertheurung der Maschinen in Folge ihrer
Ursprungsweise — und dieser Umstand beherrscht das Kapital als bewusstes Motiv — blieb so die Ausdehnung der bereits maschinenmässig betriebenen Industrie und das Eindringen der Maschinerie in neue Produktionszweige rein bedingt durch das Wachsthum einer Arbeiterkategorie, die wegen der halbkünstlerischen Natur ihres Geschäfts nur allmälig und nicht sprungweis vermehrt werden konnte. Aber auf einer gewissen Entwicklungsstufe gerieth die grosse Industrie auch technologisch in Widerstreit mit ihrer handwerksund manufakturmässigen Unterlage. Die Ausreckung des Umfangs der Bewegungsmaschinen, des Transmissionsmechanismus und der Werkzeugmaschinen, die grössere Komplikation, Mannichfaltigkeit und erforderte Regelmässigkeit ihrer Bestandtheile, im Masse wie die Werkzeugmaschine sich von dem handwerksmässigen Model, das ihren Bau ursprünglich beherrscht, losriss, und eine freie, nur durch ihre mechanische Aufgabe bestimmte Gestalt erhielt(FN 103), die Ausbildung des automatischen Systems und die stets unvermeidlichere Anwendung von schwer zu bewältigendem Material, z. B. Eisen statt Holz — die Lösung aller dieser naturwüchsig entspringenden Aufgaben stiess überall auf die persönlichen Schranken, die auch das in der Manufaktur kombinirte Arbeiterpersonal nur dem Grad, nicht dem Wesen nach durchbricht. Maschinen z. B. wie die moderne Druckerpresse, der moderne Dampfwebstuhl und die moderne Kardirmaschine konnten nicht von der Manufaktur geliefert werden.
Die Umwälzung der Produktionsweise in einer Sphäre der Industrie bedingt ihre Umwälzung in der andern. Es gilt diess zunächst für solche Industriezweige, welche, trotz der Isolation durch die gesellschaftliche Theilung der Arbeit, so dass jeder derselben eine selbstständige
Waare producirt, sich dennoch als Phasen eines Gesammtprozesses verschlingen. So machte die Maschinenspinnerei Maschinenweberei nöthig und beide zusammen die mechanisch-chemische Revolution der Bleicherei, Druckerei und Färberei, wie andrerseits die Revolution in der Baumwollspinnerei die Erfindung des gin zur Trennung der Baumwollfaser vom Samen hervorrief, womit erst die Baumwollproduktion auf dem nun erheischten grossen Massstab möglich ward(FN 104). Die Revolution in der Produktionsweise der Industrie und Agrikultur ernöthigte namentlich aber auch eine Revolution in den allgemeinen Bedingungen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, d. h. den Kommunikationsund Transportmitteln. Wie die Kommunikationsund Transportmittel einer Gesellschaft, deren Pivôt, um mich eines Ausdrucks Fourier’s zu bedienen, die kleine Agrikultur mit ihrer häuslichen Nebenindustrie und das städtische Handwerk waren, den Produktionsbedürfnissen der Manufakturperiode mit ihrer erweiterten Theilung der gesellschaftlichen Arbeit, ihrer Koncentration von Arbeitsmitteln und Arbeitern, und ihren Kolonialmärkten durchaus nicht genügen konnten, daher auch in der That umgewälzt wurden, so verwandelten sich die von der Manufakturperiode überlieferten Transportund Kommunikationsmittel bald in unerträgliche Hemmschuhe für die grosse Industrie mit ihrer fieberhaften Geschwindigkeit der Produktion, ihrer massenhaften Stufenleiter, ihrem beständigen Werfen von Kapitalund Arbeitermassen aus einer Produktionssphäre in die andre, und ihren neugeschaffenen weltmarktlichen Zusammenhängen. Neben einem ganz umgewälzten Segelschiffbau, wurde das Kommunikationsund Transportwesen daher allmälig durch ein System von Flussdampfschiffen, Eisenbahnen, oceanischen Dampfschiffen und Telegraphen der Produktionsweise der grossen Industrie angeeignet. Die furchtbaren Eisenmassen aber, die jetzt zu schmieden, zu schweissen, zu schneiden, zu bohren und zu formen waren, erforderten ihrerseits cyklopische Maschinen, deren Schöpfung der manufakturmässige Maschinenbau versagte.
Die grosse Industrie musste sich also ihres charakteristischen Produktionsmittels, der Maschine selbst bemächtigen, um Maschinen durch Maschinen zu produciren. So erst schuf sie sich eine adäquate technologische Unterlage und stellte sich auf ihre eignen Füsse. Mit dem wachsenden Maschinenbetrieb in den ersten Decennien des 19. Jahrhunderts bemächtigte sich die Maschinerie in der That allmälig der Fabrikation der Werkzeugmaschinen, während erst in den letztverflossenen Decennien ungeheurer Eisenbahnbau und oceanische Dampfschifffahrt die in der Konstruktion von ersten Motoren angewandten cyklopischen Maschinen ins Leben riefen.
Die wesentlichste Produktionsbedingung für die Fabrikation von Maschinen durch Maschinen war eine jeder Kraftpotenz fähige und doch zugleich ganz kontrolirbare Bewegungsmaschine. Sie existirte bereits in der Dampfmaschine. Aber es galt zugleich die für die einzelnen Maschinentheile nöthigen streng geometrischen Formen wie Linie, Ebene, Kreis, Cylinder, Kegel und Kugel maschinenmässig zu produciren. Diess Problem löste Henry Maudsley im ersten Decennium des 19. Jahrhunderts durch die Erfindung des slide-rest, der bald automatisch gemacht und in modificirter Form von der Drechselbank, wofür er zuerst bestimmt war, auf andre Konstruktionsmaschinen übertragen wurde. Diese mechanische Vorrichtung ersetzt nicht irgend ein besondres Werkzeug, sondern die menschliche Hand selbst, die eine bestimmte Form hervorbringt durch Vorhalten, Anpassen und Richtung der Schärfe von Schneideinstrumenten u. s. w. gegen oder über das Arbeitsmaterial, z. B. Eisen. So gelang es die geometrischen Formen der einzelnen Maschinentheile „mit einem Grad von Leichtigkeit, Genauigkeit und Raschheit zu produciren, den keine gehäufte Erfahrung der Hand des geschicktesten Arbeiters verleihen konnte“(FN 105).
Betrachten wir nun in der zum Maschinenbau angewandten Maschinerie den Theil derselben, der die eigentliche Werkzeugmaschine
bildet, so erscheint das handwerksmässige Instrument wieder, aber in cyklopischem Umfang. Der Operateur der Bohrmaschine z. B. ist ein ungeheurer Bohrer, der durch eine Dampfmaschine getrieben wird und ohne den umgekehrt die Cylinder grosser Dampfmaschinen und hydraulischer Pressen nicht producirt werden könnten. Die mechanische Drechselbank ist die cyklopische Wiedergeburt der gewöhnlichen Fussdrechselbank, die Hobelmaschine ein eiserner Zimmermann, der mit denselben Werkzeugen in Eisen arbeitet, womit der Zimmermann in Holz; das Werkzeug, welches in den Londoner Schiffswerften das Furnirwerk schneidet, ist ein riesenartiges Rasirmesser, das Werkzeug der Scheermaschine, welche Eisen schneidet, wie die Schneiderscheere Tuch, eine Monsterscheere, und der Dampfhammer operirt mit einem gewöhnlichen Hammerkopf, aber von solchem Gewicht, dass Thor selbst ihn nicht schwingen könnte(FN 106). Einer dieser Dampfhämmer z. B., die eine Erfindung von Nasmyth sind, wiegt über 6 Tonnen und stürzt mit einem perpendikulären Fall von 7 Fuss auf einen Amboss von 36 Tonnen Gewicht. Er pulverisirt spielend einen Granitblock, und ist nicht minder fähig einen Nagel in weiches Holz mit einer Aufeinanderfolge leiser Schläge einzutreiben(FN 107).
Das Arbeitsmittel erhält in der Maschinerie eine materielle Existenzweise, welche Ersetzung der Menschenkraft durch Naturkräfte und erfahrungsmässiger Routine durch bewusste Anwendung der Naturwissenschaft bedingt. In der Manufaktur ist die Gliederung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses rein subjektiv, Kombination von Theilarbeitern; im Maschinensystem schafft die grosse Industrie einen ganz objektiven Produktionsorganismus, den der Arbeiter als fertige materielle Produktionsbedingung vorfindet. In der einfachen Cooperation und selbst in der durch Theilung der Arbeit spezificirten erscheint die Verdrängung des vereinzelten Arbeiters durch den vergesellschafteten immer noch mehr oder minder zufällig. Die Maschinerie, mit einigen später zu er-
wähnenden Ausnahmen, funktionirt nur in der Hand unmittelbar vergesellschafteter oder gemeinsamer Arbeit. Der cooperative Charakter des Arbeitsprozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst diktirte technologische Nothwendigkeit.
Man sah, dass die aus der Cooperation und der Theilung der Arbeit entspringenden Produktivkräfte dem Kapital nichts kosten. Sie sind Naturkräfte der gesellschaftlichen Arbeit. Naturkräfte, wie Dampf, Wasser u. s. w., die zu produktiven Prozessen angeeignet werden, kosten ebenfalls nichts. Wie aber der Mensch eine Lunge zum Athmen braucht, braucht er ein „Gebild von Menschenhand,“ um Naturkräfte produktiv zu konsumiren. Ein Wasserrad ist nöthig, um die Bewegungskraft des Wassers, eine Dampfmaschine, um die Elasticität des Dampfs auszubeuten. Wie mit den Naturkräften, verhält es sich mit der Wissenschaft. Einmal entdeckt, kostet das Gesetz über die Abweichung der Magnetnadel im Wirkungskreise eines elektrischen Stroms oder über Erzeugung von Magnetismus im Eisen, um das ein elektrischer Strom kreist, keinen Deut(FN 108). Aber zur Ausbeutung dieser Gesetze für Telegraphie u. s. w. bedarf es eines sehr kostspieligen und weitläufigen Apparats. Durch die Maschine wird, wie wir sahen, das Werkzeug nicht verdrängt. Aus einem Zwerg-Werkzeug des menschlichen Organismus reckt es sich in Umfang und Zahl zum Werkzeug eines vom Menschen geschaffenen Mechanismus. Statt mit dem Handwerkszeug, lässt das Kapital den Arbeiter jetzt mit einer Maschine arbeiten, die ihre Werkzeuge selbst führt. Wenn es daher auf den ersten Blick klar ist, dass die grosse Industrie durch Einverleibung ungeheurer Naturkräfte und der Naturwissenschaft in den Produktionsprozess die Produktivität der Arbeit ausserordentlich steigern muss, ist es keineswegs eben so klar, dass diese gesteigerte Produktivkraft nicht durch vermehrte Arbeitsausgabe auf der andern Seite erkauft wird. Gleich jedem
andern Bestandtheil des constanten Kapitals, schafft die Maschinerie keinen Werth, giebt aber ihren eignen Werth an das Produkt ab, zu dessen Erzeugung sie dient. Soweit sie Werth hat und daher Werth auf das Produkt überträgt, bildet sie einen Werthbestandtheil desselben. Statt es zu verwohlfeilern, vertheuert sie es im Verhältniss zu ihrem eignen Werth. Und es ist handgreiflich, dass Maschine und systematisch entwickelte Maschinerie, das charakteristische Arbeitsmittel der grossen Industrie, unverhältnissmässig an Werth schwillt, verglichen mit den Arbeitsmitteln des Handwerksund Manufakturbetriebs.
Es ist nun zunächst zu bemerken, dass die Maschinerie stets ganz in den Arbeitsprozess und immer nur theilweis in den Verwerthungsprozess eingeht. Sie setzt dem Produkt nie mehr Werth zu als sie im Durchschnitt durch ihre tägliche Abnutzung verliert. Es findet also grosse Differenz statt zwischen dem Maschinenwerth und dem Werththeil der Maschine, der im täglichen Produkt derselben wiedererscheint. Es findet eine grosse Differenz statt zwischen der Maschine als werthbildendem und als produktbildendem Element. Je grösser die Periode, während welcher dieselbe Maschinerie wiederholt in demselben Arbeitsprozess dient, desto grösser jene Differenz. Allerdings haben wir gesehn, dass jedes eigentliche Arbeitsmittel oder Produktionsinstrument immer ganz in den Arbeitsprozess und stets nur stückweis, im Verhältniss zu seinem täglichen Durchschnittsverschleiss, in den Verwerthungsprozess eingeht. Diese Differenz jedoch zwischen der Benutzung und der Abnutzung des Arbeitsmittels, zwischen dem Dienst, den es in der Waarenproduktion leistet, und der Vertheurung der Waare, die es durch Uebertragen seines Werths auf dieselbe hervorbringt, ist viel grösser bei der Maschinerie als bei dem Werkzeug, weil sie, aus dauerhafterem Material gebaut, eine längere Lebensperiode besitzt, weil ihre Anwendung im Arbeitsprozess, durch streng wissenschaftliche Gesetze geregelt, grössere Oekonomie in der Verausgabung ihrer Bestandtheile und ihrer Konsumtionsmittel ermöglicht, und endlich, weil ihr Produktionsfeld unverhältnissmässig grösser ist als das des Werkzeugs. Ziehn wir von beiden, von Maschinerie und Werkzeug, ihre tägliche Durchschnittskost ab, oder den Werthbestandtheil, den sie durch täglichen Durchschnittsverschleiss und den Konsum von Hilfsstoffen, wie Oel, Kohlen u. s. w. dem Produkt zusetzen, so wirken sie umsonst, ganz wie ohne Zuthun menschlicher
Arbeit vorhandne Naturkräfte. Um so grösser der produktive Wirkungsumfang der Maschinerie als der des Werkzeugs, um so grösser ist der Umfang ihres unentgeldlichen Dienstes verglichen mit dem des Werkzeugs. Erst in der grossen Industrie lernt der Mensch das Produkt seiner vergangnen, bereits vergegenständlichten Arbeit auf grossem Massstab gleich einer Naturkraft umsonst wirken zu lassen(FN 109).
Es ergab sich bei Betrachtung der Cooperation und Manufaktur, dass gewisse allgemeine Produktionsbedingungen, wie Baulichkeiten u. s. w., im Vergleich mit den zersplitterten Produktionsbedingungen vereinzelter Arbeiter durch den gemeinsamen Konsum ökonomisirt werden, daher das Produkt weniger vertheuern. Bei der Maschinerie wird nicht nur der Körper einer Arbeitsmaschine von ihren vielen Werkzeugen, sondern dieselbe Bewegungsmaschine nebst einem Theil des Transmissionsmechanismus von vielen Arbeitsmaschinen gemeinsam verbraucht.
Gegeben die Differenz zwischen dem Werth der Maschinerie und dem von ihr auf das Tagesprodukt übertragenen Werththeil, hängt der Grad, worin dieser Werththeil das Produkt vertheuert, zunächst vom Umfang des Produkts ab, gleichsam von seiner Oberfläche. Herr Baynes aus Blackburn schätzt in einer 1858 veröffentlichten Vorlesung, dass „jede reale mechanische Pferdekraft 450 selfacting Mulespindeln nebst Vorgeschirr treibt oder 200 Throstlespindeln oder 15 Webstühle für 40 inch cloth nebst den Vorrichtungen zum Aufziehn der Kette, Schlichten u. s. w.“ Es ist im ersten Fall das Tagesprodukt von 450 Mulespindeln, im zweiten von 200 Throstlespindeln, im dritten von 15 mechanischen Webstühlen, worüber sich die täglichen Kosten einer Dampf-
pferdekraft und der Verschleiss der von ihr in Bewegung gesetzten Maschinerie vertheilen, so dass hierdurch auf eine Unze Garn oder eine Elle Geweb nur ein winziger Werththeil übertragen wird. Ebenso im obigen Beispiel mit dem Dampfhammer. Da sich sein täglicher Verschleiss, Kohlenkonsum u. s. w. vertheilen auf die furchtbaren Eisenmassen, die er täglich hämmert, hängt sich jedem Centner Eisen nur ein geringer Werththeil an, der sehr gross wäre, sollte das cyklopische Instrument kleine Nägel eintreiben.
Den Wirkungskreis der Arbeitsmaschine, also die Anzahl ihrer Werkzeuge, oder, wo es sich um Kraft handelt, deren Umfang gegeben, wird die Produktenmasse von der Geschwindigkeit abhängen, womit sie operirt, also z. B. von der Geschwindigkeit, womit sich die Spindel dreht, oder der Anzahl Schläge, die der Hammer in einer Minute austheilt. Manche jener kolossalen Hämmer geben 70 Schläge, Ryder’s Schmiedepatentmaschine, die Dampfhämmer in kleineren Dimensionen zum Schmieden von Spindeln anwendet, 700 Schläge in einer Minute.
Die Proportion gegeben, worin die Maschinerie Werth auf das Produkt überträgt, hängt die Grösse dieses Werththeils von ihrer eignen Werthgrösse ab(FN 110). Je weniger Arbeit sie selbst enthält, desto weniger Werth setzt sie dem Produkt zu. Je weniger Werth bildend, desto produktiver ist sie und desto mehr nähert sich ihr Dienst dem der Naturkräfte. Die Produktion der Maschinerie durch Maschinerie verringert aber ihren Werth, verhältnissmässig zu ihrer Ausdehnung und Wirkung.
Eine vergleichende Analyse der Preise handwerksoder manufakturmässig producirter Waaren und der Preise derselben Waaren als Maschi-
nenprodukt ergiebt im Allgemeinen das Resultat, dass beim Maschinenprodukt der dem Arbeitsmittel geschuldete Werthbestandtheil relativ wächst, aber absolut abnimmt. Das heisst, seine absolute Grösse nimmt ab, aber seine Grösse im Verhältniss zum Gesammtwerth des Produkts, z. B. eines Pfundes Garn, nimmt zu(FN 111).
Es ist klar, dass blosses Deplacement der Arbeit stattfindet, also die Gesammtsumme der zur Produktion einer Waare erheischten Arbeit nicht vermindert oder die Produktivkraft der Arbeit nicht vermehrt wird, wenn die Produktion einer Maschine so viel Arbeit kostet als ihre Anwendung erspart. Die Differenz jedoch zwischen der Arbeit, die sie kostet, und der Arbeit, die sie erspart, oder der Grad ihrer Produktivität hängt offenbar nicht ab von der Differenz zwischen ihrem eigenen Werth und dem Werth des von ihr ersetzten Werkzeugs. Die Differenz dauert so lange
als die Arbeitskost der Maschine und daher der von ihr dem Produkt zugesetzte Werththeil kleiner bleiben als der Werth, den der Arbeiter mit seinem Werkzeug dem Arbeitsgegenstand zusetzen würde. Die Produktivität der Maschine misst sich daher an dem Grad, worin sie menschliche Arbeitskraft ersetzt. Nach Herrn Baynes kommen auf 450 Mulespindeln nebst Vormaschinerie, die von einer Dampfpferdekraft getrieben werden, 2½ Arbeiter(FN 112) und werden mit jeder selfacting mule spindle bei zehnstündigem Arbeitstag 13 Unzen Garn (Durchschnittsnumer), also wöchentlich 365⅝ lbs. Garn von 2½ Arbeitern gesponnen. Bei ihrer Verwandlung in Garn absorbiren ungefähr 366 Pfund Baumwolle (wir sehn der Vereinfachung halber vom Abfall ab) also nur 150 Arbeitsstunden oder 15 zehnstündige Arbeitstage, während mit dem Spinnrad, wenn der Handspinner 13 Unzen Garn in 60 Stunden liefert, dasselbe Quantum Baumwolle 2700 Arbeitstage von 10 Stunden oder 27,000 Arbeitsstunden absorbiren würde(FN 113). Wo die alte Methode des blockprinting oder der Handkattundruckerei durch Maschinendruck verdrängt ist, druckt eine einzige Maschine mit dem Beistand eines Mannes oder Jungen so viel vierfarbigen Kattun in einer Stunde als früher 200 Männer(FN 114). Bevor Eli Whitney 1793 den cottongin erfand, kostete die Trennung eines Pfundes Baumwolle vom Samen einen Durchschnittsarbeitstag. In Folge seiner Erfindung konnten täglich 100 lbs. Baumwolle von einer Negerin gewonnen werden und die Wirksamkeit des gin ward
seit seiner ersten Einführung noch bedeutend erhöht. Die Baumwollfaser, früher zu 50 cents per Pfund producirt, wird später mit grösserem Profit, d. h. mit Einschluss von mehr unbezahlter Arbeit, zu 10 cents verkauft. In Indien wird zur Trennung der Faser vom Samen ein halbmaschinenartiges Instrument, die Churka, angewandt, womit ein Mann und eine Frau 28 lbs. täglich reinigen können. Mit der von Dr. Forbes vor einigen Jahren erfundenen Churka produciren 1 Mann und 1 Junge täglich 250 lbs.; wo Ochsen, Dampf oder Wasser als Triebkräfte gebraucht werden, sind nur wenige Jungen und Mädchen als feeders (Handlanger des Materials für die Maschine) erheischt. Sechszehn dieser Maschinen, mit Ochsen getrieben, verrichten täglich das frühere Durchschnitts-Tagewerk von 750 Leuten(FN 115).
Wie bereits erwähnt, verrichtet die Dampfmaschine, beim Dampfpflug z. B., in einer Stunde zu 3 d. oder ¼ sh. so viel Werk als 66 Menschen zu 15 sh. per Stunde. Ich komme auf diess Beispiel zurück gegen eine falsche Vorstellung. Die 15 sh. sind nämlich keineswegs der Ausdruck der während einer Stunde von den 66 Menschen zugefügten Arbeit. War das Verhältniss von Mehrarbeit zu nothwendiger Arbeit 100 %, so producirten diese 66 Arbeiter per Stunde einen Werth von 30 sh., obgleich sich nur 33 Stunden in einem Aequivalent für sie selbst, d. h. im Arbeitslohn von 15 sh. darstellen. Gesetzt also, eine Maschine koste eben so viel als z. B. der Jahreslohn von 150 durch sie verdrängten Arbeitern, sage 3000 Pfd. St., so sind 3000 Pfd. St. keineswegs der Geldausdruck der Gesammtarbeit, welche die 150 Arbeiter lieferten und dem Arbeitsgegenstand zusetzten, sondern nur des Theils ihrer Jahresarbeit, der sich in einem Aequivalent für sie selbst, vulgo Arbeitslohn, darstellte. Ist dagegen der Werth der Maschine 3000 Pfd. St., so sind diese 3000 Pfd. St. der Geldausdruck aller zu ihrer Produktion verausgabten Arbeit, in welchem Verhältniss immer diese Arbeit Arbeitslohn für den Arbeiter und Mehrwerth für den Kapitalisten bilde. Kostet die Maschine also ebensoviel als die von ihr ersetzte Arbeitskraft, so ist die
in ihr selbst vergegenständlichte Arbeit stets viel kleiner als die von ihr ersetzte lebendige Arbeit(FN 116).
Ausschliesslich als Mittel zur Verwohlfeilerung des Produkts betrachtet, ist die Grenze für den Gebrauch der Maschinerie darin gegeben, dass ihre eigne Produktion weniger Arbeit kostet als ihre Anwendung Arbeit ersetzt. Für das Kapital jedoch drückt sich diese Grenze enger aus. Da es nicht die angewandte Arbeit zahlt, sondern den Werth der angewandten Arbeitskraft, wird ihm der Maschinengebrauch begrenzt durch die Differenz zwischen dem Maschinenwerth und dem Werth der von ihr ersetzten Arbeitskraft. Da die Theilung des Arbeitstags in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit, oder, populär ausgedrückt, in bezahlte Arbeit und unbezahlte Arbeit, sowohl in verschiedenen Ländern als in demselben Lande zu verschiedenen Perioden oder in verschiedenen Geschäftszweigen während derselben Periode sehr verschieden sein kann, da ferner der wirkliche Lohn des Arbeiters bald unter den Werth seiner Arbeitskraft sinkt, bald über ihn steigt, kann die Differenz zwischen dem Preise der Maschinerie und dem Preise der von ihr zu ersetzenden Arbeitskraft sehr variiren, wenn auch die Differenz zwischen dem zur Produktion der Maschine nöthigen Arbeitsquantum und dem Gesammtquantum der von ihr ersetzten Arbeit dieselbe bleibt. Es ist aber nur die erste Differenz, welche die Kost der Waare für den Kapitalisten selbst bestimmt und ihn durch die Zwangsgesetze der Konkurrenz beeinflusst. Es werden daher heute Maschinen in England erfunden, die nur in Nordamerika angewandt werden, wie Deutschland im 16. und 17. Jahrhundert Maschinen erfand, die nur Holland anwandte, und wie manche französische Erfindung des 18. Jahrhunderts nur in England ausgebeutet ward. Die Maschine selbst producirt in älter entwickelten Ländern durch ihre Anwendung auf einige Geschäftszweige in anderen Zweigen solchen Arbeitsüberfluss ( redundancy of labour, sagt Ricardo), dass hier der Fall des Arbeitslohns unter den Werth der Arbeitskraft den Gebrauch der Maschinerie verhindert und ihn vom Standpunkt des Kapitals, dessen Gewinn ohnehin aus der Ver-
minderung nicht der angewandten, sondern der bezahlten Arbeit entspringt, überflüssig, oft unmöglich macht. In einigen Zweigen der englischen Wollmanufaktur ist während der letzten Jahre die Kinderarbeit sehr vermindert, hier und da fast verdrängt worden. Warum? Der Fabrikakt ernöthigte eine doppelte Kinderreihe, von denen je eine 6, die andere 4 Stunden, oder jede nur 5 Stunden arbeitet. Die Aeltern wollten aber die half-times (Halbzeitler) nicht wohlfeiler verkaufen als früher die full-times (Vollzeitler). Daher Ersetzung der half-times durch Maschinerie(FN 117). Vor dem Verbot der Arbeit von Weibern und Kindern (unter 10 Jahren) in Minen, fand das Kapital die Methode, nackte Weiber und Mädchen, oft mit Männern zusammengebunden, in Kohlenund andern Minen zu vernutzen, so übereinstimmend mit seinem Moralkodex und namentlich auch seinem Hauptbuch, dass erst nach dem Verbot Maschinerie sie für einige Funktionen ersetzte. Die Yankees haben Maschinen zum Steinklopfen erfunden. Die Engländer wenden sie nicht an, weil der „ Elende“ („ wretch“ ist Kunstausdruck der englischen politischen Oekonomie für den Agrikulturarbeiter), der diese Arbeit verrichtet, einen so geringen Theil seiner Arbeit bezahlt erhält, dass Maschinerie die Produktion für den Kapitalisten vertheuern würde(FN 118). In England werden gelegentlich statt der Pferde immer noch Weiber zum Ziehn u. s. w. bei den Kanalbauten verwandt(FN 119), weil die zur Produktion von Pferden und Maschinen erheischte Arbeit ein mathematisch ge-
gebnes Quantum, die zur Erhaltung von Weibern der Surpluspopulation dagegen unter aller Berechnung steht. Man findet daher nirgendwo schamlosere Verschwendung von Menschenkraft für Lumpereien als grade in England, dem Land der Maschinen.
Den Ausgangspunkt der grossen Industrie bildet, wie gezeigt, die Revolution des Arbeitsmittels, und das umgewälzte Arbeitsmittel erhält seine meist entwickelte Gestalt im gegliederten Maschinensystem der Fabrik. Bevor wir zusehn, wie diesem objektiven Organismus Menschenmaterial einverleibt wird, betrachten wir einige allgemeine Rückwirkungen jener Revolution auf den Arbeiter selbst.
Sofern die Maschinerie Muskelkraft entbehrlich macht, wird sie zum Mittel Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körperentwicklung, aber grösserer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwenden. Weiberund Kinderarbeit war daher das erste Wort der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie! Diess gewaltige Ersatzmittel von Arbeit und Arbeitern verwandelte sich damit sofort in ein Mittel die Zahl der Lohnarbeiter zu vermehren durch Einrollirung aller Mitglieder der Arbeiterfamilie, ohne Unterschied von Geschlecht und Alter, unter die unmittelbare Botmässigkeit des Kapitals. Die Zwangsarbeit für den Kapitalisten usurpirte nicht nur die Stelle des Kinderspiels, sondern auch der freien Arbeit im häuslichen Kreis, innerhalb sittlicher Schranke, für die Familie selbst(FN 120).
Der Werth der Arbeitskraft war bestimmt nicht nur durch
die zur Erhaltung des individuellen erwachsnen Arbeiters, sondern durch die zur Erhaltung der Arbeitsfamilie nöthige Arbeitszeit. Indem die Maschinerie alle Glieder der Arbeiterfamilie auf den Arbeitsmarkt wirft, vertheilt sie den Werth der Arbeitskraft des Mannes über seine ganze Familie. Sie entwerthet daher seine Arbeitskraft. Der Ankauf der in 4 Arbeitskräfte z. B. parcellirten Familie kostet vielleicht mehr als früher der Ankauf der Arbeitskraft des Familienhaupts, aber dafür treten 4 Arbeitstage an die Stelle von Einem, und ihr Preis fällt im Verhältniss zum Ueberschuss der Mehrarbeit der Vier über die Mehrarbeit des Einen. Vier müssen nun nicht nur Arbeit, sondern Mehrarbeit für das Kapital liefern, damit eine Familie lebe. So erweitert die Maschinerie von vorn herein mit dem menschlichen Exploitationsmaterial, dem eigensten Ausbeutungsfeld des Kapitals(FN 121), zugleich den Exploitationsgrad.
Sie revolutionirt eben so von Grund aus die formelle Vermittlung des Kapitalverhältnisses, den Kontrakt zwischen Arbeiter und Kapitalist. Auf Grundlage des Waarenaustausches war es erste Voraussetzung, dass sich Kapitalist und Arbeiter als freie Personen, als unabhängige Waarenbesitzer, der eine Besitzer von Geld und Produktionsmitteln, der andre Besitzer von Arbeitskraft, gegenübertraten. Aber jetzt kauft das Kapital Unmündige oder Halbmündige. Der Arbeiter verkaufte früher seine eigne
Arbeitskraft, worüber er als formell freie Person verfügte. Er verkauft jetzt Weib und Kind. Er wird Sklavenhändler(FN 122). Die Nachfrage nach Kinderarbeit gleicht oft auch in der Form der Nachfrage nach Negersklaven, wie man sie in amerikanischen Zeitungsinseraten zu lesen gewohnt war. „Meine Aufmerksamkeit“, sagt z. B. ein englischer Fabrikinspektor, „wurde gelenkt auf eine Annonce in dem Lokalblatt einer der bedeutendsten Manufakturstädte meines Distrikts, wovon Folgendes die Kopie: Gebraucht 12 bis 20 Jungen, nicht jünger als was für 13 Jahre passiren kann. Lohn 4 sh. per Woche. Anzufragen etc.“(FN 123) Der unterstrichne Passus bezieht sich darauf, dass nach dem Factory Act Kinder unter 13 Jahren nur 6 Stunden arbeiten dürfen. Ein amtlich qualificirter Arzt (certifying surgeon) muss das Alter bescheinigen. Der Fabrikant verlangt also Jungen, die so aussehn, als ob sie schon dreizehnjährig. Die manchmal sprungweise Abnahme in der Anzahl der von Fabrikanten beschäftigten Kinder unter 13 Jahren, überraschend in der englischen Statistik der letzten 20 Jahre, war, nach Aussage der Fabrikinspektoren selbst, grossentheils das Werk von certifying surgeons, welche das Kindesalter der Exploitationslust der Kapitalisten und dem Schacherbedürfniss der Eltern gemäss verschoben. In dem berüchtigten Londoner Distrikt von Bethnal Green wird jeden Montag und Dien-
stag Morgen offner Markt gehalten, worin Kinder beiderlei Geschlechts vom 9. Jahre an sich selbst an die Londoner Seidenmanufakturen vermiethen. „Die gewöhnlichen Bedingungen sind 1 sh. 8 d. die Woche (die den Eltern gehören) und 2 d. für mich selbst nebst Thee.“ Die Kontrakte gelten nur für die Woche. Die Scenen und die Sprache während der Dauer dieses Markts sind wahrhaft empörend(FN 124). Es kömmt immer noch in England vor, dass Weiber „Jungen vom Workhouse nehmen und sie jedem beliebigen Käufer für 2 sh. 6 d. wöchentlich vermiethen“(FN 125). Trotz der Gesetzgebung werden immer noch mindestens 2000 Jungen in Grossbritannien als lebendige Schornsteinfegmaschinen (obgleich Maschinen zu ihrem Ersatz existiren) von ihren eigenen Eltern verkauft(FN 126). Die von der Maschinerie bewirkte Revolution im Rechtsverhältniss zwischen Käufer und Verkäufer der Arbeitskraft, so dass die ganze Transaktion selbst den Schein eines Kontrakts zwischen freien Personen verliert, bot dem englischen Parlament später den juristischen Entschuldigungsgrund für Staatseinmischung in das Fabrikwesen. So oft das Fabrikgesetz die Kinderarbeit in bisher unangefochtnen Industriezweigen auf 6 Stunden beschränkt, ertönt stets neu der Fabrikantenjammer: ein Theil der Eltern entziehe die Kinder nun der gemassregelten Industrie, um sie in solche zu verkaufen, wo noch „ Freiheit der Arbeit“ herrscht, d. h. wo Kinder unter 13 Jahren gezwungen werden wie Erwachsene zu arbeiten, also auch theurer loszuschlagen sind. Da aber das Kapital von Natur ein leveller ist, d. h. in allen Produktionssphären Gleichheit der Exploitationsbedingungen der Arbeit als sein angebornes Menschenrecht verlangt, wird die legale Beschränkung der Kinderarbeit in einem Industriezweig Ursache ihrer Beschränkung in dem andern.
Bereits früher wurde der physische Verderb der Kinder und jungen Personen angedeutet, wie der Arbeiterweiber, welche die Maschinerie erst direkt, in den auf ihrer Grundlage aufschiessenden Fabriken,
und dann indirekt in allen übrigen Industriezweigen der Exploitation des Kapitals unterwirft. Hier verweilen wir daher nur bei einem Punkt, der ungeheuren Sterblichkeit von Arbeiterkindern in ihren ersten Lebensjahren. In England giebt es 16 Registrations-Distrikte, wo im jährlichen Durchschnitt auf 100,000 lebende Kinder unter einem Jahr nur 9000 Todesfälle (in einem Distrikt nur 7,047) kommen, in 24 Distrikten über 10,000, aber unter 11,000, in 39 Distrikten über 11,000, aber unter 12,000, in 48 Distrikten über 12,000, aber unter 13,000, in 22 Distrikten über 20,000, in 25 Distrikten über 21,000, in 17 über 22,000, in 11 über 23,000, in Hoo, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne und Preston über 24,000, in Nottingham, Stockport und Bradford über 25,000, in Wisbeach 26,000, und in Manchester 26,125(FN 127). Wie eine officielle ärztliche Untersuchung im Jahre 1861 nachwies, sind, von Lokalumständen abgesehn, die hohen Sterblichkeitsraten vorzugsweise der ausserhäuslichen Beschäftigung der Mütter geschuldet und der daher entspringenden Vernachlässigung und Misshandlung der Kinder, u. a. unpassender Nahrung, Mangel an Nahrung, Fütterung mit Opiaten u. s. w., dazu die unnatürliche Entfremdung der Mütter gegen ihre Kinder, im Gefolge davon absichtliche Aushungerung und Vergiftung(FN 128). In solchen Agrikulturdistrikten, „wo ein Minimum weiblicher Beschäftigung existirt, ist dagegen die Sterblichkeitsrate am niedrigsten“(FN 129). Die Untersuchungskommission von 1861 ergab jedoch das unerwartete Resultat, dass in einigen an der Nordsee gelegnen rein ackerbauenden Distrikten die Sterblichkeitsrate von Kindern unter einem Jahr fast die der verrufensten Fabrikdistrikte erreicht. Dr. Julian Hunter wurde daher vom „Board of Health“ beauftragt, diess Phänomen an Ort und Stelle zu erforschen. Sein Bericht ist dem „VI. Report
of the Board of Health“ einverleibt(FN 130). Man hatte bisher vermuthet, Malaria und andre niedrig gelegnen und sumpfigen Landstrichen eigenthümliche Krankheiten decimirten die Kinder. Die Untersuchung ergab das grade Gegentheil, nämlich, „dass dieselbe Ursache, welche die Malaria vertrieb, nämlich die Verwandlung des Bodens aus Morast im Winter und dürftiger Weide im Sommer in fruchtbares Kornland, die ausserordentliche Todesrate der Säuglinge schuf“(FN 131). Die 70 ärztlichen Praktiker, die Dr. Hunter in jenen Distrikten verhörte, waren „wunderbar einstimmig“ über diesen Punkt. Mit der Revolution der Bodenkultur wurde nämlich das industrielle System eingeführt. „Verheirathete Weiber, die in Banden mit Mädchen und Jungen zusammenarbeiten, werden dem Pächter von einem Manne, welcher der „ Gangmeister“ heisst und die Banden im Ganzen miethet, für eine bestimmte Summe zur Verfügung gestellt. Diese Banden wandern oft viele Meilen von ihren Dörfern weg, man trifft sie Morgens und Abends auf den Landstrassen, die Weiber bekleidet mit kurzen Unterröcken und entsprechenden Röcken und Stiefeln und manchmal Hosen, sehr kräftig und gesund von Aussehn, aber verdorben durch gewohnheitsmässige Liederlichkeit und rücksichtslos gegen die unheilvollen Folgen, welche ihre Vorliebe für diese thätige und unabhängige Lebensart auf ihre Sprösslinge wälzt, die zu Haus verkümmern“(FN 132). Alle Phänomene der Fabrikdistrikte reproduciren sich hier, in noch höherem Grad versteckter Kindermord und Behandlung der Kinder mit Opiaten(FN 133). „Meine Kenntniss der von ihr erzeugten Uebel“, sagt Dr. Simon, der ärztliche Beamte des englischen Privy Council
und Redacteur en chef der Berichte des „ Board of Health“, „muss den tiefen Abscheu entschuldigen, womit ich jede umfassende industrielle Beschäftigung erwachsner Weiber betrachte“(FN 134). „Es wird“, ruft Fabrikinspektor R. Baker in einem officiellen Bericht aus, „es wird in der That ein Glück für die Manufakturdistrikte Englands sein, wenn jeder verheiratheten Frau, die Familie hat, verboten wird in irgend einer Fabrik zu arbeiten“(FN 135).
Die aus der kapitalistischen Exploitation der Weiberund Kinderarbeit entspringende moralische Verkümmerung ist von F. Engels in seiner „ Lage der arbeitenden Klassen Englands“ und von andern Schriftstellern so erschöpfend dargestellt worden, dass ich hier nur daran erinnere. Die intellektuelle Verödung aber, künstlich producirt durch die Verwandlung unreifer Menschen in blosse Maschinen zum Fabrikat von Mehrwerth, und sehr zu unterscheiden von jener naturwüchsigen Unwissenheit, welche den Geist in Brache legt ohne Verderb seiner Entwicklungsfähigkeit, seiner natürlichen Fruchtbarkeit selbst, zwang endlich sogar das englische Parlament in allen dem Fabrikgesetz unterworfenen Industrien den Elementarunterricht zur gesetzlichen Bedingung für den „produktiven“ Verbrauch von Kindern unter 14 Jahren zu machen. Der Geist der kapitalistischen Produktion leuchtet hell aus der liederlichen Redaktion der s. g. Erziehungsklauseln der Fabrikakte, aus dem Mangel administrativer Maschinerie, wodurch dieser Zwangsunterricht grossentheils wieder illusorisch wird, aus der Fabrikantenopposition selbst gegen diess Unterrichtsgesetz und ihren praktischen Kniffen und Schlichen zu seiner Umgehung. „Die Gesetzgebung allein ist zu tadeln, weil sie ein Truggesetz (delusive law) erlassen hat, das unter dem Schein für die Erziehung der Kinder zu sorgen, keine einzige Bestimmung enthält, wodurch dieser vorgeschützte Zweck gesichert werden kann. Es bestimmt nichts, ausser dass die Kinder für eine bestimmte Stundenzahl (3 Stunden) per Tag innerhalb der vier Wände eines Platzes, Schule benamst, eingeschlossen werden sollen, und dass der Anwender des Kindes hierüber wöchentlich ein Certifikat von einer Person
erhalten muss, die sich als Schullehrer oder Schullehrerin mit ihrem Namen unterzeichnet“(FN 136). Vor dem Erlass des amendirten Fabrikakts von 1844 waren Schulbesuchscertifikate nicht selten, die von Schulmeister oder Schulmeisterin mit einem Kreuz unterzeichnet wurden, da letztre selbst nicht schreiben konnten. „Beim Besuch, den ich einer solchen Certifikate ausstellenden Schule abstattete, war ich so betroffen von der Unwissenheit des Schulmeisters, dass ich zu ihm sagte: ‘Bitte, mein Herr, können Sie lesen?‘ Seine Antwort war: ‘Ih jeh, Ebbes (summat)‘. Zu seiner Rechtfertigung fügte er hinzu: ‘Jedenfalls stehe ich vor meinen Schülern‘. Während der Vorbereitung des Akts von 1844 denuncirten die Fabrikinspektoren den schmählichen Zustand der Plätze, Schulen benamst, deren Certifikate sie als zu Gesetz vollgültig zulassen mussten. Alles was sie durchsetzten, war, dass seit 1844 die Zahlen im Schulcertifikat in der Handschrift des Schulmeisters ausgefüllt, ditto sein Vorund Zuname von ihm selbst unterschrieben sein müssen“(FN 137). Sir John Kincaid, Fabrikinspektor für Schottland, erzählt von ähnlichen amtlichen Erfahrungen. „Die erste Schule, die wir besuchten, wurde von einer Mrs. Ann Killin gehalten. Auf meine Aufforderung, ihren Namen zu buchstabiren, machte sie gleich einen Schnitzer, indem sie mit dem Buchstaben C begann, aber sich sofort korrigirend sagte, ihr Name fange mit K an. Bei Ansicht ihrer Unterschrift in den Schulcertifikatbüchern bemerkte ich jedoch, dass sie ihn verschiedenartig buchstabirte, während die Handschrift keinen Zweifel über ihre Lehrunfähigkeit liess. Auch gab sie selbst zu, sie könne das Register nicht führen … In einer zweiten Schule fand ich das Schulzimmer 15 Fuss lang und 10 Fuss breit und zählte in diesem Raum 75 Kinder, die etwas unverständliches herquiekten“(FN 138). „Es sind jedoch nicht nur solche Jammerhöhlen, worin die Kinder Schulcertifikate, aber keinen Unterricht erhalten, denn in vielen Schulen, wo der Lehrer kompetent ist, scheitern seine Bemühungen fast ganz an dem sinnverwirrenden Knäuel
von Kindern aller Alter, aufwärts von Dreijährigen. Sein Auskommen, elend im besten Fall, hängt ganz von der Zahl der Pence ab, empfangen von der grössten Anzahl Kinder, die es möglich ist in ein Zimmer zu stopfen. Dazu kommt spärliche Schulmöblirung, Mangel an Büchern und andrem Lehrmaterial, und die niederschlagende Wirkung einer benauten und ekelhaften Luft auf die armen Kinder selbst. Ich war in vielen solchen Schulen, wo ich ganze Reihen Kinder sah, die absolut nichts thaten; und diess wird als Schulbesuch bescheinigt, und solche Kinder figuriren in der officiellen Statistik als erzogen (educated)“(FN 139). In Schottland suchen die Fabrikanten dem Schulbesuch unterworfne Kinder möglichst auszuschliessen. „Diess genügt, um die grosse Missgunst der Fabrikanten gegen die Erziehungsklauseln zu beweisen“(FN 140). Grotesk-entsetzlich erscheint diess in den Kattun- u. s. w. Druckereien, die durch ein eignes Fabrikgesetz geregelt sind. Nach den Bestimmungen des Gesetzes „muss jedes Kind, bevor es in einer solchen Druckerei beschäftigt wird, Schule besucht haben für mindestens 30 Tage und nicht weniger als 150 Stunden während der 6 Monate, die dem ersten Tag seiner Beschäftigung unmittelbar vorhergehn. Während der Fortdauer seiner Beschäftigung in der Druckerei muss es Schule besuchen ebenfalls für eine Periode von 30 Tagen und 150 Stunden während jeder Wechselperiode von 6 Monaten … Der Schulbesuch muss zwischen 8 Uhr Morgens und 6 Uhr Nachmittags stattfinden. Kein Besuch von weniger als 2½ oder mehr als 5 Stunden an demselben Tag soll als Theil der 150 Stunden gezählt werden. Unter gewöhnlichen Umständen besuchen die Kinder die Schule Vormittags und Nachmittags für 30 Tage, 5 Stunden per Tag, und nach Ablauf der 30 Tage, wenn die statutenmässige Gesammtsumme von 150 Stunden erreicht ist, wenn sie, in ihrer eignen Sprache zu reden, ihr Buch abgemacht haben, kehren sie zur Druckerei zurück, wo sie wieder 6 Monate bleiben, bis ein andrer Abschlagstermin des Schulbesuchs fällig wird, und dann bleiben sie wieder in der Schule, bis das Buch wieder abgemacht ist . . . . Sehr viele Jungen, welche die Schule während der vorschriftsmässigen 150 Stunden besucht,
sind bei ihrer Rückkehr aus dem sechsmonatlichen Aufenthalt in der Druckerei grade so weit wie im Anfang … Sie haben natürlich alles wieder verloren, was sie durch den früheren Schulbesuch gewonnen hatten. In andern Kattundruckereien wird der Schulbesuch ganz und gar abhängig gemacht von den Geschäftsbedürfnissen der Fabrik. Die erforderliche Stundenzahl wird vollgemacht während jeder sechsmonatlichen Periode durch Abschlagszahlungen von 3 bis 5 Stunden auf einmal, die vielleicht über 6 Monate zerstreut sind. Z. B. an einem Tage wird die Schule besucht von 8 bis 11 Uhr Morgens, an einem andern Tag von 1 bis 4 Uhr Nachmittags, und nachdem das Kind dann wieder für eine Reihe Tage weggeblieben, kömmt es plötzlich wieder von 3 bis 6 Uhr Nachmittags; dann erscheint es vielleicht für 3 oder 4 Tage hinter einander, oder für eine Woche, verschwindet dann wieder für 3 Wochen oder einen ganzen Monat und kehrt zurück an einigen Abfallstagen für einige Sparstunden, wenn seine Anwender seiner zufällig nicht bedürfen; und so wird das Kind so zu sagen hin und her gepufft (buffeted) von der Schule in die Fabrik, von der Fabrik in die Schule, bis die Summe der 150 Stunden abgezählt ist“(FN 141).
Durch den überwiegenden Zusatz von Kindern und Weibern zum kombinirten Arbeitspersonal bricht die Maschinerie endlich den Widerstand, den der männliche Arbeiter in der Manufaktur der Despotie des Kapitals noch entgegensetzte(FN 142).
Wenn die Maschinerie das gewaltigste Mittel ist, die Produktivität der
Arbeit zu steigern, d. h. die zur Produktion einer Waare nöthige Arbeitszeit zu verkürzen, wird sie als Träger des Kapitals, zunächst in den unmittelbar von ihr ergriffenen Industrien, zum gewaltigsten Mittel den Arbeitstag über jede naturgemässe Schranke hinaus zu verlängern. Sie schafft einerseits neue Bedingungen, welche das Kapital befähigen, dieser seiner beständigen Tendenz die Zügel frei schiessen zu lassen, andrerseits neue Motive zur Wetzung seines Heisshungers nach fremder Arbeit.
Zunächst verselbstständigt sich in der Maschinerie die Bewegung und Werkthätigkeit des Arbeitsmittels gegenüber dem Arbeiter. Es wird an und für sich ein industrielles Perpetuum mobile, das ununterbrochen fortproduciren würde, stiesse es nicht auf gewisse Naturschranken in seinen menschlichen Gehilfen, ihre Körperschwäche und ihren Eigenwillen. Als Kapital, und als solches besitzt der Automat im Kapitalisten Bewusstsein und Willen, ist es daher mit dem Trieb begeistet, die widerstrebende, aber elastische menschliche Naturschranke auf den Minimalwiderstand einzuzwängen(FN 143). Dieser ist ohnehin vermindert durch die scheinbare Leichtigkeit der Arbeit an der Maschine und das fügund biegsamere Weiberund Kinderelement(FN 144).
Die Produktivität der Maschinerie steht, wie wir sahen, in umgekehr-
tem Verhältniss zur Grösse des von ihr auf das Machwerk übertragenen Werthbestandtheils. Je länger die Periode, worin sie funktionirt, desto grösser die Produktenmasse, worüber sich der von ihr zugesetzte Werth vertheilt, und desto kleiner der Werththeil, den sie der einzelnen Waare zufügt. Die aktive Lebensperiode der Maschinerie ist aber offenbar bestimmt durch die Länge des Arbeitstags oder die Dauer des täglichen Arbeitsprozesses, multiplicirt mit der Anzahl Tage, worin er sich wiederholt.
Der Maschinenverschleiss entspricht keineswegs exakt mathematisch ihrer Benutzungszeit. Und selbst diess vorausgesetzt, umfasst eine Maschine, die während 7½ Jahren täglich 16 Stunden dient, eine ebenso grosse Produktionsperiode und setzt dem Gesammtprodukt nicht mehr Werth zu als dieselbe Maschine, die während 15 Jahren nur 8 Stunden täglich dient. Im erstern Fall aber wäre der Maschinenwerth doppelt so rasch reproducirt als im letztern und der Kapitalist hätte vermittelst derselben in 7½ Jahren so viel Mehrarbeit eingeschluckt als sonst in 15.
Der materielle Verschleiss der Maschine ist doppelt. Der eine entspringt aus ihrem Gebrauch, wie Geldstücke durch Cirkulation verschleissen, der andre aus ihrem Nichtgebrauch, wie ein unthätig Schwert in der Scheide verrostet. Es ist diess ihr Verzehr durch die Elemente. Der Verschleiss erster Art steht mehr oder minder in direktem Verhältniss, der letztere, zu gewissem Grad, in umgekehrtem Verhältniss zu ihrem Gebrauch(FN 145).
Neben dem materiellen unterliegt die Maschine aber auch einem so zu sagen moralischen Verschleiss. Sie verliert Tauschwerth im
Masse, worin entweder Maschinen derselben Konstruktion wohlfeiler reproducirt werden können oder bessere Maschinen konkurrirend neben sie treten(FN 146). In beiden Fällen ist ihr Werth, so jung und lebenskräftig sie sonst noch sein mag, nicht mehr bestimmt durch die thatsächlich in ihr selbst vergegenständlichte, sondern durch die zu ihrer eignen Reproduktion oder zur Reproduktion der besseren Maschine nothwendige Arbeitszeit. Sie ist daher mehr oder minder entwerthet. Je kürzer die Periode, worin ihr Gesammtwerth reproducirt wird, desto geringer die Gefahr des moralischen Verschleisses, und je länger der Arbeitstag, um so kürzer jene Periode. Bei der ersten Einführung der Maschinerie in irgend einen Produktionszweig folgen Schlag auf Schlag neue Methoden zu ihrer wohlfeileren Reproduktion(FN 147), und Verbesserungen, die nicht nur einzelne Theile oder Apparate, sondern ihre ganze Konstruktion ergreifen. In ihrer ersten Lebensperiode wirkt daher diess besondre Motiv zur Verlängerung des Arbeitstags am akutesten(FN 148).
Unter sonst gleichbleibenden Umständen und bei gegebnem Arbeitstag erheischt Exploitation verdoppelter Arbeiteranzahl ebensowohl Verdopplung des in Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegten Theils des constanten Kapitals als des in Rohmaterial, Hilfsstoffen u. s. w. ausgelegten. Mit verlängertem Arbeitstag dehnt sich die Stufenleiter der Produktion, während der in Maschinerie und Baulichkeiten ausgelegte Kapi-
taltheil unverändert bleibt(FN 149). Nicht nur der Mehrwerth wächst daher, sondern die zur Erbeutung desselben nothwendigen Auslagen nehmen ab. Zwar findet diess auch sonst mehr oder minder bei aller Verlängerung des Arbeitstags statt, fällt aber hier entscheidender ins Gewicht, weil der in Arbeitsmittel verwandelte Kapitaltheil überhaupt mehr ins Gewicht fällt(FN 150). Die Entwicklung des Maschinenbetriebs bindet nämlich einen stets wachsenden Bestandtheil des Kapitals in eine Form, worin es einerseits fortwährend verwerthbar ist, andrerseits Gebrauchswerth und Tauschwerth verliert, sobald sein Kontakt mit der lebendigen Arbeit unterbrochen wird. „Wenn“, belehrte Herr Ashworth, ein englischer Baumwollmagnat, den Professor Nassau W. Senior, „wenn ein Ackersmann seinen Spaten niederlegt, macht er für diese Periode ein Kapital von 18 d. nutzlos. Wenn einer von unsern Leuten (d. h. den Fabrikarbeitern) die Fabrik verlässt, macht er ein Kapital nutzlos, das 100000 Pfd. St. gekostet hat“(FN 151). Man denke nur! Ein Kapital, das 100000 Pfd. St. gekostet hat, auch nur für einen Augenblick „ nutzlos“ zu machen! Es ist in der That himmelschreiend, dass einer unsrer Leute überhaupt jemals die Fabrik verlässt! Der wachsende Umfang der Maschinerie macht, wie der von Ashworth belehrte Senior einsieht, eine stets wachsende Verlängerung des Arbeitstags „wünschenswerth“(FN 152).
Die Maschine producirt relativen Mehrwerth, nicht nur indem sie die Arbeitskraft direkt entwerthet und dieselbe indirekt durch Verwohlfeilerung der in ihre Reproduktion eingehenden Waaren verwohlfeilert, sondern auch, indem sie bei ihrer ersten sporadischen Einführung die vom Maschinenbesitzer verwandte Arbeit in potenzirte Arbeit verwandelt, den gesellschaftlichen Werth des Maschinenprodukts über seinen individuellen Werth erhöht und den Kapitalisten so befähigt mit geringerem Werththeil des Tagesprodukts den Tageswerth der Arbeitskraft zu ersetzen. Während dieser Uebergangsperiode, worin der Maschinenbetrieb eine Art Monopol bleibt, sind daher die Gewinne ausserordentlich und der Kapitalist sucht „diese erste Zeit der jungen Liebe“ gründlichst auszubeuten durch möglichste Verlängerung des Arbeitstags. Die Grösse des Gewinns wetzt den Heisshunger nach mehr Gewinn.
Mit der Verallgemeinerung der Maschinerie im selben Produktionszweig sinkt der gesellschaftliche Werth des Maschinenprodukts auf seinen individuellen Werth und macht sich das Gesetz geltend, dass der Mehrwerth nicht aus den Arbeitskräften entspringt, welche der Kapitalist durch die Maschine ersetzt hat, sondern umgekehrt aus den Arbeitskräften, welche er an ihr beschäftigt. Der Mehrwerth entspringt nur aus dem variablen Theil des Kapitals, und wir sahen, dass die Masse des Mehrwerths durch zwei Faktoren bestimmt ist, die Rate des Mehrwerths und die Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter. Bei gegebner Länge des Arbeitstags wird die Rate des Mehrwerths bestimmt durch das Verhältniss, worin der Arbeitstag in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit zerfällt. Die Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter hängt ihrerseits ab von dem Verhältniss des variablen Kapitaltheils zum constanten. Es ist nun klar, dass wie er immer durch Steigerung der Produktivkraft der Arbeit die Mehrarbeit auf Kosten der
nothwendigen Arbeit ausdehne, der Maschinenbetrieb diess Resultat nur hervorbringt, indem er die Anzahl der von einem gegebnen Kapital beschäftigten Arbeiter vermindert. Er verwandelt einen Theil des Kapitals, der früher variabel war, d. h. sich in lebendige Arbeitskraft umsetzte, in Maschinerie, also in constantes Kapital, das keinen Mehrwerth producirt. Es ist unmöglich z. B. aus zwei Arbeitern so viel Mehrwerth auszupressen als aus 24. Wenn jeder der 24 Arbeiter auf 12 Stunden nur eine Stunde Mehrarbeit liefert, liefern sie zusammen 24 Stunden Mehrarbeit, während die Gesammtarbeit der zwei Arbeiter nur 24 Stunden beträgt. Es liegt also in der Anwendung der Maschinerie zur Produktion von Mehrwerth ein immanenter Widerspruch, indem sie von den beiden Faktoren des Mehrwerths, den ein Kapital von gegebner Grösse liefert, den einen Faktor, die Rate des Mehrwerths, nur dadurch vergrössert, dass sie den andern Faktor, die Arbeiterzahl, verkleinert. Dieser immanente Widerspruch tritt hervor, sobald mit der Verallgemeinerung der Maschinerie in einem Industriezweig der Werth der maschinenmässig producirten Waare zum regelnden gesellschaftlichen Werth aller Waaren derselben Art wird, und es ist dieser Widerspruch, der wiederum das Kapital, ohne dass es sich dessen bewusst wäre(FN 153), zur gewaltsamsten Verlängerung des Arbeitstags treibt, um die Abnahme in der verhältnissmässigen Anzahl der exploitirten Arbeiter durch Zunahme nicht nur der relativen, sondern auch der absoluten Mehrarbeit zu kompensiren.
Wenn also die kapitalistische Anwendung der Maschinerie einerseits neue mächtige Motive zur masslosen Verlängerung des Arbeitstags schafft und die Arbeitsweise selbst wie den Charakter des gesellschaftlichen Arbeitskörpers in einer Art umwälzt, die den Widerstand gegen diese Tendenz bricht, producirt sie andrerseits, theils durch Einrollirung dem Kapital früher unzugänglicher Schichten der Arbeiterklasse, theils durch Freisetzung der von der Maschine verdrängten Arbeiter, eine
überflüssige Arbeiterpopulation(FN 154), die sich das Gesetz vom Kapital diktiren lassen muss. Daher das merkwürdige Phänomen in der Geschichte der modernen Industrie, dass die Maschine alle sittlichen und natürlichen Schranken des Arbeitstags über den Haufen wirft. Daher das ökonomische Paradoxon, dass das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der Arbeitszeit in das unfehlbarste Mittel umschlägt alle Lebenszeit des Arbeiters und seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwerthung des Kapitals zu verwandeln. „Wenn“, träumte Aristoteles, der grösste Denker des Alterthums, „wenn jedes Werkzeug auf Geheiss, oder auch vorausahnend, das ihm zukommende Werk verrichten könnte, wie des Dädalus Kunstwerke sich von selbst bewegten, oder die Dreifüsse des Hephästos aus eignem Antrieb an die heilige Arbeit gingen, wenn so die Weberschiffe von selbst webten, so bedürfte es weder für den Werkmeister der Gehilfen, noch für die Herrn der Sklaven“(FN 155). Und Antiparos, ein griechischer Dichter aus der Zeit des Cicero, begrüsste die Erfindung der Wassermühle zum Mahlen des Getreides, diese Elementarform aller produktiven Maschinerie, als Befreierin der Sklavinnen und Herstellerin des goldnen Zeitalters!(FN 156) „Die Heiden, ja die Heiden!“ Sie begriffen, wie der gescheidte Bastiat entdeckt hat, und schon vor ihm der noch klügere Mac Culloch, nichts
von politischer Oekonomie und Christent um. Sie begriffen u. a. nicht, dass die Maschine das probateste Mittel zur Verlängerung des Arbeitstags ist. Sie entschuldigten etwa die Sklaverei des Einen als Mittel zur vollen menschlichen Entwicklung des Andern. Aber Sklaverei der Massen predigen, um einige rohe oder halbgebildete Parvenüs zu „eminent spinners“, „extensive sausage makers“ und „influential shoe black dealers“ zu machen, dazu fehlte ihnen das specifisch christliche Organ.
Die masslose Verlängerung des Arbeitstags, welche die Maschinerie in der Hand des Kapitals producirt, führt, wie wir sahen, später eine Reaktion der in ihrer Lebenswurzel bedrohten Gesellschaft herbei, und damit einen gesetzlich beschränkten Normal-Arbeitstag. Auf Grundlage des letztern entwickelt sich ein Phänomen, das uns schon früher begegnete, zu entscheidender Wichtigkeit — nämlich die Intensifikation der Arbeit. Bei der Analyse des absoluten Mehrwerths handelte es sich zunächst um die extensive Grösse der Arbeit, während der Grad ihrer Intensivität als gegeben vorausgesetzt war. Wir haben jetzt den Umschlag dieser extensiven in eine intensive oder Gradgrösse zu betrachten.
Es ist selbstverständlich, dass mit dem Fortschritt des Maschinenwesens und der gehäuften Erfahrung einer eignen Klasse von Maschinenarbeitern die Geschwindigkeit und damit die Intensivität der Arbeit naturwüchsig zunehmen. So geht in England während eines halben Jahrhunderts die Verlängerung des Arbeitstags Hand in Hand mit der wachsenden Intensivität der Fabrikarbeit. Indess begreift man, dass bei einer Arbeit, wo es sich nicht um vorübergehende Paroxysmen handelt, sondern um Tag aus, Tag ein wiederholte, regelmässige Gleichförmigkeit, ein Knotenpunkt eintreten muss, wo Ausdehnung des Arbeitstags und Intensivität der Arbeit einander ausschliessen, so dass die Verlängerung des Arbeitstags nur mit schwächerem Intensivitätsgrad der Arbeit und umgekehrt ein erhöhter Intensivitätsgrad nur mit Verkürzung des Arbeitstags verträglich bleibt. Sobald die allmälig anschwellende Empörung der Arbeiterklasse den Staat zwang, die Arbeitszeit gewaltsam zu verkürzen und zunächst der eigentlichen Fabrik einen Normal-Arbeitstag zu diktiren, von diesem Augenblick also, wo gesteigerte Produktion von Mehrwerth durch Verlängerung des Arbeitstags ein für allemal abgeschnitten war, warf sich das Kapital mit aller Macht und vollem Bewusst-
sein auf die Produktion von relativem Mehrwerth durch beschleunigte Entwicklung des Maschinensystems. Gleichzeitig tritt eine Aenderung in dem Charakter des relativen Mehrwerths ein. Im Allgemeinen besteht die Produktionsmethode des relativen Mehrwerths darin, durch gesteigerte Produktivkraft der Arbeit den Arbeiter zu befähigen mit derselben Arbeitsausgabe in derselben Zeit mehr zu produciren. Dieselbe Arbeitszeit setzt nach wie vor dem Gesammtprodukt denselben Werth zu, obgleich dieser unveränderte Tauschwerth sich jetzt in mehr Gebrauchswerthen darstellt und daher der Werth der einzelnen Waare sinkt. Anders jedoch, sobald die gewaltsame Verkürzung des Arbeitstags mit dem ungeheuren Anstoss, den sie der Entwicklung der Produktivkraft und der Oekonomisirung der Produktionsbedingungen giebt, zugleich vergrösserte Arbeitsausgabe in derselben Zeit, erhöhte Anspannung der Arbeitskraft, dichtere Ausfüllung der Poren der Arbeitszeit, d. h. Kondensation der Arbeit dem Arbeiter zu einem Grad aufzwingt, der nur innerhalb des verkürzten Arbeitstags erreichbar ist. Diese Zusammenpressung einer grösseren Masse Arbeit in eine gegebene Zeitperiode zählt jetzt als was sie ist, als grösseres Arbeitsquantum. Neben das Mass der Arbeitszeit als „ausgedehnter Grösse“ tritt jetzt das Mass ihres Verdichtungsgrads(FN 157). Die intensivere Stunde des zehnstündigen Arbeitstags enthält jetzt so viel oder mehr Arbeit, d. h. verausgabte Arbeitskraft als die porösere Stunde des zwölfstündigen Arbeitstags. Ihr Produkt hat daher so viel oder mehr Werth als das der poröseren 1⅕ Stunden. Abgesehn von der Erhöhung des relativen Mehrwerths durch die gesteigerte Produktivkraft der Arbeit, liefern jetzt z. B. 3⅓ Stunden Mehrarbeit auf 6⅔ Stunden nothwendiger Arbeit dem Kapitalisten dieselbe Werthmasse wie vorher 4 Stunden Mehrarbeit auf 8 Stunden nothwendiger Arbeit.
Es fragt sich nun, wie wird die Arbeit intensificirt?
Die erste Wirkung des verkürzten Arbeitstags beruht auf dem selbstverständlichen Gesetz, dass die Wirkungsfähigkeit der Arbeitskraft im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Wirkungszeit steht. Es wird daher, innerhalb gewisser Grenzen, am Grad der Kraftäusserung gewonnen, was an ihrer Dauer verloren geht. Dass der Arbeiter aber auch wirklich mehr Arbeitskraft flüssig macht, dafür sorgt das Kapital durch die Methode der Zahlung(FN 158). In Manufakturen, der Töpferei z. B., wo die Maschinerie keine oder unbedeutende Rolle spielt, hat die Einführung des Fabrikgesetzes schlagend bewiesen, dass blosse Verkürzung des Arbeitstags die Regelmässigkeit, Gleichförmigkeit, Ordnung, Kontinuität und Energie der Arbeit wundervoll erhöht(FN 159). Diese Wirkung schien jedoch zweifelhaft in der eigentlichen Fabrik, weil die Abhängigkeit des Arbeiters von der kontinuirlichen und gleichförmigen Bewegung der Maschine hier längst die strengste Disciplin geschaffen hatte. Als daher 1844 die Herabsetzung des Arbeitstags unter 12 Stunden verhandelt ward, erklärten die Fabrikanten fast einstimmig, „ihre Aufseher passten in den verschiednen Arbeitsräumen auf, dass die Hände keine Zeit verlören“, „der Grad der Wachsamkeit und Aufmerksamkeit auf Seiten der Arbeiter („the extent of vigilance and attention on the part of the workmen“) sei kaum steigerungsfähig“, und alle anderen Umstände, wie Gang der Maschinerie u. s. w. als gleichbleibend vorausgesetzt, „sei es daher Unsinn in wohlgeführten Fabriken von der gesteigerten Aufmerksamkeit u. s. w. der Arbeiter irgend ein erkleckliches Resultat zu erwarten“(FN 160). Diese Behauptung ward durch Experimente widerlegt. Herr R. Gardner liess in seinen zwei grossen Fabriken zu Preston vom 20. April 1844 an statt 12 nur noch 11 Stunden per Tag arbeiten. Nach ungefähr Jahresfrist ergab sich das Resultat, dass „dasselbe Quantum Produkt zur selben Kost erhalten ward, und sämmtliche Arbeiter in 11 Stunden eben so viel Arbeitslohn verdienten,
wie früher in 12“(FN 161). Ich übergehe hier die Experimente in den Spinnund Kardirräumen, weil sie mit Zunahme in der Geschwindigkeit der Maschinerie (um 2 %) verbunden waren. In dem Webedepartement dagegen, wo zudem sehr verschiedene Sorten leichter, figurenhaltiger Phantasieartikel gewebt wurden, fand durchaus keine Aenderung in den objektiven Produktionsbedingungen statt. Das Resultat war: „Vom 6. Januar bis 20. April 1844, mit zwölfstündigem Arbeitstag, wöchentlicher Durchschnittslohn jedes Arbeiters 10 sh. 1½ d., vom 20. April bis 29. Juni 1844, mit elfstündigem Arbeitstag, wöchentlicher Durchschnittslohn 10 sh. 3½ d.“(FN 162). Es wurde hier in 11 Stunden mehr producirt als früher in 12, ausschliesslich in Folge grösserer gleichmässiger Ausdauer der Arbeiter und Oekonomie ihrer Zeit. Während sie denselben Lohn empfingen und 1 Stunde freie Zeit gewannen, erhielt der Kapitalist dieselbe Produktenmasse und sparte Verausgabung von Kohle, Gas u. s. w. für eine Stunde. Aehnliche Experimente wurden mit gleichem Erfolg in den Fabriken der Herren Horrocks und Jacson ausgeführt(FN 163).
Sobald die Verkürzung des Arbeitstags, welche zunächst die subjektive Bedingung der Kondensation der Arbeit schafft, nämlich die Fähigkeit des Arbeiters mehr Kraft in gegebner Zeit flüssig zu machen, zwangsgesetzlich wird, wandelt sich die Maschine in der Hand des Kapitals zum objektiven und systematisch angewandten Mittel mehr Arbeit in derselben Zeit zu erpressen. Es geschieht diess in doppelter Weise, durch die erhöhte Geschwindigkeit der Maschinen und den erweiterten Umfang der von demselben Arbeiter zu überwachenden Maschinerie oder seines Arbeitsfeldes. Verbesserte Konstruktion der Maschinerie ist theils nothwendig zur Ausübung des grösseren Drucks auf den Arbeiter, theils begleitet sie von selbst die Inten-
sifikation der Arbeit, weil die Schranke des Arbeitstags den Kapitalisten zu strengstem Haushalt der Produktionskosten zwingt. Die Verbesserung der Dampfmaschine erhöht die Anzahl ihrer Kolbenschläge in einer Minute und erlaubt zugleich, durch grössere Oekonomie der Kraft, einen umfangreicheren Mechanismus mit demselben Motor zu treiben, bei gleichbleibendem oder selbst fallendem Kohlenverzehr. Die Verbesserung des Transmissionsmechanismus vermindert die Friktion und, was die moderne Maschinerie so augenfällig vor der älteren auszeichnet, reducirt Durchmesser und Gewicht der grossen und kleinen Wellenbäume auf ein stets fallendes Minimum. Die Verbesserungen der Arbeitsmaschinerie endlich vermindern bei erhöhter Geschwindigkeit und ausgedehnterer Wirkung ihren Umfang, wie beim modernen Dampfwebstuhl, oder vergrössern mit dem Rumpf Umfang und Zahl der von ihr geführten Werkzeuge, wie bei der Spinnmaschine, oder vermehren die Beweglichkeit dieser Werkzeuge durch unscheinbare Detailveränderung, wie durch solche bei der selfacting mule vor etwa 10 Jahren die Geschwindigkeit der Spindeln um ⅕ gesteigert wurde.
Die Verkürzung des Arbeitstags auf 12 Stunden datirt in England von 1832. Schon 1836 erklärte ein englischer Fabrikant: „Verglichen mit früher ist die Arbeit, die in den Fabriken zu verrichten, sehr gewachsen, in Folge der grösseren Aufmerksamkeit und Thätigkeit, welche die bedeutend vermehrte Geschwindigkeit der Maschinerie vom Arbeiter erheischt“(FN 164). Im Jahr 1844 machte Lord Ashley, jetzt Graf Shaftesbury, folgende dokumentarisch belegte Aufstellungen im Hause der Gemeinen:
„Die Arbeit der in den Fabrikprozessen Beschäftigten ist jetzt dreimal so gross, als bei der Einführung solcher Operationen. Die Maschinerie hat zweifelsohne ein Werk verrichtet, welches die Sehnen und Muskeln von Millionen Menschen ersetzt, aber sie hat auch erstaunlich (prodigiously) die Arbeit der durch ihre furchtbare Bewegung beherrschten Menschen vermehrt. . . . Die Arbeit einem Paar Mules während 12 Stunden aufund abzufolgen, zum Spinnen von Garn No. 40, bedang im Jahre 1815 die Nothwendigkeit einer Reise von 8 Meilen. Im Jahre 1812 betrug die im Gefolge eines Mulepaars, zum Spinnen derselben Nummer, während 12 Stunden zu durchreisende Distanz 20 Meilen und oft mehr. Im Jahre 1825 hatte der Spinner während 12 Stunden 820 Auszüge an jeder Mule
zu machen, was eine Gesammtsumme von 1640 für 12 Stunden ergab. Im Jahre 1832 hatte der Spinner während seines zwölfstündigen Arbeitstags an jeder Mule 2,200 Auszüge zu machen, zusammen 4,400, im Jahre 1844 an jeder Mule 2,400, zusammen 4,800; und in einigen Fällen ist die erheischte Arbeitsmasse (amount of labour) noch grösser....Ich habe hier ein andres Dokument von 1842 in der Hand, worin nachgewiesen wird, dass die Arbeit progressiv zunimmt, nicht nur, weil eine grössere Entfernung zu durchreisen ist, sondern weil die Quantität der producirten Waaren sich vermehrt, während die Hände proportionell abnehmen; und ferner, weil nun oft eine schlechtere Baumwolle gesponnen wird, die mehr Arbeit erfordert. . . . Im Kardirraum hat auch grosse Zunahme der Arbeit stattgefunden. Eine Person thut jetzt die Arbeit, die früher zwischen zwei vertheilt war. . . . In der Weberei, worin eine grosse Anzahl Personen, meist weiblichen Geschlechts beschäftigt ist, ist die Arbeit während der letzten Jahre um volle 10 % gewachsen, in Folge der vermehrten Geschwindigkeit der Maschinerie. Im Jahre 1838 war die Zahl der hanks, die wöchentlich gesponnen wurde, 18,000, im Jahre 1843 belief sie sich auf 21,000. Im Jahr 1819 war die Zahl der picks beim Dampfwebestuhl 60 per Minute, im Jahre 1842 betrug sie 140, was einen grossen Zuwachs von Arbeit anzeigt“(FN 165).
Angesichts dieser merkwürdigen Intensivität, welche die Arbeit unter der Herrschaft des Zwölfstundengesetzes bereits 1844 erreicht hatte, schien damals die Erklärung der englischen Fabrikanten berechtigt: jeder weitere Fortschritt in dieser Richtung sei unmöglich, daher jede weitere Abnahme der Arbeitszeit identisch mit Abnahme der Produktion. Die scheinbare Richtigkeit ihres Raisonnements wird am besten bewiesen durch folgende gleichzeitige Aeusserung ihres rastlosen Censors, des Fabrikinspektors Leonhard Horner:
„Da die producirte Quantität hauptsächlich geregelt wird durch die Geschwindigkeit der Maschinerie, muss es das Interesse des Fabrikanten sein, sie mit dem äussersten Geschwindigkeitsgrad zu treiben, der mit folgenden Bedingungen vereinbar ist: Bewahrung der Maschinerie vor zu raschem Verderb, Erhaltung der Qualität des fabricirten Artikels, und Fähigkeit des Arbeiters der Bewegung zu folgen ohne grössere Anstren-
gung als er kontinuirlich leisten kann. Es ereignet sich oft, dass der Fabrikant in seiner Hast die Bewegung zu sehr beschleunigt. Brüche und schlechtes Machwerk wiegen dann die Geschwindigkeit mehr als auf und er ist gezwungen den Gang der Maschinerie zu mässigen. Ich schloss daher, da ein aktiver und einsichtsvoller Fabrikant das sichre Maximum ausfindet, dass es unmöglich ist in 11 Stunden so viel zu produciren als in 12. Ich nahm ausserdem an, dass der per Stücklohn bezahlte Arbeiter sich auf’s äusserste anstrengt, soweit er denselben Arbeitsgrad kontinuirlich aushalten kann“(FN 166). Horner schloss daher, trotz der Experimente von Gardner u. s. w., dass eine weitere Herabsetzung des Arbeitstags unter 12 Stunden die Quantität des Produkts vermindern müsse(FN 167). Er selbst citirt 10 Jahre später sein Bedenken von 1845 zum Beweis, wie wenig er damals noch die Elasticität der Maschinerie und der menschlichen Arbeitskraft, die beide gleichmässig durch die zwangsweise Verkürzung des Arbeitstags aufs Höchste gespannt werden, begriffen habe.
Kommen wir nun zur Periode nach 1847, seit Einführung des Zehnstundengesetzes in die englischen Baumwoll-, Woll-, Seidenund Flachsfabriken.
„Die Geschwindigkeit der Spindeln ist auf Throstles um 500, auf Mules um 1000 Drehungen in einer Minute gewachsen, d. h. die Geschwindigkeit der Throstlespindel, die 1839 4500 Drehungen in einer Minute zählte, beträgt nun (1862) 5000, und die der Mulespindel, die 5000 zählte, beträgt jetzt 6000 in der Minute; diess beläuft sich im ersten Fall auf ⅒ und im zweiten auf ⅕ zusätzlicher Geschwindigkeit“(FN 168). Jos. Nasmyth, der berühmte Civilingenieur von Paticroft, bei Manchester, setzte 1852 in einem Brief an Leonhard Horner die von 1848—1852 gemachten Verbesserungen in der Dampfmaschine auseinander. Nachdem er bemerkt, dass die Dampfpferdekraft, in der officiellen Fabrikstatistik fortwährend geschätzt nach ihrer Wirkung im Jahr 1828(FN 169), nur noch
nominell ist und nur als Index der wirklichen Kraft dienen kann, sagt er u. a.: „Es unterliegt keinem Zweifel, dass Dampfmaschinerie von demselben Gewicht, oft dieselben identischen Maschinen, an denen nur die modernen Verbesserungen angebracht sind, im Durchschnitt 50 % mehr Werk als früher verrichten, und dass in vielen Fällen dieselben identischen Dampfmaschinen, die in den Tagen der beschränkten Geschwindigkeit von 220 Fuss per Minute 50 Pferdekraft lieferten, heute, mit vermindertem Kohlenkonsum über 100 liefern. . . . Die moderne Dampfmaschine von derselben nominellen Pferdekraft wird mit viel grösserer Gewalt als früher getrieben, in Folge der Verbesserungen in ihrer Konstruktion, vermindertem Umfang und Bau der Dampfkessel u. s. w. … Obgleich daher dieselbe Händezahl wie früher im Verhältniss zur nominellen Pferdekraft beschäftigt wird, werden weniger Hände verwandt im Verhältniss zur Arbeitsmaschinerie“(FN 170). Im Jahr 1850 verwandten die Fabriken des Vereinigten Königreichs 134, 217 nominelle Pferdekraft zur Bewegung von 25,638,716 Spindeln und 301,495 Webstühlen. Im Jahr 1856 betrug die Zahl der Spindeln und Webstühle respective 33,503,580 und 369,205. Wäre die erheischte Pferdekraft dieselbe geblieben wie 1850, so waren 1856: 175,000 Pferdekraft nöthig. Sie betrug aber nach dem officiellen Ausweis nur 161,435, also über 10,000 Pferdekraft weniger, als wenn man nach der Basis von 1850 rechnet(FN 171). „Die durch den letzten Return von 1856 (officielle Statistik) festgestellten Thatsachen sind, dass das Fabriksystem reissend rasch um sich greift, die Zahl der Hände im Verhältniss zur Maschinerie abgenommen hat, die Dampfmaschine durch Oekonomie der Kraft und andre Methoden ein grösseres Maschinengewicht treibt, und ein vermehrtes Quantum Machwerk erzielt wird in Folge verbesserter Arbeitsmaschinen, veränderter Methoden der Fabrikation, erhöhter Geschwindigkeit der Ma-
schinerie und vieler andrer Ursachen“(FN 172). „Die grossen in Maschinen jeder Art eingeführten Verbesserungen haben deren Produktivkraft sehr gesteigert. Ohne allen Zweifel gab die Verkürzung des Arbeitstags … den Stachel zu diesen Verbesserungen. Letztere und die intensivere Anstrengung des Arbeiters bewirkten, dass wenigstens eben so viel Machwerk in dem (um zwei Stunden oder ⅙) verkürzten Arbeitstag als früher während des längeren geliefert wird“(FN 173).
Wie die Bereicherung der Fabrikanten mit der intensiveren Ausbeutung der Arbeitskraft zunahm, beweist schon der eine Umstand, dass das durchschnittliche proportionelle Wachsthum der englischen Baumwollenu. s. w.-Fabriken von 1838 bis 1850 32 %, von 1850 bis 1856 dagegen 86 % jährlich betrug.
So gross in den 8 Jahren 1848 bis 1856, unter der Herrschaft des zehnstündigen Arbeitstags, der Fortschritt der englischen Industrie, wurde er wieder weit überflügelt in der folgenden sechsjährigen Periode von 1856 bis 1862. In der Seidenfabrik z. B. 1856: Spindeln 1,093,799, 1862: 1,388,544; 1856: Webstühle 9,260 und 1862: 10,709. Dagegen 1856: Arbeiteranzahl 56,131 und 1862: 52,429. Diess ergiebt Zunahme der Spindelzahl 26.9 % und der Webstühle 15.6 % mit gleichzeitiger Abnahme der Arbeiteranzahl um 7 %. Im Jahre 1850 wurden in der Worsted-Fabrik angewandt 875,830 Spindeln, 1856: 1,324,549 (Zunahme von 51.2 %) und 1862: 1,289,172 (Abnahme von 2.7 %). Zählt man aber die Dublirspindeln ab, die in der Aufzählung für das Jahr 1856 figuriren, aber nicht für 1862, so blieb die Anzahl der Spindeln seit 1856 ziemlich stationär. Dagegen ward seit 1850 in vielen Fällen die Geschwindigkeit der Spindeln und Webstühle verdoppelt. Die Zahl der Dampfwebstühle in der Worsted-Fabrik 1850: 32,617, 1856: 38,956 und 1862: 43,048. Es waren dabei beschäftigt 1850: 79,737 Personen, 1856: 87,794 und 1862: 86,063, aber davon Kinder unter 14 Jahren 1850: 9,956, 1856: 11,228 und 1862: 13,178. Trotz sehr vermehrter Anzahl
der Webstühle, 1862 verglichen mit 1856, nahm also die Gesammtzahl der beschäftigten Arbeiter ab, die der exploitirten Kinder zu(FN 174).
Am 27. April 1863 erklärte das Parlamentsglied Ferrand im Unterhause: „Arbeiterdelegirte von 16 Distrikten von Lancashire und Cheshire, in deren Auftrag ich spreche, haben mir mitgetheilt, dass die Arbeit in den Fabriken in Folge der Verbesserung in der Maschinerie beständig wachse. Statt dass früher eine Person mit Gehilfen zwei Webstühle bediente, bedient sie jetzt drei ohne Gehilfen und es ist gar nichts ungewöhnliches, dass eine Person ihrer vier bedient u. s. w. Zwölf Stunden Arbeit, wie aus den mitgetheilten Thatsachen hervorgeht, werden jetzt in weniger als 10 Arbeitsstunden gepresst. Es ist daher selbstverständlich, in welchem ungeheuren Umfang die Mühen der Fabrikarbeiter sich seit den letzten Jahren vermehrt haben“(FN 175).
Obgleich daher die Fabrikinspektoren die günstigen Resultate der Fabrikgesetze von 1844 und 1850 unermüdlich und mit vollem Recht lobpreisen, gestehen sie doch, dass die Verkürzung des Arbeitstags bereits eine die Gesundheit der Arbeiter, also die Arbeitskraft selbst zerstörende Kondensation der Arbeit hervorgerufen habe. „In den meisten Baumwoll-, Worstedund Seidenfabriken scheint der erschöpfende Zustand von Aufregung, nöthig für die Arbeit an der Maschinerie, deren Bewegung in den letzten Jahren so ausserordentlich beschleunigt worden ist, eine der Ursachen des Ueberschusses der Sterblichkeit an Lungenkrankheiten, den Dr. Greenhow in seinem jüngsten bewundernswerthen Bericht nachgewiesen hat“(FN 176). Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, dass die Tendenz des Kapitals, sobald ihm Verlängerung des Arbeitstags ein für allemal durch das Gesetz abgeschnitten ist, sich durch systematische Steigerung des Intensivitätsgrads der Arbeit gütlich zu thun und jede Verbesserung der Maschinerie in ein Mittel zu grösserer Aussaugung der
Arbeitskraft zu verkehren, bald wieder zu einem Wendepunkt treiben muss, wo abermalige Abnahme der Arbeitsstunden unvermeidlich wird(FN 177). Andrerseits überflügelt der Sturmmarsch der englischen Industrie von 1848 bis zur Gegenwart, d. h. während der Periode des zehnstündigen Arbeitstags, noch weit mehr die Zeit von 1833 bis 1847, d. h. die Periode des zwölfstündigen Arbeitstags, als letztre das halbe Jahrhundert seit Einführung des Fabriksystems, d. h. die Periode des unbeschränkten Arbeitstags(FN 178).
Wir betrachteten im Beginn dieses Kapitels den Leib der Fabrik, die Gliederung des Maschinensystems. Wir sahen dann, wie die Maschinerie das menschliche Exploitationsmaterial des Kapitals vermehrt durch Aneignung der Weiberund Kinderarbeit, wie sie die ganze Lebenszeit des Arbeiters confiscirt durch masslose Ausdehnung des Arbeitstags, und wie ihr Fortschritt, der ein ungeheuer wachsendes Produkt in stets kürzerer Zeit zu liefern erlaubt, endlich zum Mittel umschlägt in jedem Zeitmoment mehr Arbeit flüssig zu machen oder die Arbeitskraft stets intensiver auszubeuten. Wir wenden uns nun zum Fabrikganzen, und zwar in seiner ausgebildetsten Gestalt.
Dr. Ure, der Pindar der automatischen Fabrik, beschreibt sie einerseits als „ Cooperation verschiedener Klassen von Arbeitern, erwachsnen und nicht erwachsnen, die mit Gewandtheit und Fleiss ein System produktiver Maschinerie überwachen, das ununterbrochen durch eine Centralkraft (den ersten Motor) in Thätigkeit gesetzt wird“, andrerseits als „ einen ungeheuren Automaten, zusammengesetzt aus zahllosen mechanischen und selbstbewussten Organen, die im Einverständniss und ohne Unterbrechung wirken, um einen und denselben Gegenstand zu produciren, so dass alle diese Organe einer Bewegungskraft untergeordnet sind, die sich von selbst bewegt.“ Diese beiden Ausdrücke sind keineswegs identisch. In dem einen erscheint der kombinirte Gesammtarbeiter oder gesellschaftliche Arbeitskörper als übergreifendes Subjekt und der mechanische Automat als Objekt; in dem andern ist der Automat selbst das Subjekt und die Arbeiter sind seinen bewusstlosen Organen nur
als bewusste Organe beigeordnet und mit den mechanischen Organen der centralen Bewegungskraft untergeordnet. Der erstere Ausdruck gilt von jeder möglichen Anwendung der Maschinerie im Grossen, der andre charakterisirt ihre kapitalistische Anwendung und daher das moderne Fabriksystem. Ure liebt es daher auch die Centralmaschine, von der die Bewegung ausgeht, nicht nur als Automat, sondern als Autokrat darzustellen. „In diesen grossen Werkstätten versammelt die wohlthätige Macht des Dampfes ihre Myriaden von Unterthanen um sich“(FN 179).
Mit dem Arbeitswerkzeug geht auch die Virtuosität in seiner Führung vom Arbeiter auf die Maschine über. Die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs ist emancipirt von den persönlichen Schranken menschlicher Arbeitskraft. Damit ist die technologische Grundlage aufgehoben, worauf die Theilung der Arbeit in der Manufaktur beruht. An die Stelle der sie charakterisirenden Hierarchie der spezialisirten Arbeiter tritt daher in der automatischen Fabrik die Tendenz der Gleichmachung oder Nivellirung der Arbeiten, welche die Gehilfen der Maschinerie zu verrichten haben(FN 180), an die Stelle der künstlich erzeugten Unterschiede der Theilarbeiter treten vorwiegend die natürlichen Unterschiede des Alters und Geschlechts.
Soweit in der automatischen Fabrik die Theilung der Arbeit wiedererscheint, ist sie zunächst Vertheilung von Arbeitern unter die spezialisirten Maschinen, und von Arbeitermassen, die jedoch keine kombinirten Gruppen bilden, unter die verschiedenen Departements der Fabrik, wo sie an neben einander gereihten gleichartigen Werkzeugmaschinen arbeiten, also nur einfache Cooperation unter ihnen stattfindet. Die kombinirte Gruppe der Manufaktur ist ersetzt durch den Zusammenhang des Hauptarbeiters mit wenigen Gehilfen. Die wesentliche Scheidung ist die von Arbeitern, die wirklich an den Werkzeugmaschinen beschäftigt sind (es kommen hiezu einige Arbeiter zur Bewachung, resp. Fütterung der Bewegungsmaschine) und von blossen Handlangern (fast ausschliesslich Kinder) dieser Maschinenarbeiter. Zu den Handlangern zählen mehr oder minder alle „feeders“ (die den Ma-
schinen bloss Arbeitsstoff darreichen). Neben diese Hauptklassen tritt ein numerisch unbedeutendes Personal, das mit der Kontrole der gesammten Maschinerie und ihrer beständigen Reparatur beschäftigt ist, wie Ingenieure, Mechaniker, Schreiner u. s. w. Es ist eine höhere, theils wissenschaftlich gebildete, theils handwerksmässige Arbeiterklasse, ausserhalb des Kreises der Fabrikarbeiter und ihnen nur aggregirt(FN 181). Diese Theilung der Arbeit ist rein technologisch.
Alle Arbeit an der Maschine erfordert frühzeitigen Einbruch des Arbeiters, damit er seine eigne Bewegung der gleichförmig kontinuirlichen Bewegung eines Automaten anpassen lerne. Soweit die Gesammtmaschinerie selbst ein System verschiedenartiger, gleichzeitig wirkender und kombinirter Maschinen bildet, erfordert die auf ihr beruhende Cooperation nicht minder Vertheilung besondrer Arbeiter unter die besonderten Maschinen. Aber der Maschinenbetrieb hebt die Nothwendigkeit auf diese Vertheilung manufakturmässig zu befestigen durch fortwährende Aneignung derselben Arbeiter an dieselbe Funktion(FN 182). Da die Gesammtbewegung der Fabrik nicht vom Arbeiter ausgeht, sondern von der Maschine, kann fortwährender Personenwechsel stattfinden ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses. Den schlagendsten Beweis hierzu liefert das während der englischen Fabrikantenrevolte von 1848—50 ins Werk gesetzte Relaissystem. Die Geschwindigkeit endlich, womit die Arbeit an der Maschine im jugendlichen Alter erlernt wird, beseitigt
ebenso die Nothwendigkeit, eine besondre Klasse Arbeiter ausschliesslich zu Maschinenarbeitern zu machen(FN 183). Die Dienste der blossen Handlanger aber sind in der Fabrik grossentheils durch Maschinen ersetzbar(FN 184), theils erlauben sie andrerseits wegen ihrer völligen Einfachheit raschen und beständigen Wechsel der mit dieser Plackerei belasteten Personen.
Obgleich nun die Maschinerie das alte System der Theilung der Arbeit technologisch über den Haufen wirft, schleppt es sich zunächst als Tradition der Manufaktur gewohnheitsmässig in der Fabrik fort, um dann systematisch vom Kapital als Exploitationsmittel der Arbeitskraft in noch ekelhafterer Form reproducirt und befestigt zu werden. Aus der lebenslangen Specialität ein Theilwerkzeug zu führen, wird die lebenslange Specialität einer Theilmaschine zu dienen. Die Maschinerie wird missbraucht, um den Arbeiter selbst von Kindesbeinen in den Theil einer Theilmaschine zu verwandeln(FN 185). Nicht nur werden so die zu seiner eignen Reproduktion nöthigen Kosten bedeutend vermindert, sondern zugleich seine hilflose Abhängigkeit vom Fabrikganzen, also vom Kapitalisten, vollendet. Hier wie überall muss man unterscheiden zwischen der grössern Produktivität, die der Entwicklung des gesellschaftlichen Produktions-
prozesses, und der grössern Produktivität, die seiner kapitalistischen Ausbeutung geschuldet ist.
In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existirt ein todter Mechanismus unabhängig von ihnen und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einverleibt. „Der trübselige Schlendrian einer endlosen Arbeitsqual, worin derselbe mechanische Prozess immer wieder durchgemacht wird, gleicht der Arbeit des Sisyphus; die Last der Arbeit, gleich dem Felsen, fällt immer wieder auf den abgematteten Arbeiter zurück“(FN 186). Während die Maschinenarbeit das Nervensystem aufs äusserste angreift, unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln und konfiscirt alle freie körperliche und geistige Thätigkeit(FN 187). Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt. Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozess, sondern zugleich Verwerthungsprozess des Kapitals, ist es gemeinsam, dass nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingung, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technologisch handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als todte Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt. Die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit vollendet sich, wie bereits früher angedeutet, in der auf Grundlage der
Maschinerie aufgebauten grossen Industrie. Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind und mit ihm die Macht „ des Meisters“ bilden. Dieser Meister, in dessen Hirn die Maschinerie und sein Monopol an derselben unzertrennlich verwachsen sind, ruft daher in Kollisionsfällen den „Händen“ verächtlich zu: „Die Fabrikarbeiter sollten in heilsamer Erinnerung halten, dass ihre Arbeit in der That eine sehr niedrige Sorte geschickter Arbeit ist; dass keine leichter aneigenbar und in Anbetracht ihrer Qualität besser belohnt ist, dass keine durch kurze Unterweisung des mindest Erfahrnen in so kurzer Zeit und in solchem Ueberfluss zugeführt werden kann. Des Meisters Maschinerie spielt in der That eine viel wichtigere Rolle in dem Geschäft der Produktion als die Arbeit und das Geschick des Arbeiters, die eine Erziehung von 6 Monaten lehren und jeder Bauernknecht lernen kann“(FN 188).
Die technologische Unterordnung des Arbeiters unter den gleichförmigen Gang des Arbeitsmittels und die eigenthümliche Zusammensetzung des Arbeitskörpers aus Individuen beider Geschlechter und aller Altersstufen schafft eine kasernenmässige Disciplin, die sich zum vollständigen Fabrikregime ausbildet und die schon früher erwähnte Arbeit der Oberaufsicht, damit zugleich die Theilung der Arbeiter in Handarbeiter und Arbeitsaufseher, gemeine Industriesoldaten und Industrieunterofficiere, völlig entwickelt. „Die Hauptschwierigkeit in der automatischen Fabrik bestand in der nothwendigen Disciplin, um die Menschen
auf ihre unregelmässigen Gewohnheiten in der Arbeit verzichten zu machen, und sie zu identificiren mit der unveränderlichen Regelmässigkeit des grossen Automaten. Aber einen den Bedürfnissen und der Geschwindigkeit des automatischen Systems entsprechenden Disciplinarcodex zu erfinden und mit Erfolg auszuführen, war ein Unternehmen des Herkules würdig, das ist das edle Werk Arkwright’s! Selbst heut zu Tage, wo das System in seiner ganzen Vollendung organisirt ist, ist es fast unmöglich unter den Arbeitern, die das Alter der Mannbarkeit zurückgelegt haben, nützliche Gehilfen für das automatische System zu finden“(FN 189). Der Fabrikcodex, worin das Kapital seine Autokratie über seine Arbeiter, ohne die sonst vom Bürgerthum so beliebte Theilung der Gewalten und das noch beliebtere Repräsentativsystem, privatgesetzlich und eigenherrlich formulirt, ist nur die kapitalistische Karrikatur der gesellschaftlichen Reglung des Arbeitsprozesses, welche mit der Cooperation auf grosser Stufenleiter und der Anwendung gemeinsamer Arbeitsmittel, wie namentlich der Maschinerie, nöthig wird. An die Stelle der Peitsche des Sklaventreibers tritt das Strafbuch des Aufsehers. Alle Strafen lösen sich natürlich auf in Geldstrafen und Lohnabzüge und der gesetzgeberische Scharfsinn der Fabrik-Lykurge macht ihnen die Verletzung ihrer Gesetze wo möglich noch einbringlicher als deren Befolgung(FN 190).
Wir deuten nur hin auf die materiellen Bedingungen, unter denen die Fabrikarbeit verrichtet wird. Alle Sinnesorgane werden gleichmässig
verletzt durch die künstlich gesteigerte Temperatur, die mit Abfällen des Rohmaterials geschwängerte Atmosphäre, den betäubenden Lärm u. s. w., abgesehn von der Lebensgefahr unter dicht gehäufter Maschinerie, die mit der Regelmässigkeit der Jahreszeiten ihre industriellen Schlachtbülletins producirt. Die Oekonomisirung der gesellschaftlichen Produktionsmittel, erst im Fabriksystem treibhausmässig gereift, wird in der Hand des Kapitals zugleich zum systematischen Raub an den Lebensbedingungen des Arbeiters während der Arbeit, wie an Raum, Luft, Licht und persönlichen Schutzmitteln wider die lebensgefährlichen oder gesundheitswidrigen Umstände des Produktionsprozesses, von Vorrichtungen zur Bequemlichkeit des Arbeiters gar nicht zu sprechen(FN 191). Nennt Fourier mit Unrecht die Fabriken „gemäs-
sigte Bagnos“(FN 192)? — Der Kampf zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter beginnt mit dem Kapitalverhältniss selbst. Er tobt fort während der ganzen Manufakturperiode(FN 193). Erst seit der Einführung der Maschinerie bekämpft der Arbeiter das Arbeitsmittel selbst, die materielle Existenzweise des Kapitals. Er revoltirt gegen diese bestimmte Form des Produktionsmittels als die materielle Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise.
Ziemlich ganz Europa erlebte während des 17. Jahrhunderts Arbeiterrevolten gegen die s. g. Bandmühle (auch Schnurmühle oder Mühlenstuhl genannt), eine Maschine zum Weben von Bändern und Borten(FN 194). Ende des ersten Dritttheils des 17. Jahrhunderts erlag eine
Windsägemühle, von einem Holländer in der Nähe Londons angelegt, vor Pöbelexcessen. Noch Anfang des 18. Jahrhunderts überwanden durch Wasser getriebne Sägemaschinen in England nur mühsam den parlamentarisch unterstützten Volkswiderstand. Als Everet 1758 die erste vom Wasser getriebene Maschine zum Wollscheeren erbaut hatte, wurde sie von 100,000 ausser Arbeit gesetzten Menschen in Brand gesteckt. Gegen die scribbling mills und Kardirmaschinen Arkwright’s petitionirten 50,000 Arbeiter, die bisher vom Wollkratzen gelebt, beim Parlament. Die massenhafte Zerstörung von Maschinen in den englischen Manufakturdistrikten während der ersten 15 Jahre des 19. Jahrhunderts, namentlich in Folge der Ausbeutung des Dampfwebstuhls, bot, unter dem Namen der Ludditenbewegung, der Antijakobiner-Regierung eines Sidmouth, Castlereagh u. s. w. den Vorwand zu reaktionärsten Gewaltschritten. Es bedarf Zeit und Erfahrung, bevor der Arbeiter die Maschinerie von ihrer kapitalistischen Anwendung unterscheiden und
daher seine Angriffe vom materiellen Produktionsmittel selbst auf dessen gesellschaftliche Exploitationsform übertragen lernt(FN 195).
Die Kämpfe um den Arbeitslohn innerhalb der Manufaktur setzen die Manufaktur voraus und sind keineswegs gegen ihre Existenz gerichtet. So weit die Bildung der Manufakturen bekämpft wird, geschieht es von den Zunftmeistern und privilegirten Städten, nicht von den Lohnarbeitern. Bei Schriftstellern der Manufakturperiode wird die Theilung der Arbeit daher vorherrschend als Mittel aufgefasst virtuell Arbeiter zu ersetzen, aber nicht wirklich Arbeiter zu verdrängen. Dieser Unterschied ist selbstverständlich. Sagt man z. B., es würden 100 Millionen Menschen in England erheischt sein um mit dem alten Spinnrad die Baumwolle zu verspinnen, die jetzt von 500,000 mit der Maschine versponnen wird, so heisst das natürlich nicht, dass die Maschine den Platz dieser Millionen, die nie existirt haben, einnahm. Es heisst nur, dass viele Millionen Arbeiter erheischt wären, um die Spinnmaschinerie zu ersetzen. Sagt man dagegen, dass der Dampfwebstuhl in England 800,000 Weber auf das Pflaster warf, so spricht man nicht von existirender Maschinerie, die durch eine bestimmte Arbeiterzahl ersetzt werden müsste, sondern von einer existirenden Arbeiterzahl, die faktisch durch Maschinerie ersetzt oder verdrängt worden ist. Während der Manufakturperiode blieb der handwerksmässige Betrieb, wenn auch zerlegt, die Grundlage. Die neuen Kolonialmärkte konnten durch die relativ schwache Anzahl der vom Mittelalter überlieferten städtischen Arbeiter nicht befriedigt werden und die eigentlichen Manufakturen öffneten zugleich dem mit Auflösung der Feudalität von Grund und Boden verjagten Landvolke neue Produktionsgebiete. Damals trat also an der Theilung der Arbeit und der Cooperation in den Werkstätten mehr die positive Seite hervor, dass sie beschäftigte Arbeiter produktiver machen(FN 196). Cooperation und Kombination der Arbeitsmittel in den Hän-
den Weniger rufen, auf die Agrikultur angewandt, zwar grosse, plötzliche und gewaltsame Revolutionen der Produktionsweise und daher der Lebensbedingungen und Beschäftigungsmittel der Landbevölkerung hervor, die zum Theil der Periode der grossen Industrie lang vorhergehn. Aber dieser Kampf spielt ursprünglich mehr zwischen grossen und kleinen Landeigenthümern als zwischen Kapital und Lohnarbeit; andrerseits, soweit Arbeiter durch Arbeitsmittel, Schafe, Pferde u. s. w. verdrängt werden, bilden unmittelbare Gewaltakte hier in erster Instanz die Voraussetzung der industriellen Revolution. Erst werden die Arbeiter vom Grund und Boden verjagt, und dann kommen die Schafe. Der Landdiebstahl auf grosser Stufenleiter, wie in England, schafft der grossen Agrikultur erst ihr Anwendungsfeld. In ihren Anfängen hat diese Umwälzung der Agrikultur daher mehr den Schein einer politischen Revolution.
Als Maschine wird das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten des Arbeiters selbst(FN 197). Die Selbstverwerthung des Kapitals durch die Maschine steht im direkten Verhältniss zur Arbeiterzahl, deren Existenzbedingungen sie vernichtet. Das ganze System der kapitalistischen Produktion beruht darauf, dass der Arbeiter seine Arbeitskraft als Waare verkauft. Die Theilung der Arbeit vereinseitigt diese Arbeitskraft zum ganz partikularisirten Geschick ein Theilwerkzeug zu führen. Sobald die Führung des Werkzeugs der Maschine anheimfällt, erlischt mit dem Gebrauchswerth der Tauschwerth der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird unverkäuflich, wie ausser Kurs gesetztes Papiergeld. Der Theil der Arbeiterklasse, den
die Maschinerie so in überflüssige, d. h. nicht länger zur Selbstverwerthung des Kapitals unmittelbar nothwendige Bevölkerung verwandelt, geht einerseits unter in dem ungleichen Kampf des alten handwerksmässigen und manufakturmässigen Betriebs wider den maschinenmässigen, überfluthet andrerseits alle leichter zugänglichen Industriezweige, überfüllt den Arbeitsmarkt und senkt daher den Preis der Arbeitskraft unter ihren Werth. Ein grosser Trost für die pauperisirten Arbeiter soll sein, dass ihre Leiden theils nur „zeitlich“ („a temporary inconvenience“), theils dass die Maschinerie sich nur allmälig eines ganzen Produktionsfelds bemächtigt, wodurch Umfang und Intensivität ihrer vernichtenden Wirkung gebrochen werde. Der eine Trost schlägt den andern. Wo die Maschine allmälig ein Produktionsfeld ergreift, producirt sie chronisches Elend in der mit ihr konkurrirenden Arbeiterschichte. Wo der Uebergang rasch, wirkt sie massenhaft und akut. Die Weltgeschichte bietet kein entsetzlicheres Schauspiel als den allmäligen, über Decennien verschleppten, endlich 1838 besiegelten Untergang der englischen Handbaumwollweber. Viele von ihnen starben am Hungertod, viele vegetirten lange mit ihren Familien auf 2½ d. taglich(FN 198). Akut dagegen wirkte die englische Baumwollmaschinerie auf Ostindien, dessen Generalgouverneur 1834—35 konstatirte: „Das Elend
findet kaum eine Parallele in der Geschichte des Handels. Die Knochen der Baumwollweber bleichen die Ebenen von Indien.“ Allerdings, sofern diese Weber das Zeitliche segneten, bereitete ihnen die Maschine nur „zeitliche Missstände“. Uebrigens ist die „ zeitliche“ Wirkung der Maschinerie permanent, indem sie beständig neue Produktionsgebiete ergreift. Die verselbstständigte und entfremdete Gestalt, welche die kapitalistische Produktionsweise überhaupt den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber dem Arbeiter giebt, entwickelt sich also mit der Maschinerie zum vollständigen Gegensatz(FN 199). Daher mit ihr zum erstenmal die brutale Revolte des Arbeiters gegen das Arbeitsmittel.
Das Arbeitsmittel erschlägt den Arbeiter. Dieser direkte Gegensatz erscheint allerdings am handgreiflichsten, so oft neu eingeführte Maschinerie konkurrirt mit überliefertem Handwerksoder Manufakturbetrieb. Aber innerhalb der grossen Industrie selbst wirkt fortwährende Verbesserung der Maschinerie und Entwicklung des automatischen Systems analog „Der beständige Zweck verbesserter Maschinerie ist die Handarbeit zu vermindern oder einen Ring in der Produktionskette der Fabrik durch Substitution eiserner für menschliche Apparate zu vollenden“(FN 200). „Die Anwendung von Dampfund Wasserkraft auf Maschinerie, die bisher mit der Hand bewegt wurde, ist das Ereigniss jeden Tages … Die kleineren Verbesserungen in der Maschinerie, welche Oekonomie der Bewegungskraft, Verbesserung des Machwerks, vermehrte Produktion in derselben Zeit oder Verdrängung eines Kindes, eines Frauenzimmers oder eines Mannes bezwecken, sind constant, und obgleich scheinbar
nicht von grossem Gewicht, haben sie dennoch wichtige Resultate“(FN 201). „Ueberall, wo eine Operation viel Geschick und eine sichre Hand verlangt, entzieht man sie so schnell als möglich den Armen des zu geschickten und oft zu Unregelmässigkeiten aller Art geneigten Arbeiters, um einen besondern Mechanismus damit zu betrauen, der so gut geregelt ist, dass ein Kind ihn überwachen kann“(FN 202). „Im automatischen System wird das Talent des Arbeiters progressiv verdrängt“(FN 203). „Die Verbesserung der Maschinerie erfordert nicht nur Verminderung in der Anzahl der beschäftigten erwachsnen Arbeiter zur Erzielung eines bestimmten Resultats, sondern sie substituirt eine Klasse von Individuen einer andern Klasse, eine minder geschickte einer geschickteren, Kinder den Erwachsnen, Frauen den Männern. Alle diese Wechsel verursachen beständige Fluktuationen in der Rate des Arbeitslohns“(FN 204). „Die Maschinerie wirft unaufhörlich Erwachsne aus der Fabrik heraus“(FN 205). Die ausserordentliche Elasticität des Maschinenwesens in Folge gehäufter praktischer Erfahrung, des schon vorhandnen Umfangs mechanischer Mittel, und des beständigen Fortschritts der Technologie, zeigte uns sein Sturmmarsch unter dem Druck eines verkürzten Arbeitstags. Aber wer hätte 1860, im Zenithjahr der englischen Baumwollindustrie, die galoppirenden Verbesserungen der Maschinerie und die entsprechende Deplacirung von Handarbeit geahnt, welche die drei folgenden Jahre unter dem Stachel des amerikanischen Bürgerkriegs hervorriefen? Von den offiziellen Anführungen der englischen Fabrikinspektoren über diesen Punkt genügen hier ein paar Beispiele. Ein Manchester Fabrikant erklärt: „Statt 75 Kardirmaschinen brauchen wir jetzt nur 12, welche dieselbe Quantität von ebenso guter, wenn nicht besserer Qualität liefern … Die Ersparung an Arbeitslohn beträgt 10 Pfd. St. wöchentlich, die an Baumwollabfall 10 %.“ In einer Manchester Feinspinnerei
wurde „vermittelst beschleunigter Bewegung und Einführung verschiedner self-acting Prozesse in einem Departement ¼, in einem über ½ des Arbeiterpersonals beseitigt, während die Kämmmaschine an der Stelle der zweiten Kardirmaschine die Zahl der früher im Kardirraum beschäftigten Hände sehr vermindert hat.“ Eine andre Spinnfabrik schätzt ihre allgemeine Ersparung von „Händen“ auf 10 %. Die Herren Gilmore, Spinner zu Manchester, erklären: „In unsrem blowing Departement schätzen wir die in Folge neuer Maschinerie gemachte Ersparung an Händen und Arbeitslohn auf ein volles Drittel … in dem jack frame und drawing frame room ungefähr ⅓ weniger in Auslage und Händen; im Spinnraum ungefähr ⅓ weniger in Auslage. Aber das ist nicht alles; wenn unser Garn jetzt zum Weber geht, ist es so sehr verbessert durch die Anwendung der neuen Maschinerie, dass sie mehr und besseres Gewebe als mit dem alten Maschinengarn produciren“(FN 206). Fabrikinspektor A. Redgrave bemerkt hierzu: „Die Verminderung der Arbeiter bei gesteigerter Produktion schreitet rasch vorwärts; in den Wollfabriken begann kürzlich eine neue Reduktion der Hände, und sie dauert fort; vor wenigen Tagen sagte mir ein Schulmeister, der bei Rochdale wohnt, die grosse Abnahme in den Mädchenschulen sei nicht nur dem Druck der Krise geschuldet, sondern auch den Aenderungen in der Maschinerie der Wollfabrik, in Folge deren eine Durchschnittsreduktion von 70 Halbzeitlern stattgefunden“(FN 207).
Die Maschinerie wirkt jedoch nicht nur als übermächtiger Konkurrent, stets auf dem Sprung den Lohnarbeiter „ überflüssig“ zu machen.
Als ihm feindliche Potenz wird sie laut und tendenziell vom Kapital proklamirt und gehandhabt. Sie wird das machtvollste Kriegsmittel zur Niederschlagung der periodischen Arbeiteraufstände, strikes u. s. w. wider die Autokratie des Kapitals(FN 208). Nach Gaskell war gleich die Dampfmaschine ein Antagonist der „Menschenkraft“, der den Kapitalisten befähigte die steigenden Ansprüche der Arbeiter niederzuschmettern, die das beginnende Fabriksystem zur Krise zu treiben drohten(FN 209). Man könnte eine ganze Geschichte der Erfindungen seit 1830 schreiben, die bloss als Kriegsmittel des Kapitals wider Arbeiteremeuten ins Leben traten. Wir erinnern vor allem an die selfacting mule, weil sie eine neue Epoche des automatischen Systems eröffnet(FN 210). Ure sagt von einer Maschine zum Farbendruck in den Kattundruckereien: „Endlich suchten sich die Kapitalisten von dieser unerträglichen Sklaverei (nämlich den ihnen lästigen Kontraktsbedingungen der Arbeiter) zu befreien, indem sie die Hilfsquellen der Wissenschaft anriefen, und bald waren sie reintegrirt in ihre legitimen Rechte, die des Kopfes über die andern Körpertheile.“ Er sagt von einer Erfindung zum Kettenschlichten, deren unmittelbarer Anlass ein strike: „Die Horde der Unzufriednen, die sich hinter den alten Linien der Theilung der Arbeit unbesiegbar verschanzt wähnte, sah sich so in die Flanke genommen und ihre Vertheidigungsmittel vernichtet durch die moderne Taktik der Maschinisten. Sie mussten sich auf Gnade und Ungnade ergeben.“ Er sagt von der Erfindung der selfácting mule: „Sie war berufen die Ordnung unter den industriellen Klassen wieder herzustellen … Diese Erfindung bestätigt die von uns bereits entwickelte Doktrin, dass das Kapital, indem es die Wissenschaft in seinen Dienst presst, stets die rebellische Hand der Industrie zum Gehorsam
zwingt“(FN 211). Obgleich Ure’s Schrift vor 30 Jahren erschien, also zur Zeit eines relativ noch schwach entwickelten Fabriksystems, bleibt sie der klassische Ausdruck des Fabrikgeists, nicht nur wegen ihres offenherzigen Cynismus, sondern auch wegen der Naivetät, womit er die gedankenlosen Widersprüche des Kapitalhirns ausplaudert. Nachdem er z. B. die „Doktrin“ entwickelt, dass das Kapital mit Hilfe der von ihm in Sold genommenen Wissenschaft „stets die rebellische Hand der Industrie zum Gehorsam zwingt“, entrüstet er sich darüber, „dass man von gewisser Seite die mechanisch-physische Wissenschaft anklagt, sich dem Despotismus reicher Kapitalisten zu leihen und zum Unterdrückungsmittel der armen Klassen herzugeben.“ Nachdem er weit und breit gepredigt, wie vortheilhaft rasche Entwicklung der Maschinerie den Arbeitern, warnt er sie, dass sie durch ihre Widersetzlichkeit, Strikes u. s. w., die Entwicklung der Maschinerie beschleunigen. „Derartige Revolten“, sagt er, „zeigen die menschliche Verblendung in ihrem verächtlichsten Charakter, dem Charakter eines Menschen, der sich zu seinem eignen Henker macht.“ Wenige Seiten vorher heisst es umgekehrt: „Ohne die Kollisionen und heftigen Unterbrechungen, verursacht durch die irrigen Ansichten der Arbeiter, hätte sich das Fabriksystem noch viel rascher entwickelt und viel nützlicher für alle interessirten Parteien.“ Dann ruft er wieder aus: „Zum Glück für die Bevölkerung der Fabrikstädte Grossbritaniens finden die Verbesserungen in der Mechanik nur allmälig statt.“ „Mit Unrecht“, sagt er, „klagt man die Maschinen an, dass sie den Arbeitslohn der Erwachsnen vermindern, indem sie einen Theil derselben deplaciren, wodurch ihre Anzahl das Bedürfniss nach Arbeit übersteigt. Aber es findet vermehrte Anwendung der Kinderarbeit statt und der Gewinn der Erwachsnen ist dadurch um so beträchtlicher.“ Derselbe Trostspender vertheidigt andrerseits die Niedrigkeit der Kinderlöhne damit, dass „sie die Aeltern abhalten ihre Kinder zu früh in die Fabriken zu schicken.“ Sein ganzes Buch ist eine Apologie des unbeschränkten Arbeitstags und es erinnert seine liberale Seele an die dunkelsten Zeiten des Mittelalters, wenn die Gesetzgebung verbietet Kinder von 13 Jahren mehr als 12 Stunden per Tag abzurackern. Diess hält ihn nicht ab die Fabrikarbeiter zu einem Dankgebet an die Vorsehung
aufzufordern, die ihnen durch die Maschinerie „die Musse verschafft habe über ihre unsterblichen Interessen nachzudenken“(FN 212).
Eine ganze Reihe bürgerlicher Oekonomen, wie James Mill, Mac Culloch, Torrens, Senior, J. St. Mill u. s. w., behauptet, dass alle Maschinerie, die Arbeiter verdrängt, stets gleichzeitig und nothwendig ein adäquates Kapital zur Beschäftigung derselben identischen Arbeiter freisetzt(FN 213).
Man unterstelle, ein Kapitalist wende 100 Arbeiter an z. B. in einer Tapetenmanufaktur, den Mann zu 30 Pfd. St. jährlich. Das von ihm jährlich ausgelegte variable Kapital beträgt also 3000 Pfd. St. Er entlasse 50 Arbeiter und beschäftige die übrigbleibenden 50 mit einer Maschinerie, die ihm 1500 Pfd. St. kostet. Der Vereinfachung halber wird von Baulichkeiten, Kohlen u. s. w. abgesehn. Man nimmt ferner an, das jährlich verzehrte Rohmaterial koste nach wie vor 3000 Pfd. St.(FN 214). Ist durch diese Metamorphose irgend ein Kapital „freigesetzt“? In der alten Betriebsweise bestand die ausgelegte Gesammtsumme von 6000 Pfd. St. halb aus constantem und halb aus variablem Kapital. Sie besteht jetzt aus 4500 Pfd. St. (3000 Pfd. St. für Rohmaterial und 1500 Pfd. St. für Maschinerie) constantem und 1500 Pfd. St. variablem Kapital. Statt der Hälfte bildet der variable oder in lebendige Arbeitskraft umgesetzte Kapitaltheil nur noch ¼ des Gesammtkapitals. Statt der Freisetzung findet hier Bindung von Kapital in einer Form statt, worin es aufhört sich gegen Arbeitskraft auszutauschen, d. h. Verwandlung von variablem in constantes Kapital. Das Kapital von 6000 Pfd. St. kann, unter sonst gleichbleibenden Umständen, jetzt niemals mehr als 50 Arbeiter beschäftigen. Mit jeder Verbesserung der Maschinerie beschäftigt es weniger. Kostete die neu eingeführte Maschinerie weniger als die Summe der von ihr verdrängten Arbeitskraft und Arbeitswerkzeuge, also z. B. statt 1500 nur 1000 Pfd. St., so würde ein variables Kapital von 1000 Pfd. St. in constantes verwandelt oder gebunden, während ein Kapital von 500 Pfd. St. freigesetzt würde. Letzteres, denselben Jahreslohn unter-
stellt, bildet einen Beschäftigungsfonds für ungefähr 16 Arbeiter, während 50 entlassen sind, ja für viel weniger als 16 Arbeiter, da die 500 Pfd. St. zu ihrer Verwandlung in Kapital wieder zum Theil in constantes Kapital verwandelt werden müssen, also auch nur zum Theil in Arbeitskraft umgesetzt werden können.
In der That meinen jene Apologeten auch nicht diese Art Freisetzung von Kapital. Sie meinen die Lebensmittel der freigesetzten Arbeiter. Es kann nicht geläugnet werden, dass im obigen Fall z. B. die Maschinerie nicht nur 50 Arbeiter freisetzt und dadurch „disponibel“ macht, sondern zugleich ihren Zusammenhang mit Lebensmitteln zum Werth von 1500 Pfd. St. aufhebt und so diese Lebensmittel „freisetzt“. Die einfache und keineswegs neue Thatsache, dass die Maschinerie den Arbeiter von Lebensmitteln freisetzt, lautet also ökonomisch, dass die Maschinerie Lebensmittel für den Arbeiter freisetzt oder in Kapital zu seiner Anwendung verwandelt. Man sieht, es kommt alles auf die Ausdrucksweise an. Nominibus mollire licet mala.
Die Lebensmittel zum Betrag von 1500 Pfd. St. standen den entlassnen Arbeitern niemals als Kapital gegenüber. Was ihnen als Kapital gegenüberstand, waren die jetzt in Maschinerie verwandelten 1500 Pfd. St. Näher betrachtet repräsentirten diese 1500 Pfd. St. nur einen Theil der vermittelst der entlassnen 50 Arbeiter jährlich producirten Tapeten, die sie in Geldform statt in natura von ihrem Anwender zum Lohn erhielten. Mit den in 1500 Pfd. St. verwandelten Tapeten kauften sie Lebensmittel zu demselben Betrag. Diese existirten für sie daher nicht als Kapital, sondern als Waaren, und sie selbst existirten für diese Waaren nicht als Lohnarbeiter, sondern als Käufer. Der Umstand, dass die Maschinerie sie von Kaufmitteln „freigesetzt“ hat, verwandelt sie aus Käufern in Nicht-Käufer. Daher verminderte Nachfrage für jene Waaren. Voilà tout. Wird diese verminderte Nachfrage nicht durch vermehrte Nachfrage von anderer Seite kompensirt, so sinkt der Marktpreis der Waaren. Dauert diess länger und in grössrem Umfange, so erfolgt ein Deplacement der in der Produktion jener Waaren beschäftigten Arbeiter. Ein Theil des Kapitals, das früher nothwendige Lebensmittel producirte, wird in anderer Form reproducirt. Während des Falls der Marktpreise und des Deplacements von Kapital, werden auch die in der Produktion der nothwendigen Lebensmittel beschäftigten Arbeiter von einem Theil ihres Lohns „freigesetzt“.
Statt also zu beweisen, dass die Maschinerie durch die Freisetzung der Arbeiter von Lebensmitteln letztre gleichzeitig in Kapital zur Anwendung der erstern verwandelt, beweist der Herr Apologet mit dem probaten Gesetz von Nachfrage und Zufuhr umgekehrt, dass die Maschinerie nicht nur in dem Produktionszweig, worin sie eingeführt, sondern auch in den Produktionszweigen, worin sie nicht eingeführt wird, Arbeiter aufs Pflaster wirft.
Ausser der guten Absicht der Vertuschung liegt jener abgeschmackten Kompensationstheorie zu Grunde, erstens, dass die Maschinerie früher gebundne Arbeitskraft freisetzt, und falls zuschüssiges Kapital nach Anlage drängt, ihm mit der disponiblen Arbeitskraft gleichzeitig disponibel gemachte Lebensmittel zur Verfügung stellt. Aber die Maschinerie deplacirt nicht nur die zunächst „überzählig“ gemachten, sondern zugleich den neuen Menschenstrom, der jedem Industriezweig sein Kontingent zum regelmässigen Ersatz und Wachsthum liefert. Diese Ersatzmannschaft wird neu vertheilt und in andern Arbeitszweigen absorbirt, während die ursprünglichen Opfer grossentheils in der Uebergangsperiode verkommen und verkümmern. Zudem ist ihre Arbeitskraft durch die Theilung der Arbeit so vereinseitigt, dass sie nur in wenigen und daher beständig überfüllten niedrigen Arbeitszweigen Zugang finden(FN 215). Zweitens aber wird die unzweifelhafte Thatsache ausgesprochen, dass die Maschinerie an sich nicht verantwortlich ist für die „Freisetzung“ der Arbeiter von Lebensmitteln. Sie verwohlfeilert und vermehrt das Produkt in dem Zweig, den sie ergreift, und lässt die in andern Industriezweigen producirte Lebensmittel-Masse zunächst unverändert. Nach wie vor ihrer Einführung besitzt die Gesellschaft also gleichviel oder mehr Lebensmittel für die deplacirten Arbeiter, ganz abgesehen von dem
enormen Theil des jährlichen Produkts, der von Nichtarbeitern vergeudet wird. Und diess ist die Pointe der ökonomistischen Apologetik! Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie untrennbaren Widersprüche und Antagonismen existiren nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie selbst erwachsen, sondern aus ihrer kapitalistischen Anwendung! Da also die Maschinerie an sich betrachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch angewandt den Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisch angewandt ihre Intensivität steigert, an sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den Reichthum des Producenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn verpaupert u. s. w., erklärt der bürgerliche Oekonom einfach, das Ansichbetrachten der Maschinerie beweise haarscharf, dass alle jene handgreiflichen Widersprüche blosser Schein der gemeinen Wirklichkeit, aber an sich, also auch in der Theorie, gar nicht vorhanden sind. Er spart sich so alles weitere Kopfbrechen und bürdet seinem Gegner obendrein die Dummheit auf, nicht die kapitalistische Anwendung der Maschinerie zu bekämpfen, sondern die Maschinerie selbst(FN 216).
Da jedes Maschinenprodukt, z. B. eine Elle Maschinengeweb, wohlfeiler ist als das von ihm verdrängte gleichartige Handprodukt, folgt als absolutes Gesetz: Bleibt das Gesammtquantum des maschinenmässig producirten Artikels gleich dem Gesammtquantum des von ihm ersetzten handwerksoder manufakturmässig producirten Artikels, so vermindert sich die Gesammtsumme der angewandten Arbeit. Die etwa zur Produktion der Arbeitsmittel selbst, der Maschinerie, Kohle u. s. w., erheischte Arbeitszunahme muss kleiner sein
als die durch Anwendung der Maschinerie bewirkte Arbeitsabnahme. Das Maschinenprodukt wäre sonst eben so theuer oder theurer als das Handprodukt. Statt aber gleich zu bleiben, wächst thatsächlich die Gesammtmasse des von einer verminderten Arbeiteranzahl producirten Maschinenartikels weit über die Gesammtmasse des verdrängten Handwerksartikels. Gesetzt 400,000 Ellen Maschinengeweb würden von weniger Arbeitern producirt als 100,000 Ellen Handgeweb. In dem vervierfachten Produkt steckt viermal mehr Rohmaterial. Die Produktion des Rohmaterials muss also vervierfacht werden. Was aber die verzehrten Arbeitsmittel, wie Baulichkeiten, Kohlen, Maschinen u. s. w. betrifft, so ändert sich die Grenze, innerhalb deren die zu ihrer Produktion erheischte zusätzliche Arbeit wachsen kann, mit der Differenz zwischen der Masse des Maschinenprodukts und der Masse des von derselben Arbeiterzahl herstellbaren Handprodukts.
Mit der Ausdehnung des Maschinenbetriebs in einem Industriezweig steigert sich also zunächst die Produktion in den andern Zweigen, die ihm seine Produktionsmittel liefern. Wie weit dadurch die beschäftigte Arbeitermasse wächst, hängt, Länge des Arbeitstags und Intensivität der Arbeit gegeben, von der Zusammensetzung der verwandten Kapitale ab, d. h. vom Verhältniss ihrer constanten und variablen Bestandtheile. Diess Verhältniss seinerseits variirt sehr mit dem Umfang, worin die Maschinerie jene Gewerbe selbst schon ergriffen hat oder ergreift. Die Anzahl zu Kohlenund Metallbergwerken verurtheilter Menschen schwoll ungeheuer mit dem Fortschritt des englischen Maschinenwesens, obgleich ihr Anwachs in den letzten Decennien durch Gebrauch neuer Maschinerie für den Bergbau verlangsamt wird(FN 217). Eine neue Arbeiterart springt mit der Maschine ins Leben, ihr Producent. Wir wissen bereits, dass der Maschinenbetrieb sich dieses Produktionszweigs selbst auf stets massenhafterer Stufenleiter be-
mächtigt(FN 218). Was ferner das Rohmaterial betrifft(FN 219), so unterliegt es z. B. keinem Zweifel, dass der Sturmmarsch der Baumwollspinnerei den Baumwollbau der Vereinigten Staaten und mit ihm nicht nur den afrikanischen Sklavenhandel treibhausmässig förderte, sondern zugleich die Negerzucht zum Hauptgeschäft der sogenannten Border slaves states machte. Als 1790 der erste Sklavencensus in den Vereinigten Staaten aufgenommen ward, betrug ihre Zahl 697,000, dagegen 1861 ungefähr vier Millionen. Andrerseits ist es nicht minder gewiss, dass das Aufblühen der mechanischen Wollfabrik mit der progressiven Verwandlung von Ackerland in Schafweide die massenhafte Verjagung und „Ueberzähligmachung“ der Landarbeiter hervorrief. Irland untergeht noch in diesem Augenblick den Prozess, seine seit 20 Jahren beinahe um die Hälfte verkürzte Bevölkerung noch weiter auf das dem Bedürfniss seiner Landlords und der englischen Herrn Wollfabrikanten exakt entsprechende Mass zu reduciren.
Ergreift die Maschinerie eine Voroder Zwischenstufe des Gesammtcursus, den ein Arbeitsgegenstand bis zu seiner letzten Form zu durchlaufen hat, so vermehrt sich mit dem Arbeitsmaterial die Arbeitsnachfrage in den noch handwerksoder manufakturmässig betriebnen Gewerken, welche das Maschinenfabrikat weiter formen. Die Maschinenspinnerei z. B. lieferte das Garn so wohlfeil und so reichlich, dass die Handweber zunächst, ohne vermehrte Auslage, volle Zeit arbeiten konnten. So stieg ihr Einkommen(FN 220). Daher Menschenzufluss in die Baumwollweberei, bis
schliesslich die von Jenny, Throstle und Mule in England z. B. ins Leben gerufenen 800,000 Baumwollweber wieder vom Dampfwebstuhl erschlagen wurden. So wächst mit dem Ueberfluss der maschinenmässig producirten Kleidungsstoffe die Zahl der Schneider, Kleidermacherinnen, Nähterinnen u. s. w., bis die Nähmaschine erscheint.
Entsprechend der steigenden Masse von Rohstoffen, Halbfabrikaten, Arbeitsinstrumenten u. s. w., die der Maschinenbetrieb mit relativ geringer Arbeiterzahl liefert, differenzirt sich die Bearbeitung dieser Rohstoffe und Halbfabrikate in zahllose Unterarten, also die Mannigfaltigkeit der gesellschaftlichen Produktionszweige. Der Maschinenbetrieb vermehrt die gesellschaftliche Theilung der Arbeit weit mehr als die Manufaktur, weil er die Produktivkraft der von ihm ergriffenen Gewerbe ungleich höher spannt.
Das nächste Resultat der Maschinerie ist den Mehrwerth und zugleich die Produktenmasse, worin er sich darstellt, also mit der Substanz, wovon die Kapitalistenklasse sammt Anhang zehrt, diese Gesellschaftsschichten selbst zu vergrössern. Ihr wachsender Reichthum und die relativ beständig fallende Anzahl der zur Produktion der ersten Lebensmittel erheischten Arbeiter, erzeugen mit neuem Luxusbedürfniss zugleich neue Mittel seiner Befriedigung. Ein grösserer Theil des gesellschaftlichen Produkts verwandelt sich in Surplusprodukt und ein grösserer Theil des Surplusprodukts wird in verfeinerten und vermannigfachten Formen reproducirt und verzehrt. In andern Worten: Die Luxusproduktion wächst(FN 221). Die Verfeinerung und Vermannigfachung der Produkte entspringt ebenso aus den neuen weltmarktlichen Beziehungen, welche die grosse Industrie schafft. Es werden nicht nur mehr ausländische Genussmittel gegen das heimische Produkt ausgetauscht, sondern es geht auch eine grössere Masse fremder Rohstoffe, Ingredienzen, Halbfabrikate u. s. w. als Produktionsmittel in die heimische Industrie ein. Mit denselben weltmarktlichen Beziehungen steigt die Arbeitsnachfrage in der Transportindustrie und spaltet sich letztere in zahlreiche neue Unterarten(FN 222).
Die Vermehrung von Produktionsund Lebensmitteln durch relativ abnehmende Arbeiterzahl treibt zur Ausdehnung der Arbeit in Industriezweigen, deren Produkte, wie Kanäle, Waarendocks, Tunnels, Brücken u. s. w. nur in fernerer Zukunft Früchte tragen. Es bilden sich, entweder direkt auf der Grundlage der Maschinerie, oder doch der ihr entsprechenden allgemeinen industriellen Umwälzung, ganz neue Produktionszweige und daher neue Arbeitsfelder. Ihr Raumantheil an der Gesammtproduktion ist jedoch selbst in den meist entwickelten Ländern keineswegs bedeutend. Die Anzahl der von ihnen beschäftigten Arbeiter steigt im direkten Verhältniss, worin die Nothwendigkeit rohster Handarbeit reproducirt wird. Als Hauptindustrieen dieser Art kann man gegenwärtig Gaswerke, Telegraphie, Photographie, Dampfschifffahrt und Eisenbahnwesen betrachten. Der Census von 1861 (für England und Wales) ergiebt in der Gasindustrie (Gaswerke, Produktion der mechanischen Apparate, Agenten der Gascompagnien u. s. w.) 15,211 Personen, Telegraphie 2399, Photographie 2366, Dampfschiffdienst 3570 und Eisenbahnen 70,599, worunter ungefähr 28,000 mehr oder minder permanent beschäftigte „ungeschickte“ Erdarbeiter nebst dem ganzen administrativen und kommerciellen Personal. Also Gesammtzahl der Individuen in diesen fünf neuen Industrieen 94,145.
Endlich erlaubt die ausserordentlich erhöhte Produktivkraft in den Sphären der grossen Industrie, begleitet, wie sie ist, von intensiv und extensiv gesteigerter Ausbeutung der Arbeitskraft in allen übrigen Produktionssphären, einen stets grösseren Theil der Arbeiterklasse unproduktiv zu verwenden und so namentlich die alten Haussklaven unter dem Namen der „ dienenden Klasse“, wie Bediente, Mägde, Lakaien u. s. w., stets massenhafter zu reproduciren. Nach dem Census von 1861 zählte die Gesammtbevölkerung von England und Wales 20,066,244 Personen, wovon 9,776,259 männlich und 10,289,965 weiblich. Zieht man hiervon ab, was zu alt oder zu jung zur Arbeit, alle „unproduktiven“ Weiber, jungen Personen und Kinder, dann die „ideologischen“ Stände, wie Regierung, Pfaffen, Juristen, Militär u. s. w., ferner alle, deren ausschliessliches Geschäft der Verzehr fremder Arbeit in der Form von Grundrente, Zins u. s. w., endlich Paupers, Vagabunden, Verbrecher u. s. w., so bleiben in rauher Zahl 8 Millionen beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen, mit Einschluss sämmtlicher irgendwie in der Produktion, dem
Handel, der Finanz u. s. w. funktionirenden Kapitalisten. Von diesen 8 Millionen kommen auf:
Rechnen wir die in allen textilen Fabriken Beschäftigten zusammen mit dem Personal der Kohlenund Metallbergwerke, so erhalten wir 1,208,442; rechnen wir sie zusammen mit dem Personal aller MetallWerke und Manufakturen, so die Gesammtzahl 1,039,605, beidemal kleiner als die Zahl der modernen Haussklaven. Welch erhebendes Resultat der kapitalistisch exploitirten Maschinerie!
Alle zurechnungsfähigen Repräsentanten der politischen Oekonomie geben zu, dass neue Einführung der Maschinerie pestartig wirkt auf die Arbeiter in den überlieferten Handwerken und Manufakturen, womit sie zunächst konkurrirt. Fast alle beächzen die Sklaverei des Fabrikarbeiters. Und was ist der grosse Trumpf, den alle ausspielen? Dass die Maschinerie, nach der Tortur, wovon ihre Einführung und ihre Entwicklung begleitet sind, die Arbeitssklaven in letzter Instanz vermehrt, statt sie schliesslich zu vermindern! Ja, die politische Oekonomie jubelt sich aus in dem abscheulichen Theorem, abscheulich für jeden „Philanthrop“, der an die ewige Naturnothwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise glaubt, dass selbst die bereits auf Maschinenbetrieb begründete Fabrik, nach bestimmter Periode des Wachsthums, nach kürzerer oder
längerer „ Uebergangszeit“, mehr Arbeiter abplackt als sie ursprünglich aufs Pflaster warf(FN 226)!
Zwar zeigte sich schon an einigen Beispielen, z. B. den englischen Worstedund Seidenfabriken, dass auf einem gewissen Entwicklungsgrad ausserordentliche Ausdehnung von Fabrikzweigen mit nicht nur relativer, sondern absoluter Abnahme der angewandten Arbeiteranzahl verbunden sein kann. Im Jahr 1860, als ein Specialcensus aller Fabriken des Vereinigten Königreichs auf Befehl des Parlaments aufgenommen ward, zählte die dem Fabrikinspektor R. Baker zugewiesne Abtheilung der Fabrikdistrikte von Lancashire, Cheshire und Yorkshire 652 Fabriken; von diesen enthielten 570: Dampfwebstühle 85,622, Spindeln (mit Ausschluss der Dublirspindeln) 6,819,146, Pferdekraft in Dampfmaschinen 27,439, in Wasserrädern 1390, beschäftigte Personen 94,119. Im Jahr 1865 dagegen enthielten dieselben Fabriken: Webstühle 95,163, Spindeln 7,025,031, Pferdekraft in Dampfmaschinen 28,925, in Wasserrädern 1445, beschäftigte Personen 88,913. Von 1860 bis 1865 betrug also die Zu
nahme dieser Fabriken an Dampfwebstühlen 11 %, an Spindeln 3 %, an Dampfpferdekraft 5 %, während gleichzeitig die Zahl der beschäftigten Personen um 5,5 % abnahm(FN 227). Zwischen 1852 und 1862 fand beträchtliches Wachsthum der englischen Wollfabrikation statt, während die Zahl der angewandten Arbeiter beinahe stationär blieb. „Diess zeigt, in wie grossem Masse neu eingeführte Maschinerie die Arbeit vorhergehender Perioden verdrängt hatte“(FN 228). In empirisch gegebnen Fällen ist die Zunahme der beschäftigten Fabrikarbeiter oft nur scheinbar, d. h. nicht der Ausdehnung der bereits auf Maschinenbetrieb beruhenden Fabrik geschuldet, sondern der allmäligen Annexation von Nebenzweigen. Z. B. „die Zunahme der mechanischen Webstühle und der durch sie beschäftigten Fabrikarbeiter von 1838—1858 war in der (britischen) Baumwollfabrik einfach der Ausdehnung dieses Geschäftszweigs geschuldet; in den andern Fabriken dagegen der Neuanwendung von Dampfkraft auf den Teppich-, Band-, Leinenwebstuhl u. s. w., die vorher durch menschliche Muskelkraft getrieben wurden“(FN 229). Die Zunahme dieser Fabrikarbeiter war also nur der Ausdruck einer Abnahme in der Gesammtzahl der beschäftigten Arbeiter. Es wird hier endlich ganz davon abgesehen, dass überall, mit Ausnahme der Metallfabriken, jugendliche Arbeiter (unter 18 Jahren), Weiber und Kinder das weit vorwiegende Element des Fabrikpersonals bilden.
Man begreift jedoch, trotz der vom Maschinenbetrieb faktisch verdrängten und virtuell ersetzten Arbeitermasse, wie mit seinem eignen Wachsthum, ausgedrückt in vermehrter Anzahl von Fabriken derselben Art oder den erweiterten Dimensionen vorhandner Fabriken, die Fabrikarbeiter schliesslich zahlreicher sein können als die von ihnen verdrängten Manufakturarbeiter oder Handwerker. Das wöchentlich angewandte Kapital von 500 Pfd. St. bestehe z. B. in der alten Betriebsweise aus ⅖ constantem und ⅗ variablem Bestandtheil, d. h. 200 Pfd. St. seien in Produktionsmitteln ausgelegt, 300 Pfd. St. in Arbeitskraft, sage
1 Pfd. St. per Arbeiter. Mit dem Maschinenbetrieb verwandelt sich die Zusammensetzung des Gesammtkapitals. Es zerfällt jetzt z. B. in ⅘ constanten und ⅕ variablen Bestandtheil, oder es werden nur noch 100 Pfd. St. in Arbeitskraft ausgelegt. Zwei Drittel der früher beschäftigten Arbeiter werden also entlassen. Dehnt sich dieser Fabrikbetrieb aus und wächst, bei sonst gleichbleibenden Produktionsbedingungen, das angewandte Gesammtkapital von 500 auf 1500, so werden jetzt 300 Arbeiter beschäftigt, so viele wie vor der industriellen Revolution. Wächst das angewandte Kapital weiter auf 2000, so werden 400 Arbeiter beschäftigt, also ⅓ mehr als mit der alten Betriebsweise. Absolut ist die angewandte Arbeiterzahl um 100 gestiegen, relativ, d. h. im Verhältniss zum vorgeschossnen Gesammtkapital, ist sie um 800 gefallen, denn das Kapital von 2000 Pfd. St. hätte in der alten Betriebsweise 1200 statt 400 Arbeiter beschäftigt. Relative Abnahme der beschäftigten Arbeiterzahl verträgt sich also mit ihrer absoluten Zunahme. Es wurde oben angenommen, dass mit dem Wachsthum des Gesammtkapitals seine Zusammensetzung constant bleibt, weil die Produktionsbedingungen. Man weiss aber bereits, dass mit jedem Fortschritt des Maschinenwesens der constante, aus Maschinerie, Rohmaterial u. s. w. bestehende Kapitaltheil wächst, während der variable, in Arbeitskraft ausgelegte fällt, und man weiss zugleich, dass in keiner Betriebsweise die Verbesserung so constant, daher die Zusammensetzung des Gesammtkapitals so variabel ist. Dieser beständige Wechsel ist aber ebenso beständig unterbrochen durch Ruhepunkte und bloss quantitative Ausdehnung auf gegebner technologischer Grundlage. Damit wächst die Anzahl der beschäftigten Arbeiter. So betrug die Anzahl aller Arbeiter in den Baumwoll-, Woll-, Worsted-, Flachsund Seidenfabriken des Vereinigten Königreichs 1835 nur 354,684, während 1861 allein die Zahl der Dampfweber (beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen vom 8. Jahr an) 230,654 betrug. Allerdings erscheint diess Wachsthum minder gross, wenn man erwägt, dass die britischen Handbaumwollweber mit den von ihnen selbst beschäftigten Familien 1838 noch 800,000 zählten(FN 230), ganz abgesehn von den in Asien und auf dem europäischen Kontinent Deplacirten.
In den wenigen Bemerkungen, die über diesen Punkt noch zu machen, berühren wir zum Theil rein thatsächlich, so zu sagen exoterisch, Verhältnisse, wozu unsre theoretische Darstellung selbst noch nicht geführt hat.
So lange sich der Maschinenbetrieb in einem Industriezweig auf Kosten des überlieferten Handwerks oder der Manufaktur ausdehnt, sind seine Erfolge so sicher, wie etwa der Erfolg einer mit dem Zündnadelgewehr bewaffneten Armee gegen eine Armee von Bogenschützen wäre. Diese erste Periode, worin die Maschine erst ihren Wirkungskreis erobert, ist entscheidend wichtig wegen der ausserordentlichen Profite, die sie produciren hilft. Diese bilden nicht nur an und für sich eine Quelle beschleunigter Akkumulation, sondern ziehn grossen Theil des beständig neugebildeten und nach neuer Anlage drängenden gesellschaftlichen Zusatzkapitals in die begünstigte Produktionssphäre. Die besondern Vortheile der ersten Sturmund Drangperiode wiederholen sich beständig in den Produktionszweigen, worin die Maschinerie neu eingeführt wird. Sobald aber das Fabrikwesen eine gewisse Breite des Daseins und bestimmten Reifegrad gewonnen hat, sobald namentlich seine eigne technologische Grundlage, die Maschinerie, selbst wieder durch Maschinen producirt wird, sobald Kohlenund Eisengewinnung, wie die Verarbeitung der Metalle und das Transportwesen revolutionirt, überhaupt die der grossen Industrie entsprechenden allgemeinen Produktionsbedingungen hergestellt sind, erwirbt diese Betriebsweise eine Elasticität, eine plötzliche sprungweise Ausdehnungsfähigkeit, die nur an dem Rohmaterial und dem Absatzmarkt Schranken findet. Die Maschinerie bewirkt einerseits direkte Vermehrung des Rohmaterials, wie z. B. der cotton gin die Baumwollproduktion vermehrte(FN 231). Andrerseits sind Wohlfeilheit des Maschinenprodukts und das umgewälzte Transportund Kommunikationswesen Waffen zur Eroberung fremder Märkte. Durch den Ruin ihres handwerks-
mässigen Produkts verwandelt der Maschinenbetrieb sie zwangsweise in Produktionsfelder seines Rohmaterials. So wurde Ostindien zur Produktion von Baumwolle, Wolle, Hanf, Jute, Indigo u. s. w. für Grossbritanien gezwungen(FN 232). Die beständige „Ueberzähligmachung“ der Arbeiter in den Ländern der grossen Industrie befördert treibhausmässige Auswanderung und Kolonisation fremder Länder, die sich in Pflanzstätten für das Rohmaterial des Mutterlands verwandeln, wie Australien z. B. in eine Pflanzstätte von Wolle(FN 233). Es wird eine neue, den Hauptsitzen des Maschinenbetriebs entsprechende internationale Theilung der Arbeit geschaffen, die einen Theil des Erdballs in vorzugsweis agrikoles Produktionsfeld für den andern als vorzugsweis industrielles Produktionsfeld umwandelt. Diese Revolution hängt zusammen mit Umwälzungen in der Agrikultur, die hier noch nicht weiter zu erörtern sind(FN 234).
Die ungeheure, stossweise Ausdehnbarkeit des Fabrikwesens und seine Abhängigkeit vom Weltmarkt erzeugen nothwendig fieberhafte Produktion und darauf folgende Ueberfüllung der Märkte, mit deren Kontraktion Lähmung eintritt. Das Leben der Industrie verwandelt sich in eine Reihenfolge von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Prosperität, Ueberproduktion, Krise und Stagnation. Die Unsicherheit und Unstätigkeit, denen der Maschinenbetrieb die Beschäftigung und damit die Lebenslage des Arbeiters unterwirft, werden normal mit diesem Periodenwechsel des industriellen Cyklus. Die Zeiten der Prosperität abgerechnet, rast zwischen den Kapitalisten heftigster Kampf um ihren individuellen Raumantheil am Markt. Dieser Antheil steht in direktem Verhältniss zur Wohlfeilheit des Produkts. Ausser der hierdurch erzeugten Rivalität im Gebrauch verbesserter, Arbeiter ersetzender Maschinerie und neuer Produktionsmethoden, tritt jedesmal ein Punkt ein, wo Verwohlfeilerung der Waare durch ge-
waltsamen Druck des Arbeitslohnes unter den Werth der Arbeitskraft erstrebt wird(FN 235).
Wachsthum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt durch proportionell viel rascheres Wachsthum des in den Fabriken angelegten Gesammtkapitals. Dieser Prozess vollzieht sich aber nur innerhalb der Ebbund Fluthperioden des industriellen Cyklus. Er wird zudem stets unterbrochen durch den technologischen Fortschritt, der Arbeiter bald virtuell ersetzt, bald faktisch verdrängt. Dieser qualitative Wechsel im Maschinenbetrieb entfernt beständig Arbeiter aus der Fabrik oder verschliesst ihr Thor dem neuen Rekrutenstrom, während die bloss quantitative Ausdehnung der Fabriken neben den Herausgeworfenen frische
Kontingente verschlingt. Die Arbeiter werden so fortwährend repellirt und attrahirt, hinund hergeschleudert, und diess bei beständigem Wechsel in Geschlecht, Alter und Geschick der Angeworbenen.
Die Schicksale des Fabrikarbeiters werden am besten veranschaulicht durch raschen Ueberblick der Schicksale der englischen Baumwollindustrie.
Von 1770 bis 1815 Baumwollindustrie gedrückt oder stagnant 5 Jahre. Während dieser ersten 45jährigen Periode besassen die englischen Fabrikanten das Monopol der Maschinerie und des Weltmarkts. 1815 bis 1821 gedrückt, 1822 und 1823 prosperirend, 1824 Aufhebung der Kombinationsgesetze, allgemeine grosse Ausdehnung der Fabriken, 1825 Krise, 1826 grosses Elend und Aufstände unter den Baumwollarbeitern, 1827 leise Besserung, 1828 grosser Anwachs von Dampfwebstühlen und Ausfuhr, 1829 die Ausfuhr, besonders nach Indien, übergipfelt alle früheren Jahre, 1830 überfüllte Märkte, grosser Nothstand, 1831 bis 1833 fortdauernder Druck; der Handel nach Ostasien (Indien und China) wird dem Monopol der ostindischen Kompagnie entzogen. 1834 grosses Wachsthum von Fabriken und Maschinerie, Mangel an Händen. Das neue Armengesetz befördert die Wanderung der Landarbeiter in die Fabrikdistrikte. Fegung der ländlichen Grafschaften von Kindern. Weisser Sklavenhandel. 1835 grosse Prosperität. Gleichzeitige Todhungerung der Baumwollhandweber. 1836 grosse Prosperität. 1837 und 1838 gedrückter Zustand und Krise. 1839 Wiederaufleben. 1840 grosse Depression, Aufstände, Einschreiten des Militärs. 1841 und 1842 furchtbares Leiden der Fabrikarbeiter. 1842 schliessen die Fabrikanten die Hände von den Fabriken aus, um den Widerruf der Korngesetze zu erzwingen. Die Arbeiter strömen zu vielen Tausenden nach Yorkshire, vom Militär zurückgetrieben, ihre Führer vor’s Gericht zu Lancaster gestellt. 1843 grosses Elend. 1844 Wiederaufleben. 1845 grosse Prosperität. 1846 erst fortdauernder Aufschwung, dann Symptome der Reaktion. Widerruf der Korngesetze. 1847 Krise. Allgemeine Herabsetzung der Löhne um 10 und mehr Procent zur Feier des „big loaf“. 1848 fortdauernder Druck. Manchester unter militärischem Schutz. 1849 Wiederaufleben. 1850 Prosperität. 1851 fallende Waarenpreise, niedrige Löhne, häufige Strikes. 1852 beginnende Verbesserung, Fortdauer der Strikes, Fabri-
kanten drohn mit Import fremder Arbeiter. 1853 steigende Ausfuhr. Achtmonatlicher Strike und grosses Elend zu Preston. 1854 Prosperität, Ueberfüllung der Märkte. 1855 Berichte von Bankerotten strömen ein aus den Vereinigten Staaten, Kanada, ostasiatischen Märkten. 1856 grosse Prosperität. 1857 Krise. 1858 Verbesserung. 1859 grosse Prosperität, Zunahme der Fabriken. 1860 Zenith der englischen Baumwollindustrie. Indische, australische und andere Märkte so überführt, dass sie noch 1863 kaum den ganzen Quark absorbirt haben. Französischer Handelsvertrag. Enormes Wachsthum von Fabriken und Maschinerie. 1861 Aufschwung dauert Zeitlang fort, Reaktion, amerikanischer Bürgerkrieg, Baumwollnoth. 1862 bis 63 vollständiger Zusammenbruch.
Die Geschichte des cotton famine ist zu charakteristisch, um nicht einen Augenblick dabei zu verweilen. Aus den Andeutungen über die Zustände des Weltmarkts 1860 bis 61 ersieht man, dass die Baumwollnoth den Fabrikanten gelegen kam und zum Theil vortheilhaft war, eine Thatsache anerkannt in Berichten der Manchester Handelskammer, im Parlament von Palmerston und Derby proklamirt, durch die Ereignisse bestätigt(FN 236). Allerdings gab es 1861 unter den 2887 Baumwollfabriken des Vereinigten Königreichs viel kleine. Nach dem Bericht des Fabrikinspektors A. Redgrave, dessen Verwaltungsbezirk von jenen 2887 Fabriken 2109 einschliesst, wendeten von letztern 392 oder 19 % nur unter 10 Dampf-Pferdekraft an, 345 oder 16 % 10 und unter 20, und 1372 20 und mehr Pferdekraft(FN 237). Die Mehrzahl der kleinen Fabriken waren Webereien, während der Prosperitätsperiode seit 1858 errichtet, meist durch Spekulanten, wovon der eine das Garn, der andre die Maschinerie, der dritte die Baulichkeit lieferte, unter dem Betrieb ehemaliger overlookers oder andrer unbemittelter Leute. Diese kleinen Fabrikanten gingen meist unter. Dasselbe Schicksal hätte ihnen die durch das Baumwollpech verhinderte Handelskrise bereitet. Obgleich sie ⅓ der Fabrikantenzahl bildeten, absorbirten ihre Fabriken einen ungleich geringeren Theil des in der Baumwollindustrie angelegten Kapitals. Was den Umfang der Lähmung betrifft, so standen nach den authentischen Schätzungen im Oktober 1862 60.3 % der Spindeln und 58 % der Webstühle still.
Diess bezieht sich auf den ganzen Industriezweig und war natürlich sehr modificirt in den einzelnen Distrikten. Nur sehr wenige Fabriken arbeiteten volle Zeit (60 Stunden per Woche), die übrigen mit Unterbrechungen. Selbst für die wenigen Arbeiter, die volle Zeit und zu dem gewohnten Stücklohn beschäftigt, schmälerte sich nothwendig der Wochenlohn in Folge der Ersetzung besserer Baumwolle durch schlechtere, der South Sea Island durch ägyptische (in Feinspinnereien), amerikanischer und ägyptischer durch Surat (ostindisch), und reiner Baumwolle durch Mischungen von Baumwollabfall mit Surat. Die kürzere Fiber der Suratbaumwolle, ihre schmutzige Beschaffenheit, die grössere Brüchigkeit der Fäden, der Ersatz des Mehls durch alle Art schwerer Ingredienzen beim Schlichten des Kettengarns u. s. w. verminderten die Geschwindigkeit der Maschinerie oder die Zahl der Webstühle, die ein Weber überwachen konnte, vermehrten die Arbeit mit den Irrthümern der Maschine und beschränkten mit der Produktenmasse den Stücklohn. Beim Gebrauch von Surat und mit voller Beschäftigung belief sich der Verlust des Arbeiters auf 20, 30 und mehr Procent. Die Mehrzahl der Fabrikanten setzte aber auch die Rate des Stücklohns um 5, 7½ und 10 Procent herab. Man begreift daher die Lage der nur 3, 3½, 4 Tage wöchentlich oder nur 6 Stunden per Tag Beschäftigten. Nachdem schon eine relative Verbesserung eingetreten war, 1863, für Weber, Spinner u. s. w. Wochenlöhne von 3 sh. 4 d., 3 sh. 10 d., 4 sh. 6 d., 5 sh. 1 d. u. s. w.(FN 238). Selbst unter diesen qualvollen Zuständen stand der Erfindungsgeist des Fabrikanten in Lohnabzügen nicht still. Diese wurden zum Theil verhängt als Strafe für die seiner schlechten Baumwolle, unpassenden Maschinerie u. s. w. geschuldeten Fehler des Machwerks. Wo der Fabrikant aber Eigenthümer der cottages der Arbeiter, vergütete er sich selbst für Hausrente durch Abzüge vom nominellen Arbeitslohn. Fabrikinspektor Redgrave erzählt von self-acting minders (sie überwachen ein paar self-acting mules), die „ am Ende vierzehntägiger voller Arbeit 8 sh. 11 d. verdienten und von dieser Summe wurde die Hausrente abgezogen, wovon der Fabrikant jedoch die Hälfte als Geschenk zurückgab, so dass die minders volle 6 sh. 11 d. nach Hause trugen. Der Wochenlohn der Weber rangirte von 2 sh. 6 d. auf-
wärts während der Schlusszeit von 1862“(FN 239). „Selbst dann wurde die Hausmiethe von den Löhnen häufig abgezogen, wenn die Hände nur kurze Zeit arbeiteten“(FN 240). Kein Wunder, dass in einigen Theilen Lancashire’s eine Art Hungerpest ausbrach! Charakteristischer als alles diess aber war es, wie die Revolutionirung des Produktionsprozesses auf Kosten des Arbeiters vor sich ging. Es waren förmliche experimenta in corpore vili, wie die der Anatomen an Fröschen. „Obgleich ich,“ sagt Fabrikinspektor Redgrave, „die wirklichen Einnahmen der Arbeiter in vielen Fabriken gegeben habe, muss man nicht schliessen, dass sie denselben Betrag Woche für Woche beziehn. Die Arbeiter erliegen den grössten Fluktuationen wegen des beständigen Experimentalisirens („ experimentalizing“) der Fabrikanten … ihre Löhne steigen und fallen mit der Qualität des Baumwollgemischs; bald nähern sie sich um 15 % ihren früheren Einnahmen, und die nächste oder zweitfolgende Woche fallen sie um 50 bis 60 %“(FN 241). Diese Experimente wurden nicht nur auf Kosten der Lebensmittel der Arbeiter gemacht. Mit allen ihren fünf Sinnen hatten sie zu büssen. „Die im Oeffnen der Baumwollballen Beschäftigten unterrichten mich, dass der unerträgliche Gestank sie übel macht … Den in den Misch-, Scribblingund Kardirräumen Angewandten irritirt der freigesetzte Staub und Schmutz alle Kopföffnungen, erregt Husten und Schwierigkeit des Athmens … Wegen der Kürze der Fiber wird dem Garn beim Schlichten eine grosse Menge Stoff zugesetzt und zwar allerlei Substitute statt des früher gebrauchten Mehls. Daher Uebelkeit und Dispepsie der Weber. Bronchitis herrscht vor wegen des Staubs, ebenso Halsentzündung, ferner eine Hautkrankheit in Folge der Irritation der Haut durch den im Surat enthaltenen Schmutz.“ Andrerseits waren die Substitute für Mehl ein Fortunatussäckel für die Herrn Fabrikanten durch Vermehrung des Garngewichts. Sie machten „15 Pfund Rohmaterial, wenn verwebt, 20 Pfund wiegen“(FN 242). In dem Bericht der Fabrikinspektoren vom 30. April 1864 liest man: „Die Industrie verwerthet diese Hilfsquelle jetzt in wahrhaft unanständigem Mass. Ich weiss
von guter Autorität, dass achtpfündiges Geweb von 5¼ Pfund Baumwolle und 2¾ Pfund Schlichte gemacht wird. Ein andres 5¼pfündiges Geweb enthielt zwei Pfund Schlichte. Diess waren ordinäre Shirtings für den Export. In andern Arten wurden manchmal 50 % Schlichte zugesetzt, so dass Fabrikanten sich rühmen können und sich auch wirklich rühmen, dass sie reich werden durch den Verkauf von Geweben für weniger Geld als das nominell in ihnen enthaltene Garn kostet“(FN 243). Die Arbeiter aber hatten nicht nur unter den Experimenten der Fabrikanten in den Fabriken, und der Municipalitäten ausserhalb der Fabriken, nicht nur von Lohnherabsetzung und Arbeitslosigkeit, von Mangel und Almosen, von den Elogen der Lords und Unterhäusler zu leiden. „Unglückliche Frauenzimmer, beschäftigungslos in Folge der Baumwollnoth, wurden Auswürflinge der Gesellschaft und blieben es ‥ Die Zahl junger Prostituirten hat mehr zugenommen als seit den letzten 25 Jahren“(FN 244).
Man findet also in den ersten 45 Jahren der britischen Baumwollindustrie, von 1770—1815, nur 5 Jahre der Krise und Stagnation, aber diess war die Periode ihres Weltmonopols. Die zweite 48jährige Periode von 1815—1863 zählt nur 20 Jahre des Wiederauflebens und der Prosperität auf 28 Jahre des Drucks und der Stagnation. Von 1815—1830 beginnt die Konkurrenz mit dem kontinentalen Europa und den Vereinigten Staaten. Seit 1833 wird Ausdehnung der asiatischen Märkte erzwungen durch „Zerstörung der Menschenrace“. Seit Widerruf der Korngesetze, von 1846—1863, auf 8 Jahre mittlerer Lebendigkeit und Prosperität 9 Jahre Druck und Stagnation. Die Lage der erwachsnen männlichen Baumwoll-Arbeiter, selbst während der Prosperitätszeit, zu beurtheilen aus der beigefügten Note(FN 245).
Man hat gesehn, wie die Maschinerie die auf dem Handwerk beruhende
Cooperation und die auf Theilung der handwerksmässigen Arbeit beruhende Manufaktur aufhebt. Ein Beispiel der ersten Art ist die Mähmaschine, sie ersetzt die Cooperation von Mähern. Ein schlagendes Beispiel der zweiten Art ist die Maschine zur Fabrikation von Nähnadeln. Nach Adam Smith verfertigten zu seiner Zeit 10 Männer durch Theilung der Arbeit täglich über 48,000 Nähnadeln. Eine einzige Maschine liefert dagegen 145,000 in einem Arbeitstag von 11 Stunden. Eine Frau oder ein Mädchen überwacht im Durchschnitt 4 solche Maschinen und producirt daher mit der Maschinerie täglich an 600,000, in der Woche über 3,000,000 Nähnadeln(FN 246). Sofern eine einzelne Arbeitsmaschine an die Stelle der Cooperation oder der Manufaktur tritt, kann sie selbst wieder zur Grundlage handwerksmässigen Betriebs werden. Indess bildet diese auf Maschinerie beruhende Reproduktion des Handwerksbetriebs nur den Uebergang zum Fabrikbetrieb, der in der Regel jedesmal eintritt, sobald mechanische Triebkraft, Dampf oder Wasser, die menschlichen Muskeln in der Bewegung der Maschine ersetzt. Sporadisch und eben-
falls nur vorübergehend kann kleiner Betrieb sich verbinden mit mechanischer Triebkraft durch Miethe des Dampfs, wie in einigen Manufakturen Birmingham’s, durch Gebrauch kleiner kalorischer Maschinen, wie in gewissen Zweigen der Weberei u. s. w.(FN 247). In der Seidenweberei zu Coventry entwickelte sich naturwüchsig das Experiment der „ Cottage-Fabriken“. In der Mitte von Cottage-Reihen, quadratmässig gebaut, wurde ein s. g. Engine House errichtet für die Dampfmaschine und diese durch Schäfte mit den Webstühlen in den cottages verbunden. In allen Fällen war der Dampf gemiethet, z. B. zu 2½ sh. per Webstuhl. Diese Dampfrente war wöchentlich zahlbar, die Webstühle mochten laufen oder nicht. Jede cottage enthielt 2—6 Webstühle, den Arbeitern gehörig, oder auf Kredit gekauft, oder gemiethet. Der Kampf zwischen der Cottage-Fabrik und der Fabrik per se währte über 12 Jahre. Er hat geendet mit dem gänzlichen Ruin der 300 cottage factories(FN 248). Wo die Natur des Prozesses nicht von vorn herein Produktion auf grosser Stufenleiter bedang, durchliefen in der Regel die in den letzten Decennien neu aufkommenden Industrieen, wie z. B. Enveloppe-, Stahlfedermachen u. s. w., erst den Handwerksbetrieb und dann den Manufakturbetrieb als kurzlebige Uebergangsphasen zum Fabrikbetrieb. Diese Metamorphose bleibt dort am schwierigsten, wo die manufakturmässige Produktion des Machwerks keine Stufenfolge von Entwicklungsprozessen, sondern eine Vielheit disparater Prozesse einschliesst. Diess bildete z. B. ein grosses Hinderniss der Stahlfederfabrik. Jedoch wurde schon vor ungefähr anderthalb Decennien ein Automat erfunden, der 6 disparate Prozesse auf einen Schlag verrichtet. Das Handwerk lieferte die ersten 12 Dutzend Stahlfedern 1820 zu 7 Pfd. St. 4 sh., die Manufaktur lieferte sie 1830 zu 8 sh., und die Fabrik liefert sie heute dem Grosshandel zu 2 bis 6 d.(FN 249)
Mit der Entwicklung des Fabrikwesens und der sie begleitenden Umwälzung der Agrikultur dehnt sich nicht nur die Produktionsleiter in allen andern Industriezweigen aus, sondern verändert sich auch ihr Charakter. Das Princip des Maschinenbetriebs, den Produktionsprozess in seine konstituirenden Phasen zu analysiren und die so gegebnen Probleme durch Anwendung der Mechanik, Chemie u. s. w., kurz der Naturwissenschaften zu lösen, wird überall bestimmend. Maschinerie drängt sich daher bald für diesen, bald für jenen Theilprozess in die Manufakturen. Die feste Krystallisation ihrer Gliederung, der alten Theilung der Arbeit entstammend, löst sich damit auf und macht fortwährendem Wechsel Platz. Abgesehn hiervon wird die Zusammensetzung des Gesammtarbeiters oder des kombinirten Arbeitspersonals von Grund aus umgewälzt. Im Gegensatz zur Manufakturperiode gründet sich der Plan der Arbeitstheilung jetzt auf Anwendung der Weiberarbeit, der Arbeit von Kindern aller Altersstufen, ungeschickter Arbeiter, wo es immer thubar, kurz der „ cheap labour“, wohlfeilen Arbeit, wie der Engländer sie charakteristisch nennt. Diess gilt nicht nur für alle auf grosser Stufenleiter kombinirte Produktion, ob sie Maschinerie anwende oder nicht, sondern auch für die s. g. Hausindustrie, ob ausgeübt in den Privatwohnungen der Arbeiter oder in kleinen Werkstätten. Diese s. g. moderne Hausindustrie hat mit der altmodischen, die unabhängiges städtisches Handwerk, selbstständige Bauernwirthschaft und vor allem ein Haus der Arbeiterfamilie voraussetzt, nichts gemein als den Namen. Sie ist jetzt verwandelt in das auswärtige Departement der Fabrik, der Manufaktur oder des Waarenmagazins. Neben den Fabrikarbeitern, Manufakturarbeitern und Handwerkern, die es in grossen Massen räumlich koncentrirt und direkt kommandirt, bewegt das Kapital durch unsichtbare Fäden eine andre Armee in den grossen Städten und über das flache Land zerstreuter Hausarbeiter. Beispiel: die Hemdenfabrik der Herrn Tillie zu Londonderry, Irland, die 1000 Fabrikarbeiter und 9000 auf dem Land zerstreute Hausarbeiter beschäftigt(FN 250).
Die Exploitation wohlfeiler und unreifer Arbeitskräfte wird in der
modernen Manufaktur schamloser als in der eigentlichen Fabrik, weil die hier existirende, technologische Grundlage, Ersatz der Muskelkraft durch Maschinen und Leichtigkeit der Arbeit, dort grossentheils wegfällt, zugleich der weibliche oder noch unreife Körper den Einflüssen giftiger Substanzen u. s. w. aufs gewissenloseste preisgegeben wird. Sie wird in der s. g. Hausarbeit schamloser als in der Manufaktur, weil die Widerstandsfähigkeit der Arbeiter mit ihrer Zersplitterung abnimmt, eine ganze Reihe räuberischer Parasiten sich zwischen den eigentlichen Arbeitgeber und den Arbeiter drängt, die Hausarbeit überall mit Maschinenoder wenigstens Manufakturbetrieb in demselben Produktionszweig kämpft, die Armuth den Arbeiter der nöthigsten Arbeitsbedingungen, Raum, Licht, Ventilation u. s. w. beraubt, die Unregelmässigkeit der Beschäftigung wächst, und endlich in diesen letzten Zufluchtsstätten der durch die grosse Industrie und Agrikultur „überzählig“ Gemachten die Arbeiterkonkurrenz nothwendig ihr Maximum erreicht. Die durch den Maschinenbetrieb erst systematisch ausgebildete Oekonomisirung der Produktionsmittel, von vorn herein zugleich rücksichtsloseste Verschwendung der Arbeitskraft und Raub an den normalen Voraussetzungen der Arbeitsfunktion, kehrt jetzt diese ihre antagonistische und menschenmörderische Seite um so mehr heraus, je weniger in einem Industriezweig die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit und die technologische Grundlage kombinirter Arbeitsprozesse entwickelt sind.
Ich will nun an einigen Beispielen die oben aufgestellten Sätze erläutern. Der Leser kennt in der That schon massenhafte Belege aus dem Abschnitt über den Arbeitstag. Die Metallmanufakturen in Birmingham und Umgegend wenden grossentheils für sehr schwere Arbeit 30,000 Kinder und junge Personen nebst 10,000 Weibern an. Man findet sie hier in den gesundheitswidrigen Gelbgiessereien, Knopffabriken, Glasur-, Galvanisirungsund Lackirarbeiten(FN 251). Die Arbeitsexcesse für Erwachsne und Unerwachsne haben verschiedenen Londoner Zeitungsund Buchdruckereien den rühmlichen Namen: „ Das Schlachthaus“ gesichert(FN 251a). Dieselben Excesse, deren Schlachtopfer hier namentlich Weiber,
Mädchen und Kinder, in der Buchbinderei. Schwere Arbeit für Unerwachsne in den Seilereien, Nachtarbeit in Salzwerken, Lichterund andren chemischen Fabriken; mörderischer Verbrauch von Jungen in Seidenwebereien, die nicht mechanisch betrieben werden, zum Drehen der Webstühle(FN 252). Eine der infamsten, schmutzigsten und schlecht bezahltesten Arbeiten, wozu mit Vorliebe junge Mädchen und Weiber verwandt werden, ist das Sortiren der Lumpen. Man weiss, dass Grossbritanien, abgesehn von seinen eignen unzähligen Lumpen, das Emporium für den Lumpenhandel der ganzen Welt bildet. Sie strömen dahin von Japan, den entferntesten Staaten Südamerikas und den kanarischen Inseln. Ihre Hauptzufuhrquellen aber sind Deutschland, Frankreich, Russland, Italien, Aegypten, Türkei, Belgien und Holland. Sie dienen zur Düngung, Fabrikation von Flocken (für Bettzeug), Shoddy, und als Rohmaterial des Papiers. Die weiblichen Lumpensortirer dienen als Mediums, um Pocken und andre ansteckende Seuchen, deren erste Opfer sie selbst sind, zu colportiren(FN 253). Als klassisches Beispiel für Ueberarbeit, schwere und unpassende Arbeit, und daher folgende Brutalisirung der von Kindesbeinen an konsumirten Arbeiter kann, neben der Minenund Kohlenproduktion, die Ziegeloder Backsteinmacherei gelten, wozu in England nur noch sporadisch die neuerfundne Maschinerie angewandt wird. Zwischen Mai und September dauert die Arbeit von 5 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, und, wo Trocknung in freier Luft stattfindet, oft von 4 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Der Arbeitstag von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends gilt für „ reducirt“, „ mässig“. Kinder beiderlei Geschlechts werden vom 6. und selbst vom 4. Jahr an verwandt. Sie arbeiten dieselbe Stundenzahl, oft mehr als die Erwachsnen. Die Arbeit ist hart und die Sommerhitze steigert noch die Erschöpfung. In einer Ziegelei zu Mosley z. B. machte ein 24jähriges Mädchen 2000 Ziegel täglich, unterstützt von zwei unerwachsnen Mädchen als Gehilfen, welche den Lehm trugen und die Ziegelsteine aufhäuften. Diese Mädchen schleppten täglich 10 Tonnen die schlüpfrigen Seiten der Ziegelgrube von einer Tiefe von
30 Fuss herauf und über eine Entfernung von 210 Fuss. „Es ist unmöglich für ein Kind durch das Fegfeuer einer Ziegelei zu passiren ohne grosse moralische Degradation. . . . Die nichtswürdige Sprache, die sie vom zartesten Alter an zu hören bekommen, die unfläthigen, unanständigen und schamlosen Gewohnheiten, unter denen sie unwissend und verwildert aufwachsen, machen sie für die spätere Lebenszeit gesetzlos, verworfen, liederlich. . . . Eine furchtbare Quelle der Demoralisation ist die Art der Wohnlichkeit. Jeder moulder (der eigentlich geschickte Arbeiter und Chef einer Arbeiterg ruppe) liefert seiner Bande von 7 Personen Logis und Tisch in seiner Hütte oder cottage. Ob zu seiner Familie gehörig oder nicht, Männer, Jungen, Mädchen schlafen in der Hütte. Diese besteht gewöhnlich aus 2, nur ausnahmsweis aus 3 Zimmern, alle auf dem Erdgeschoss, mit wenig Ventilation. Die Körper sind so erschöpft durch die grosse Transpiration während des Tags, dass weder Gesundheitsregeln, Reinlichkeit noch Anstand irgendwie beobachtet werden. Viele dieser Hütten sind wahre Modelle von Unordnung, Schmutz und Staub. . . . Das grösste Uebel des Systems, welches junge Mädchen zu dieser Art Arbeit verwendet, besteht darin, dass es sie in der Regel von Kindheit an für ihr ganzes späteres Leben an das verworfenste Gesindel festkettet. Sie werden rohe, bösmäulige Buben („rough, foul-mouthed boys“), bevor die Natur sie gelehrt hat, dass sie Weiber sind. Gekleidet in wenige schmutzige Lumpen, die Beine weit über das Knie entblösst, Haar und Gesicht mit Dreck beschmiert, lernen sie alle Gefühle der Bescheidenheit und der Scham mit Verachtung behandeln. Während der Essenszeit liegen sie auf den Feldern ausgestreckt oder gucken den Jungen zu, die in einem benachbarten Kanal baden. Ist ihr schweres Tagwerk endlich vollbracht, so ziehn sie bessere Kleider an und begleiten die Männer in Bierkneipen.“ Dass die grösste Versoffenheit von Kindesbeinen an in dieser ganzen Klasse herrscht, ist nur naturgemäss. „Das Schlimmste ist, dass die Ziegelmacher an sich selbst verzweifeln. Sie könnten, sagte einer der Besseren zum Kaplan von Southallfields, ebensowohl versuchen den Teufel zu erheben und zu bessern als einen Ziegler, mein Herr!“ („You might as well try to raise and improve the devil as a brickie, Sir!“)(FN 254)
Ueber die kapitalistische Oekonomisirung der Arbeitsbedingungen in der modernen Manufaktur (worunter hier alle Werkstätten auf grosser Stufenleiter, ausser eigentlichen Fabriken, zu verstehn) findet man officielles und reichlichstes Material in dem IV. (1861) und VI. (1864) „ Public Health Report“. Die Beschreibung der workshops (Arbeitslokale) namentlich der Londoner Drucker und Schneider überbietet die ekelhaftesten Phantasieen unsrer Romanschreiber. Die Wirkung auf den Gesundheitszustand der Arbeiter ist selbstverständlich. Dr. Simon, der oberste ärztliche Beamte des Privy Council und officielle Herausgeber der „Public Health Reports“, sagt u. a.: „In meinem vierten Bericht (1863) zeigte ich, wie es für die Arbeiter praktisch unmöglich ist darauf zu bestehen, was ihr erstes Gesundheitsrecht ist, das Recht, dass zu welchem Werk immer ihr Anwender sie versammelt, die Arbeit, so weit es von ihm abhängt, von allen vermeidbaren gesundheitswidrigen Umständen befreit sein soll. Ich wies nach, dass während die Arbeiter praktisch unfähig sind, sich selbst diese Gesundheitsjustiz zu verschaffen, sie keinen wirksamen Beistand von den bestallten Administratoren der Gesundheitspolizei erlangen können. . . . Das Leben von Myriaden von Arbeitern und Arbeiterinnen wird jetzt nutzlos torturirt und verkürzt durch das endlose physische Leiden, welches ihre blosse Beschäftigung erzeugt“(FN 255). Zur Illustration des Einflusses der Arbeitslokale auf den Gesundheitszustand giebt Dr. Simon folgende Sterblichkeitsliste:
Ich wende mich jetzt zur s. g. Hausarbeit. Um sich eine Vorstellung von dieser auf dem Hintergrund der grossen Industrie aufgebauten Exploitationssphäre des Kapitals und ihren Ungeheuerlichkeiten zu machen, betrachte man z. B. die scheinbar ganz idyllische, in einigen abgelegnen Dörfern Englands betriebne Nägelmacherei(FN 257). Hier genügen einige Beispiele aus den noch gar nicht maschinenmässig betriebnen oder mit Maschinenund Manufakturtrieb konkurrirenden Zweigen der Spitzenfabrik und Strohflechterei.
Von den 150,000 Personen, die in der englischen Spitzenproduktion beschäftigt, fallen ungefähr 10,000 unter die Botmässigkeit des Fabrikakts von 1861. Die ungeheure Mehrzahl der übrig bleibenden 140,000 sind Weiber, junge Personen und Kinder beiderlei Geschlechts, obgleich das männliche Geschlecht nur schwach vertreten ist. Der Gesundheitszustand dieses „wohlfeilen“ Exploitationsmaterials ergiebt sich aus folgender Aufstellung des Dr. Trueman, Arzt beim General Dispensary von Nottingham. Von je 686 Patienten, Spitzenmacherinnen, meist zwischen dem 17. und 24. Jahr, waren schwindsüchtig:
Dieser Fortschritt in der Rate der Schwindsucht muss dem optimistischsten Fortschrittler und lügenfauchendsten deutschen Freihandelshausirburschen genügen.
Der Fabrikakt von 1861 regelt das eigentliche Machen der Spitzen, soweit es durch Maschinerie geschieht, und diess ist die Regel in England. Die Zweige, die wir hier kurz berücksichtigen, und zwar nicht,
soweit die Arbeiter in Manufakturen, Waarenhäusern u. s. w. koncentrirt, sondern nur sofern sie s. g. Hausarbeiter sind, zerfallen 1) in das finishing (letztes Zurechtmachen der maschinenmässig fabricirten Spitzen, eine Kategorie, die wieder zahlreiche Unterabtheilungen einschliesst), 2) Spitzenklöppeln.
Das Lace finishing wird als Hausarbeit betrieben entweder in s. g. „ Mistresses Houses“ oder von Weibern, einzeln oder mit ihren Kindern, in ihren Privatwohnungen. Die Weiber, welche die „Mistresses Houses“ halten, sind selbst arm. Das Arbeitslokal bildet Theil ihrer Privatwohnung. Sie erhalten Aufträge von Fabrikanten, Besitzern von Waarenmagazinen u. s. w. und wenden Weiber, Mädchen und junge Kinder an, je nach dem Umfang ihrer Zimmer und der fluktuirenden Nachfrage des Geschäfts. Die Zahl der beschäftigten Arbeiterinnen wechselt von 20 zu 40 in einigen, von 10 zu 20 in andern dieser Lokale. Das durchschnittliche Minimalalter, worin Kinder beginnen, ist 6 Jahre, manche jedoch unter 5 Jahren. Die gewöhnliche Arbeitszeit währt von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, mit 1½ Stunden für Mahlzeiten, die unregelmässig und oft iu den stinkigen Arbeitslöchern selbst genommen werden. Bei gutem Geschäft währt die Arbeit oft von 8 Uhr (manchmal 6 Uhr) Morgens bis 10, 11 oder 12 Uhr Nachts. In englischen Kasernen beträgt der vorschriftsmässige Raum für jeden Soldaten 500—600 Kubikfuss, in den Militärlazarethen 1200. In jenen Arbeitslöchern kommen 67—100 Kubikfuss auf jede Person. Gleichzeitig verzehrt Gaslicht den Sauerstoff der Luft. Um die Spitzen rein zu halten, müssen die Kinder oft die Schuhe ausziehn, auch im Winter, obgleich das Estrich aus Pflaster oder Ziegeln besteht. „Es ist nichts ungewöhnliches in Nottingham 14 bis 20 Kinder in einem kleinen Zimmer von vielleicht nicht mehr als 12 Quadratfuss zusammengepökelt zu finden, während 15 Stunden aus 24 beschäftigt an einer Arbeit, an sich selbst erschöpfend durch Ueberdruss und Monotonie, zudem unter allen nur möglichen gesundheitszerstörenden Umständen ausgeübt … Selbst die jüngsten Kinder arbeiten mit einer gespannten Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit, die erstaunlich sind, fast niemals ihren Fingern Ruhe oder langsamere Bewegung gönnend. Richtet man Fragen an sie, so erheben sie das Auge nicht von der Arbeit, aus Furcht einen Moment zu verlieren.“ Der „ lange Stock“ dient den „mistresses“ als Anregungsmittel im Verhältniss, worin die Arbeitszeit ver-
längert wird. „Die Kinder ermüden allmälig und werden so rastlos wie Vögel gegen das Ende ihrer langen Gebundenheit an eine Beschäftigung, eintönig, für die Augen angreifend, erschöpfend durch die Uniformität der Körperhaltung. Es ist wahres Sklavenwerk.“ („Their work like slavery“(FN 259).) Wo Frauen mit ihren eigenen Kindern zu Hause, d. h. im modernen Sinn, in einem gemietheten Zimmer, häufig in einer Dachstube arbeiten, sind die Zustände wo möglich noch schlimmer. Diese Art Arbeit wird 80 Meilen im Umkreis von Nottingham ausgegeben. Wenn das in den Waarenhäusern beschäftigte Kind sie 9 oder 10 Uhr Abends verlässt, giebt man ihm oft noch ein Bündel mit auf den Weg, um es zu Haus fertig zu machen. Der kapitalistische Pharisäer, vertreten durch einen seiner Lohnknechte, thut das natürlich mit der salbungsvollen Phrase: ‚das sei für Mutter‘, weiss aber sehr wohl, dass das arme Kind aufsitzen und helfen muss(FN 260).
Die Industrie des Spitzenklöppelns wird hauptsächlich in zwei englischen Agrikulturdistrikten betrieben, dem Honiton Spitzendistrikt, 20 bis 30 Meilen längs der Südküste von Devonshire, mit Einschluss weniger Plätze von Nord-Devon, und einem andern Distrikt, der grossen Theil der Grafschaften von Buckingham, Bedford, Northampton und die benachbarten Theile von Oxfordshire und Huntingdonshire umfasst. Die cottages der Ackerbautaglöhner bilden durchschnittlich die Arbeitslokale. Manche Manufakturherrn wenden über 3000 dieser Hausarbeiter an, hauptsächlich Kinder und junge Personen, ausschliesslich weiblichen Geschlechts. Die beim Lace finishing beschriebenen Zustände wiederholen sich. Nur treten an die Stelle der „mistresses houses“ die s. g. „ lace schools“ (Spitzenschulen), gehalten von armen Weibern in ihren Hütten. Vom 5. Jahr an, manchmal jünger, bis zum 12. oder 15. arbeiten die Kinder in diesen Schulen, während des ersten Jahres die Jüngsten von 4 bis 8 Stunden, später von 6 Uhr Morgens bis 8 und 10 Uhr Abends. „Die Zimmer sind im allgemeinen gewöhnliche Wohnstuben kleiner cottages, der Kamin zugestopft zur Abwehr von Luftzug, die Insassen manchmal auch im Winter nur von ihrer eignen animalischen Wärme geheizt. In andern Fällen sind diese s. g. Schulzimmer kleinen Vorraths-
kammern ähnliche Räume, ohne Feuerplatz … Die Ueberfüllung dieser Löcher und die dadurch producirte Luftverpestung sind oft extrem. Dazu kömmt die schädliche Wirkung von Gerinnen, Kloaken, verwesenden Stoffen und anderem Unrath, gewöhnlich in den Zugängen zu kleineren cottages.“ Mit Bezug auf den Raum: „In einer Spitzenschule 18 Mädchen und Meisterin, 35 Kubikfuss für jede Person; in einer andern, wo unerträglicher Gestank, 18 Personen, per Kopf 24½ Kubikfuss. Man findet in dieser Industrie Kinder von 2 und 2½ Jahren verwandt“(FN 261).
Wo das Spitzenklöppeln in den ländlichen Grafschaften von Buckingham und Bedford aufhört, beginnt die Strohflechterei. Sie erstreckt sich über grossen Theil von Hertfordshire und die westlichen und nördlichen Theile von Essex. Es waren 1861 beschäftigt im Strohflechten und Strohhutmachen 40,043 Personen, 3815 davon männlichen Geschlechts aller Altersstufen, die andern weiblichen Geschlechts, und zwar 14,913 unter 20 Jahren, davon an 7000 Kinder. An die Stelle der Spitzenschulen treten hier die „ straw plait schools“ (Strohflechtschulen). Die Kinder beginnen hier den Unterricht im Strohflechten gewöhnlich vom 4., manchmal zwischen dem 3. und 4. Jahr Erziehung erhalten sie natürlich keine. Die Kinder selbst nennen die Elementarschulen „ natural schools“ (natürliche Schulen) im Unterschied zu diesen Blutaussaugungsanstalten, worin sie einfach an der Arbeit gehalten werden, um das von ihren halbverhungerten Müttern vorgeschriebne Machwerk, meist 30 Yards per Tag, zu verfertigen. Diese Mütter lassen sie dann oft noch zu Haus bis 10, 11, 12 Uhr Nachts arbeiten. Das Stroh schneidet ihnen Finger und Mund, durch den sie es beständig anfeuchten. Nach der von Dr. Ballard resumirten Gesammtansicht der medizinischen Beamten Londons bilden 300 Kubikfuss den Minimalraum für jede Person in einem Schlafoder Arbeitszimmer. In den Strohflechtschulen ist der Raum aber noch spärlicher zugemessen als in den Spitzenschulen, „12⅔, 17, 18½ und unter 22 Kubikfuss für jede Person.“ Die kleineren dieser Zahlen, sagt Kommissair White, „repräsentiren weniger Raum als die Hälfte von dem, den ein Kind einnehmen würde, wenn verpackt in eine Schachtel von 3 Fuss nach allen Dimensionen.“ Diess der Lebensgenuss der Kinder bis zum 12. oder 14. Jahr. Die elenden, verkommenen
Eltern sinnen nur darauf aus den Kindern so viel als möglich herauszuschlagen. Aufgewachsen fragen die Kinder natürlich keinen Deut nach den Eltern und verlassen sie. „Es ist kein Wunder, dass Unwissenheit und Laster überströmen in einer so aufgezüchteten Bevölkerung … Ihre Moral steht auf der niedrigsten Stufe . . . . Eine grosse Anzahl der Weiber hat illegitime Kinder und manche in so unreifem Alter, dass selbst die Vertrauten der Kriminalstatistik darüber erstarren“(FN 262). Und das Heimathsland dieser Musterfamilien ist, so sagt der sicher im Christenthum kompetente Graf Montalembert, Europa’s christliches Musterland!
Der Arbeitslohn, in den eben behandelten Industriezweigen überhaupt jämmerlich (der ausnahmsweise Maximallohn der Kinder in den Strohflechtschulen 3 sh.), wird noch tief unter seinen Nominalbetrag herabgedrückt durch das namentlich in den Spitzendistrikten allgemein vorherrschende Trucksystem(FN 263).
Die Verwohlfeilerung der Arbeitskraft durch blossen Missbrauch weiblicher und unreifer Arbeitskräfte, blossen Raub aller normalen Arbeitsund Lebensbedingungen, und blosse Brutalität der Ueberund Nachtarbeit, stösst zuletzt auf gewisse nicht weiter überschreitbare Naturschranken, also auch die auf diesen Grundlagen beruhende Verwohlfeilerung der Waaren und kapitalistische Exploitation überhaupt. Sobald dieser Punkt endlich erreicht ist, und es dauert lange, schlägt die Stunde für Einführung der Maschinerie und die nun rasche Verwandlung der zersplitterten Hausarbeit (oder auch Manufaktur) in Fabrikbetrieb.
Das kolossalste Beispiel dieser Bewegung liefert die Produktion von „ Wearing Apparel“ (zum Anzug gehörige Artikel). Nach der Klassifikation der „ Child. Empl. Comm.“ umfasst diese Industrie Strohhutund Damenhutmacher, Kappenmacher, Schneider, milliners und dressmakers(FN 264), Hemdenmacher und Nätherinnen, Korsetten-, Handschuh-, Schuhmacher, nebst vielen kleineren Zweigen, wie Fabrikation von Kravatten, Hals-
bändern u. s. w. Das in England und Wales in diesen Industrieen beschäftigte weibliche Personal betrug 1861: 586,298, wovon mindestens 115,242 unter 20, 16,650 unter 15 Jahren. Zahl dieser Arbeiterinnen im Vereinigten Königreich (1861): 750,334. Die Zahl der gleichzeitig in Hut-, Schuh-, Handschuhmacherei und Schneiderei beschäftigten männlichen Arbeiter in England und Wales: 437,969, wovon 14,964 unter 15 Jahren, 89,285 fünfzehnbis zwanzigjährig, 333,117 über 20 Jahren. Es fehlen in dieser Angabe viele hierher gehörige kleinere Zweige. Nehmen wir aber die Zahlen, wie sie stehn, so ergiebt sich für England und Wales allein, nach dem Census von 1861, eine Summe von 1,024,277 Personen, also ungefähr so viel wie Ackerbau und Viehzucht absorbiren. Man fängt an zu verstehn, wozu die Maschinerie so ungeheure Produktenmassen hervorzaubern und so ungeheure Arbeitermassen „ freisetzen“ hilft.
Die Produktion des „Wearing Apparel“ wird betrieben durch Manufakturen, welche in ihrem Innern nur die Theilung der Arbeit reproducirten, deren membra disjecta sie fertig vorfanden, durch kleinere Handwerksmeister, die aber nicht wie früher für individuelle Konsumenten, sondern für Manufakturen und Waarenmagazine arbeiten, so dass oft ganze Städte und Landstriche solche Zweige wie Schusterei u. s. w. als Specialität ausüben, endlich im grössten Umfang durch s. g. Hausarbeiter, welche das auswärtige Departement der. Manufakturen, Waarenmagazine und selbst der kleineren Meister bilden(FN 265). Die Masse des Arbeitsstoffs, Rohstoffe, Halbfabrikate u. s. w. liefert die grosse Industrie, die Masse des wohlfeilen Menschenmaterials (taillable à merci et misericorde) die durch grosse Industrie und Agrikultur „Freigesetzten“. Die Manufakturen dieser Sphäre verdankten ihren Ursprung hauptsächlich dem Bedürfniss des Kapitalisten eine jeder Bewegung der Nachfrage entsprechende schlagfertige Armee unter der Hand zu haben(FN 266). Diese
Manufakturen liessen jedoch neben sich den zerstreuten handwerksmässigen und Hausbetrieb als breite Grundlage fortbestehn. Die grosse Produktion von Mehrwerth in diesen Arbeitszweigen, zugleich mit der progressiven Verwohlfeilerung ihrer Artikel, war und ist hauptsächlich geschuldet dem Minimum des zu kümmerlicher Vegetation nöthigen Arbeitslohns, verbunden mit dem Maximum menschenmöglicher Arbeitszeit. Es war eben die Wohlfeilheit des in Waare verwandelten Menschenschweisses und Menschenbluts, welche den Absatzmarkt beständig erweiterte und täglich erweitert, für England namentlich auch den Kolonialmarkt, wo überdem englische Gewohnheit und Geschmack vorherrschen. Endlich trat ein Knotenpunkt ein. Die Grundlage der alten Methode, bloss brutale Ausbeutung des Arbeitermaterials, mehr oder minder begleitet von systematisch entwickelter Arbeitstheilung, genügte dem wachsenden Markt und der noch rascher wachsenden Konkurrenz der Kapitalisten nicht länger. Die Stunde der Maschinerie schlug. Die entscheidend revolutionäre Maschine, welche die sämmtlichen zahllosen Zweige dieser Produktionssphäre, wie Putzmacherei, Schneiderei, Schusterei, Nätherei, Hutmacherei u. s. w. gleichmässig ergreift, ist die — Nähmaschine.
Ihre unmittelbare Wirkung auf die Arbeiter ist ungefähr die aller Maschinerie, welche in der Periode der grossen Industrie neue Geschäftszweige erobert. Kinder im unreifsten Alter werden entfernt. Der Lohn der Maschinenarbeiter steigt verhältnissmässig zu dem der Hausarbeiter, wovon viele zu „den Aermsten der Armen“ („the poorest of the poor“) gehören. Der Lohn der besser gestellten Handwerker, mit denen die Maschine konkurrirt, sinkt. Die neuen Maschinenarbeiter sind ausschliesslich Mädchen und junge Frauen. Mit Hilfe der mechanischen Kraft vernichten sie das Monopol der männlichen Arbeit in schwererem Werk und verjagen aus leichterem Massen alter Weiber und unreifer Kinder. Die übermächtige Konkurrenz erschlägt die schwächsten Handarbeiter. Das gräuliche Wachsthum des Hungertods ( death from starvation) in London während des letzten Decenniums läuft parallel mit der Ausdehnung der Maschinennäherei(FN 267). Die neuen Arbeiterinnen
an der Nähmaschine, welche von ihnen mit Hand und Fuss oder mit der Hand allein, sitzend und stehend, je nach Schwere, Grösse und Specialität der Maschine, bewegt wird, verausgaben grosse Arbeitskraft. Ihre Beschäftigung wird gesundheitswidrig durch die Dauer des Prozesses, obgleich er meist kürzer als im alten System. Ueberall, wo die Nähmaschine, wie beim Schuh-, Korsett-, Hutmachen u. s. w., ohnehin enge und überfüllte Werkstätten heimsucht, vermehrt sie die gesundheitswidrigen Einflüsse. „Die Wirkung,“ sagt Kommissär Lord, „beim Eintritt in niedrig gestochne Arbeitslokale, wo 30 bis 40 Maschinenarbeiter zusammenwirken, ist unerträglich . . . . Die Hitze, theilweis den Gasöfen zur Wärmung der Bügeleisen geschuldet, ist schrecklich . . . . Wenn selbst in solchen Lokalen s. g. mässige Arbeitsstunden, d. h. von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, vorherrschen, fallen dennoch jeden Tag 3 oder 4 Personen regelmässig in Ohnmacht“(FN 268).
Die Umwälzung der gesellschaftlichen Betriebsweise, diess nothwendige Produkt der Umwandlung des Produktionsmittels, vollzieht sich in einem bunten Wirrwarr von Uebergangsformen. Sie wechseln mit dem Umfang, worin, und der Zeitlänge, während welcher die Nähmaschine den einen oder andern Industriezweig bereits ergriffen hat, mit der vorgefundnen Lage der Arbeiter, dem Uebergewicht des Manufaktur-, Handwerksoder Hausbetriebs, dem Miethpreis der Arbeitslokale(FN 269) u. s. w. In der Putzmacherei z. B., wo die Arbeit meist schon organisirt war, hauptsächlich durch einfache Cooperation, bildet die Nähmaschine zunächst nur einen neuen Faktor des Manufakturbetriebs. In der Schneiderei, Hemdenmacherei, Schusterei u. s. w. durchkreuzen sich alle Formen. Hier eigentlicher Fabrikbetrieb. Dort erhalten Zwischenanwender das Rohmaterial vom Kapitalisten en chef und gruppiren in „Kammern“ oder „Dachstuben“ 10 bis 50 und mehr Lohnarbeiter um Nähmaschinen.
Endlich, wie bei aller Maschinerie, die kein gegliedertes System bildet, und im Zwergformat anwendbar ist, benutzen Handwerker oder Hausarbeiter, mit eigner Familie oder Zuziehung weniger fremder Arbeiter, auch ihnen selbst gehörige Nähmaschinen(FN 270). Thatsächlich überwiegt jetzt in England das System, dass der Kapitalist eine grössere Maschinenanzahl in seinen Baulichkeiten koncentrirt und dann das Maschinenprodukt zur weiteren Verarbeitung unter die Armee der Hausarbeiter vertheilt(FN 271). Die Buntheit der Uebergangsformen versteckt jedoch nicht die Tendenz zur Verwandlung in eigentlichen Fabrikbetrieb. Diese Tendenz wird genährt durch den Charakter der Nähmaschine selbst, deren mannigfaltige Anwendbarkeit zur Vereinigung früher getrennter Geschäftszweige in derselben Baulichkeit und unter dem Kommando desselben Kapitals drängt; durch den Umstand, dass vorläufiges Nadelwerk und einige andere Operationen am geeignetsten am Sitz der Maschine verrichtet werden; endlich durch die unvermeidliche Expropriation der Handwerker und Hausarbeiter, die mit eignen Maschinen produciren. Diess Fatum hat sie zum Theil schon jetzt erreicht. Die stets wachsende Masse des in Nähmaschinen angelegten Kapitals(FN 272) spornt die Produktion und erzeugt Marktstockungen, welche das Signal zum Verkauf der Nähmaschinen durch die Hausarbeiter läuten. Die Ueberproduktion von solchen Maschinen selbst zwingt ihre absatzbedürftigen Producenten sie auf wöchentliche Miethe zu verleihn und schafft damit eine für die kleinen Maschineneigner tödtliche Konkurrenz(FN 273). Stets noch fortdauernde Konstruktionswechsel und Verwohlfeilerung der Maschinen depreciiren eben so beständig ihre alten Exemplare und lassen sie nur noch massenhaft, zu Spottpreisen gekauft, in der Hand grosser Kapitalisten, profitlich anwenden. Endlich giebt die Substitution der Dampfmaschine für den Menschen, hier wie in allen ähnlichen Umwälzungsprozessen, den Ausschlag. Die Anwendung der Dampfkraft stösst im Anfang auf rein technische Hindernisse, wie Schütteln der Maschinen, Schwierigkeit in der Beherrschung ihrer Geschwindigkeit,
raschen Verderb der leichteren Maschinen u. s. w., lauter Hindernisse, welche die Erfahrung bald überwinden lehrt(FN 274). Wenn einerseits die Koncentration vieler Arbeitsmaschinen in grösseren Manufakturen zur Anwendung der Dampfkraft treibt, beschleunigt andrerseits die Konkurrenz des Dampfes mit Menschenmuskeln Koncentration von Arbeitern und Arbeitsmaschinen in grossen Fabriken. So erlebt England gegenwärtig in der kolossalen Produktionssphäre des „Wearing Apparel“, wie den meisten übrigen Gewerken, die Umwälzung der Manufaktur, des Handwerks und der Hausarbeit in Fabrikbetrieb, nachdem alle jene Formen, unter dem Einfluss der grossen Industrie gänzlich verändert, zersetzt, entstellt, bereits längst alle Ungeheuerlichkeiten des Fabriksystems ohne seine positiven Entwicklungsmomente reproducirt und selbst übertrieben hatten(FN 275).
Diese naturwüchsig vorgehende industrielle Revolution wird künstlich beschleunigt durch die Ausdehnung der Fabrikgesetze auf alle Industriezweige, worin Weiber, junge Personen und Kinder arbeiten. Die zwangsmässige Regulation des Arbeitstags nach Länge, Pausen, Anfangsund Endpunkt, das System der Ablösung für Kinder, der Ausschluss aller Kinder unter einem gewissen Alter u. s. w. ernöthigen einerseits vermehrte Maschinerie(FN 276) und Ersatz von Muskeln durch Dampf als Trieb-
kraft(FN 277). Andrerseits, um im Raum zu gewinnen, was in der Zeit verloren geht, findet Streckung der gemeinschaftlich vernutzten Produktionsmittel statt, der Oefen, Baulichkeiten u. s. w., also in einem Wort grössere Koncentration der Produktionsmittel und entsprechende grössere Konglomeration von Arbeitern. Der leidenschaftlich wiederholte Haupteinwand jeder mit dem Fabrikgesetz bedrohten Manufaktur ist in der That die Nothwendigkeit grösserer Kapitalauslage, um das Geschäft in seinem alten Umfang fortzuführen. Was aber die Zwischenformen zwischen Manufaktur und Hausarbeit und letztre selbst betrifft, so versinkt ihr Boden mit der Schranke des Arbeitstags und der Kinderarbeit. Schrankenlose Ausbeutung wohlfeiler Arbeitskräfte bildet die einzige Grundlage ihrer Konkurrenzfähigkeit.
Wesentliche Bedingung des Fabrikbetriebs, namentlich sobald er der Regulation des Arbeitstags unterliegt, ist normale Sicherheit des Resultats, d. h. Produktion eines bestimmten Quantums Waare oder eines bezweckten Nutzeffekts in gegebnem Zeitraum. Die gesetzlichen Pausen des regulirten Arbeitstags unterstellen ferner plötzlichen und periodischen Stillstand der Arbeit ohne Schaden für das im Produktionsprozess befindliche Machwerk. Diese Sicherheit des Resultats und Unterbrechungsfähigkeit der Arbeit sind natürlich in rein mechanischen Gewerken leichter erzielbar als dort wo chemische und andere physische Prozesse eine Rolle spielen, wie z. B. in Töpferei, Bleicherei, Färberei, Bäckerei, den meisten Metallmanufakturen. Mit dem Schlendrian des unbeschränkten Arbeitstags, der Nachtarbeit, und freier Menschenverwüstung, gilt jedes naturwüchsige Hinderniss bald für eine ewige „ Naturschranke“ der Produktion. Kein Gift vertilgt Ungeziefer sichrer als das Fabrikgesetz solche „Naturschranken“. Niemand schrie lauter über „Unmöglichkeiten“ als die Herren von der Töpferei. 1864 wurde ihnen das Fabrikgesetz oktroyirt und alle Unmöglichkeiten waren schon 16 Monate später verschwunden. „Die“ durch das Fabrikgesetz hervorgerufene „verbesserte Methode Schliff durch Druck statt durch Ausdünstung zu machen, die neue Konstruktion der Oefen zum Trocknen der frischen Waare u. s. w. sind Ereignisse von grosser Wichtigkeit in der Kunst der Töpferei und bezeich-
nen einen Fortschritt derselben, wie ihn das letzte Jahrhundert nicht aufweisen kann … Die Temperatur der Oefen ist beträchtlich vermindert, bei beträchtlicher Abnahme im Kohlenkonsum und rascherer Wirkung auf die Waare“(FN 278). Trotz aller Prophezeiung stieg nicht der Kostpreis des Erdenguts, wohl aber die Produktenmasse, so dass die Ausfuhr der 12 Monate von December 1864 bis December 1865 einen Werthüberschuss von 138,628 Pfd. St. über den Durchschnitt der drei vorigen Jahre ergab. In der Fabrikation von Schwefelhölzern galt es als Naturgesetz, dass Jungen, selbst während der Herunterwürgung ihres Mittagsmahls, die Hölzer in eine warme Phosphorkomposition tunkten, deren giftiger Dampf ihnen in das Gesicht stieg. Mit der Nothwendigkeit Zeit zu ökonomisiren, erzwang der Fabrikakt (1864) eine „ dipping machine“ (Eintauchungsmaschine), deren Dämpfe den Arbeiter nicht erreichen können(FN 279). So wird jetzt in den noch nicht dem Fabrikgesetz unterworfenen Zweigen der Spitzenmanufaktur behauptet, die Mahlzeiten könnten nicht regelmässig sein „wegen der verschiednen Zeitlängen, die verschiedne Spitzenmaterialien zur Trocknung brauchen, und die von 3 Minuten auf eine Stunde und mehr variiren.“ Hierauf antworten die Kommissäre der „ Children’s Employment Comm.“: „Die Umstände sind genau dieselben wie in der Tapetendruckerei. Einige der Hauptfabrikanten in diesem Zweig machten lebhaft geltend, die Natur der verwandten Materialien und die Verschiedenartigkeit der Prozesse, die sie durchlaufen, erlaubten ohne grossen Verlust keine plötzliche Stillsetzung der Arbeit für Mahlzeiten. . . . Durch die 6. Klausel der 6. Sektion des Factory Act’s Extension Act (1864) ward ihnen eine achtzehnmonatliche Frist vom Erlassungsdatum des Akts an eingeräumt, nach deren Ablauf sie sich den durch den Fabrikakt specificirten Erfrischungspausen fügen müssten(FN 280). Kaum hatte das Gesetz parlamentarische Sanktion erhalten, als die Herren Fabrikanten auch entdeckten: „Die Missstände, die wir von der Einführung des Fabrikgesetzes erwarteten, sind nicht eingetreten. Wir finden nicht, dass die
Produktion irgendwie gelähmt ist. In der That, wir produciren mehr in derselben Zeit“(FN 281). Man sieht, das englische Parlament, dem sicher Niemand Genialität vorwerfen wird, ist durch Erfahrung zur Einsicht gelangt, dass ein Zwangsgesetz alle s. g. Naturhindernisse der Produktion gegen Beschränkung und Reglung des Arbeitstags einfach wegdiktiren kann. Bei Einführung des Fabrikakts in einen Industriezweig wird daher ein Termin von 6 bis 18 Monaten gestellt, innerhalb dessen es Sache der Fabrikanten ist die technischen Hindernisse wegzuräumen. Mirabeau’s: „Impossible! Ne me nommez jamais cet imbécil de mot!“ gilt namentlich für die moderne Technologie. Wenn aber das Fabrikgesetz so die zur Verwandlung des Manufakturbetriebs in Fabrikbetrieb nothwendigen materiellen Elemente treibhausmässig reift, beschleunigt es zugleich durch die Nothwendigkeit vergrösserter Kapitalauslage den Untergang der kleineren Meister und die Koncentration des Kapitals(FN 282).
Abgesehn von den rein technischen und technisch beseitbaren Hindernissen stösst die Regulation des Arbeitstags auf unregelmässige Gewohnheiten der Arbeiter selbst, namentlich wo Stücklohn vorherrscht und Verbummlung der Zeit in einem Tagesoder Wochenabschnitt durch nachträgliche Ueberarbeit oder Nachtarbeit aufgemacht werden kann, eine Methode, die den erwachsnen Arbeiter brutalisirt, seine unreifen und weiblichen Genossen ruinirt(FN 283). Obgleich diese Regellosigkeit in Verausgabung der Ar-
beitskraft eine naturwüchsig rohe Reaktion gegen die Langweile monotoner Arbeitsplackerei ist, entspringt sie jedoch in ungleich höherem Grad aus der Anarchie der Produktion selbst, die ihrerseits wieder ungezügelte Exploitation der Arbeitskraft durch das Kapital voraussetzt. Neben die allgemeinen periodischen Wechselfälle des industriellen Cyklus und die besondern Marktschwankungen in jedem Produktionszweig, treten namentlich die s. g. Saison, beruhe sie nun auf Periodicität der Schifffahrt günstiger Jahreszeiten oder auf der Mode, und die Plötzlichkeit grosser und in kürzester Frist auszuführender Ordres. Die Gewohnheit der letztern dehnte sich mit Eisenbahnen und Telegraphie aus. „Die Ausdehnung des Eisenbahnsystems“, sagt z. B. ein Londoner Fabrikant, „durch das ganze Land hat die Gewohnheit kurzer Ordres sehr gefördert. Käufer kommen jetzt von Glasgow, Manchester und Edinburg einmal in 14 Tagen oder so zu den City-Waarenhäusern für den Grossverkauf, denen wir die Waaren liefern. Sie geben Ordres, die unmittelbar ausgeführt werden müssen, statt vom Lager zu kaufen, wie es Gewohnheit war. In früheren Jahren waren wir stets fähig während der schlaffen Zeit für die Nachfrage der nächsten Saison vorauszuarbeiten, aber jetzt kann Niemand vorhersagen, was dann in Nachfrage sein wird“(FN 284).
In den noch nicht dem Fabrikgesetz unterworfenen Fabriken und Manufakturen herrscht periodisch die furchtbarste Ueberarbeit während der s. g. Saison, stossweis in Folge plötzlicher Ordres. Im auswärtigen Departement der Fabrik, der Manufaktur und des Waarenmagazins, in der Sphäre der Hausarbeit, ohnehin durchaus unregelmässig, für ihr Rohmaterial und ihre Ordres ganz abhängig von den Launen des Kapitalisten, den hier keine Rücksicht auf Verwerthung von Baulichkeiten, Maschinen u. s. w. bindet und der hier nichts riskirt als die Haut der Arbeiter selbst, wird so systematisch eine stets disponible, industrielle Reservearmee grossgezüchtet, decimirt während eines Theils des Jahrs durch unmenschlichsten Arbeitszwang, während des andern Theils verlumpt durch Arbeitsmangel. „Die Anwender“, sagt die „ Child. Empl. Comm.“, „exploitiren
die gewohnheitsmässige Unregelmässigkeit der Hausarbeit, um sie in Zeiten, wo Extrawerk nöthig, bis 11, 12, 2 Uhr Nachts, in der That, wie die stehende Phrase lautet, auf alle Stunden hinaufzuforciren, und diess in Lokalen, „wo der Gestank hinreicht, euch niederzuschmettern („the stench is enough to knock you down“). Ihr geht vielleicht bis an die Thüre und öffnet sie, aber schaudert zurück vor weiterem Vorgehn“(FN 285). „Es sind komische Käuze, unsre Anwender“, sagt einer der verhörten Zeugen, ein Schuster, „sie glauben, es thue einem Jungen keinen Harm, wenn er während eines halben Jahrs todtgerackert und während der andern Hälfte fast gezwungen wird herumzuludern“(FN 286).
Wie die technischen Hindernisse, so wurden und werden diese s. g. „ Geschäftsgewohnheiten“ („usages which have grown with the growth of trade“) von interessirten Kapitalisten als „ Naturschranken“ der Produktion behauptet, ein Lieblingsschrei diess der Baumwolllords zur Zeit als das Fabrikgesetz sie zuerst bedrohte. Obgleich ihre Industrie mehr als jede andre auf dem Weltmarkt und daher der Schifffahrt beruht, strafte die Erfahrung sie Lügen. Seitdem wird jedes angebliche „Geschäftshinderniss“ von den englischen Fabrikinspektoren als hohle Flause behandelt(FN 287). Die gründlich gewissenhaften Untersuchungen der „ Child. Empl. Comm.“ beweisen in der That, dass in einigen Industrieen die bereits angewandte Arbeitsmasse nur gleichmässiger über das ganze Jahr vertheilt würde durch die Regulation des Arbeitstags(FN 288), dass letztere der erste rationelle Zügel für die menschenmörderischen, inhaltslosen und an sich dem System der grossen Industrie unangemessnen Flatterlaunen der Mode(FN 289), dass die Entwicklung der oceanischen Schifffahrt und der
Kommunikationsmittel überhaupt den eigentlich technischen Grund der Saison-Arbeit aufgehoben hat(FN 290), dass alle andern angeblich unkontrolirbaren Umstände weggeräumt werden durch weitere Baulichkeiten, zusätzliche Maschinerie, vermehrte Anzahl der gleichzeitig beschäftigten Arbeiter(FN 291) und von selbst folgenden Rückschlag auf das System des Grosshandels(FN 292). Jedoch versteht sich das Kapital, wie es wiederholt durch den Mund seiner Repräsentanten erklärt, zu solcher Umwälzung „ nur unter dem Druck eines allgemeinen Parlamentsakts“(FN 293), der den Arbeitstag zwangsgesetzlich regulirt.
Die Fabrikgesetzgebung, diese erste bewusste und plan-
mässige Rückwirkung der Gesellschaft auf die naturwüchsige Gestalt ihres Produktionsprozesses, ist, wie man gesehn, ebenso sehr ein nothwendiges Produkt der grossen Industrie, als Baumwollgarn, Selfactors und der elektrische Telegraph. Bevor wir zu ihrer bevorstehenden Verallgemeinerung in England übergehn, sind noch einige nicht auf die Stundenzahl des Arbeitstags bezügliche Klauseln des englischen Fabrikakts kurz zu erwähnen.
Abgesehn von ihrer Redaktion, welche dem Kapitalisten ihre Umgehung erleichtert, sind die Gesundheitsklauseln äusserst mager, in der That beschränkt auf Vorschriften für Weisswaschung und einige sonstige Reinlichkeitsmassregeln, Ventilation, und Schutz gegen gefährliche Maschinerie. Wir kommen im dritten Buch auf den fanatischen Kampf der Fabrikanten gegen die Klausel zurück, die ihnen eine geringe Ausgabe zum Schutz der Gliedmassen ihrer „Hände“ aufoktroyirt. Hier bewährt sich wieder glänzend das Freihandelsdogma, dass in einer Gesellschaft antagonistischer Interessen Jeder das Gemeinwohl durch Verfolgung seines Eigennutzes fördert. Ein Beispiel genügt. Man weiss, dass sich während der letztverflossenen zwanzigjährigen Periode die Flachsindustrie und mit ihr die scutching mills (Fabriken zum Schlagen und Brechen des Flachses) in Irland sehr vermehrt haben. Es gab dort 1864 an 1800 dieser mills. Periodisch im Herbst und Winter werden hauptsächlich junge Personen und Weiber, die Söhne, Töchter und Frauen der benachbarten kleinen Pächter, lauter mit Maschinerie ganz unbekannte Personen, von der Feldarbeit weggeholt, um die Walzwerke der scutching mills mit Flachs zu füttern. Die Unfälle sind nach Umfang und Intensivität gänzlich beispiellos in der Geschichte der Maschinerie. Eine einzige scutching mill zu Kildinan (bei Cork) zählte von 1852 bis 1856 sechs Todesfälle und 60 schwere Verstümmelungen, welchen allen durch die einfachsten Anstalten, zur Kost von wenigen Schillingen, vorgebeugt werden konnte. Dr. W. White, der certifying surgeon der Fabriken zu Downpatrick, erklärt in einem officiellen Bericht vom 15. December 1865: „Die Unfälle in scutching mills sind furchtbarster Art. In vielen Fällen wird ein Viertheil des Körpers vom Rumpfe gerissen. Tod oder eine Zukunft elenden Unvermögens und Leidens sind gewöhnliche Folgen der Wunden. Die Zunahme der Fabriken in diesem Lande wird natürlich diese schauderhaften Resultate ausdehnen. Ich bin überzeugt, dass durch
geeignete Staatsüberwachung der scutching mills grosse Opfer von Leib und Leben zu vermeiden sind“(FN 294). Was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisiren als die Nothwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staatswegen die einfachsten Reinlichkeitsund Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen? „Der Fabrikakt von 1864 hat in den Töpfereien über 200 Werkstätten geweisst und gereinigt, nach zwanzigjähriger oder gänzlicher Enthaltung von jeder solchen Operation (diess ist die „ Abstinenz“ des Kapitals!), in Plätzen, wo 27,800 Arbeiter beschäftigt sind, und bisher, während übermässiger Tages-, oft Nacht-Arbeit, eine mephitische Atmosphäre einathmeten, welche eine sonst vergleichungsweis harmlose Beschäftigung mit Krankheit und Tod schwängerte. Der Akt hat die Ventilationsmittel sehr vermehrt“(FN 295). Zugleich zeigt dieser Zweig des Fabrikakts schlagend, wie die kapitalistische Produktionsweise ihrem Wesen nach über einen gewissen Punkt hinaus jede rationelle Verbesserung ausschliesst. Es ward wiederholt bemerkt, dass die englischen Aerzte aus einem Munde 500 Kubikfuss Luftraum per Person für kaum genügen des Minimum bei fortgesetzter Arbeit erklären. Nun wohl! Wenn der Fabrikakt indirekt durch alle seine Zwangsmassregeln die Verwandlung kleinerer Werkstätten in Fabriken beschleunigt, daher indirekt in das Eigenthumsrecht der kleineren Kapitalisten eingreift und den grossen das Monopol sichert, so würde die gesetzliche Aufherrschung des nöthigen Luftraums für jeden Arbeiter in der Werkstätte Tausende von kleinen Kapitalisten mit einem Schlag direkt expropriiren! Sie würde die Wurzel der kapitalistischen Produktionsweise angreifen, d. h. die Selbstverwerthung des Kapitals, ob gross oder klein, durch „freien“ Ankauf und Konsum der Arbeitskraft. Vor diesen 500 Kubikfuss Luft geht daher der Fabrikgesetzgebung der Athem aus. Der „Board of Health“, die industriellen Untersuchungskommissionen, die Fabrikinspektoren wiederholen wieder und wieder die Nothwendigkeit der 500 Kubikfüsse und die Unmöglichkeit, sie dem Kapital aufzuoktroyiren. Sie erklären so in der That Schwindsucht und andre Lungenkrankheiten der Arbeit für eine Lebensbedingung des Kapitals(FN 296).
Armselig wie die Erziehungsklauseln des Fabrikakts im Ganzen erscheinen, proklamirten sie den Elementarunterricht als Zwangsbedingung der Arbeit(FN 297). Ihr Erfolg bewies zuerst die Möglichkeit der Verbindung von Unterricht und Gymnastik(FN 298) mit Handarbeit, also auch von Handarbeit mit Unterricht und Gymnastik. Die Fabrikinspektoren entdeckten bald aus den Zeugenverhören der Schulmeister, dass die Fabrikkinder, obgleich sie nur halb so viel Unterricht geniessen als die regelmässigen Tagesschüler, eben so viel und oft mehr lernen. „Die Sache ist einfach. Diejenigen, die sich nur einen halben Tag in der Schule aufhalten, sind stets frisch und fast immer fähig und willig Unterricht zu empfangen. Das System halber Arbeit und halber Schule macht jede der beiden Beschäftigungen zur Ausruhung und Erholung von der andern und folglich viel angemessner für das Kind als die ununterbrochne Fortdauer einer von beiden. Ein Junge, der von Morgens früh in der Schule sitzt, und nun gar bei heissem Wetter, kann unmöglich mit einem andern wetteifern, der munter und aufgeweckt von seiner Arbeit kommt“(FN 299). Weitere Belege findet man in Senior’s
Rede auf dem sociologischen Kongress zu Edinburg, 1863. Er zeigt hier auch u. a. nach, wie der einseitige, unproduktive und verlängerte Schultag der Kinder der höheren und mittleren Klassen die Arbeit der Lehrer nutzlos vermehrt, „während er Zeit, Gesundheit und Energie der Kinder nicht nur fruchtlos, sondern absolut schädlich verwüstet“(FN 300). Aus dem Fabriksystem, wie man im Detail bei Robert Owen verfolgen kann, entspross der Keim der Erziehung der Zukunft, welche für alle Kinder über einem gewissen Alter produktive Arbeit mit Unterricht und Gymnastik verbinden wird, nicht nur als eine Methode zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktion, sondern als die einzige Methode zur Produktion vollseitig entwickelter Menschen.
Man hat gesehn, dass die grosse Industrie die manufakturmässige Theilung der Arbeit mit ihrer lebenslänglichen Annexation eines ganzen Menschen an eine Detailoperation technologisch aufhebt, während zugleich die kapitalistische Form der grossen Industrie jene Arbeitstheilung noch monströser reproducirt, in der eigentlichen Fabrik durch Verwandlung des Arbeiters in den selbstbewussten Zubehör einer Theilmaschine, überall sonst theils durch sporadischen Gebrauch der Maschinen und Ma-
schinenarbeit(FN 301), theils durch Einführung von Weiber-, Kinderund ungeschickter Arbeit als neuer Grundlage der Arbeitstheilung. Der Widerspruch zwischen der manufakturmässigen Theilung der Arbeit und dem Wesen der grossen Industrie macht sich gewaltsam geltend. Er erscheint u. a. in der furchtbaren Thatsache, dass ein grosser Theil der in den modernen Fabriken und Manufakturen beschäftigten Kinder, vom zartesten Alter festgeschmiedet an die einfachsten Manipulationen, Jahrelang exploitirt wird, ohne Erlernung irgend einer Arbeit, die sie später auch nur in derselben Manufaktur oder Fabrik brauchbar machte. In den englischen Buchdruckereien z. B. fand früher ein dem System der alten Manufaktur und des Handwerks entsprechender Uebergang der Lehrlinge von leichteren zu inhaltsvolleren Arbeiten statt. Sie machten einen Lerngang durch, bis sie fertige Drucker waren. Lesen und schreiben zu können war für alle ein Handwerkserforderniss. Alles das änderte sich mit der Druckmaschine. Sie verwendet zwei Sorten von Arbeitern, einen erwachsnen Arbeiter, den Maschinenaufseher, und Maschinenjungen, meist von 11 bis 17 Jahren, deren Geschäft ausschliesslich darin besteht, einen Bogen Papier der Maschine zu unterbreiten oder ihr den gedruckten Bogen zu entziehen. Sie verrichten, in London namentlich, diese Plackerei 14, 15, 16 Stunden ununterbrochen während einiger Tage in der Woche und oft 36 Stunden nach einander mit nur zwei Stunden Rast für Mahlzeit und Schlaf(FN 302)! Ein grosser Theil von ihnen kann nicht lesen und sie sind in der Regel ganz verwilderte, abnorme Geschöpfe. „Um sie zu ihrem
Werk zu befähigen, ist keine intellektuelle Ziehung irgend einer Art nöthig; sie haben wenig Gelegenheit für Geschick und noch weniger für Urtheil; ihr Lohn, obgleich gewissermassen hoch für Jungen, wächst nicht verhältmässig, wie sie selbst heranwachsen und die grosse Mehrzahl hat keine Aussicht auf den einträglicheren und verantwortlicheren Posten des Maschinenaufsehers, weil auf jede Maschine nur ein Aufseher und oft 4 Jungen kommen“(FN 303). Sobald sie zu alt für ihre kindische Arbeit werden, also wenigstens im 17. Jahr, entlässt man sie aus der Druckerei. Sie werden zu Rekruten des Verbrechens. Einige Versuche ihnen anderswo Beschäftigung zu verschaffen, scheiterten an ihrer Unwissenheit, Rohheit, körperlichen und geistigen Verkommenheit.
Was von der manufakturmässigen Theilung der Arbeit im Innern der Werkstatt, gilt von der Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft. So lange Handwerk und Manufaktur die allgemeine Grundlage der gesellschaftlichen Produktion bilden, ist die Subsumtion des Producenten unter einen ausschliesslichen Produktionszweig, die Zerreissung der ursprünglichen Mannigfaltigkeit seiner Beschäftigungen(FN 304), ein nothwendiges Entwicklungsmoment. Auf jener Grundlage findet jeder besondre Produktionszweig empirisch die ihm entsprechende technologische Gestalt, vervollkommnet sie langsam und krystallisirt sie rasch, sobald ein gewisser Reifegrad erlangt ist. Was hier und da Wechsel hervorruft, ist ausser neuem Arbeitsstoff, den der Handel liefert, die allmälige Aenderung des Arbeitsinstruments. Die erfahrungsmässig entsprechende Form einmal gewonnen, verknöchert auch es, wie sein oft jahrtausendlanger Uebergang aus der Hand einer Generation in die der andern beweist. Es ist charakteristisch, dass bis ins
18. Jahrhundert hinein die besondern Gewerke mysteries (mystères)(FN 305) hiessen, in deren Dunkel nur der empirisch und professionell Eingeweihte eindringen konnte. Die grosse Industrie zerriss den Schleier, der den Menschen ihren eignen gesellschaftlichen Produktionsprocess versteckte und die verschiednen naturwüchsig besonderten Produktionszweige gegen einander und sogar dem in jedem Zweig Eingeweihten zu Räthseln machte. Ihr Princip, jeden Produktionsprozess an und für sich, und zunächst ohne alle Rücksicht auf die menschliche Hand, in seine constituirenden Elemente aufzulösen, schuf die ganz moderne Wissenschaft der Technologie. Die buntscheckigen, scheinbar zusammenhangslosen und verknöcherten Gestalten des gesellschaftlichen Produktionsprozesses lösten sich auf in bewusst planmässige und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte Anwendungen der Naturwissenschaft. Die Technologie entdeckte ebenso die wenigen grossen Grundformen der Bewegung, worin alles produktive Thun des menschlichen Körpers, trotz aller Mannigfaltigkeit der angewandten Instrumente, nothwendig vorgeht, ganz so wie die Mechanik durch die grösste Komplikation der Maschinerie sich über die beständige Wiederholung der einfachen mechanischen Potenzen nicht täuschen lässt. Die moderne Industrie betrachtet und behandelt die vorhandne Form eines Produktionsprozesses nie als definitiv. Ihre technologische Basis ist daher revolutionär, während die aller früheren Produktionsweisen wesentlich konservativ war(FN 306). Durch Maschinen, chemische Prozesse und andre Me-
thoden wälzt sie beständig mit der technischen Grundlage der materiellen Produktion die Funktionen der Arbeiter und die gesellschaftlichen Kombinationen des Arbeitsprozesses um. Sie revolutionirt damit ebenso beständig die Theilung der Arbeit im Innern der Gesellschaft und schleudert unaufhörlich Kapitalmassen und Arbeitermassen aus einem Produktionszweig in den andern. Die Natur der grossen Industrie bedingt daher Wechsel der Arbeit, Fluss der Funktion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters. Andrerseits reproducirt sie in ihrer kapitalistischen Form die alte Theilung der Arbeit mit ihren knöchernen Partikularitäten. Man hat gesehn, wie dieser absolute Widerspruch alle Ruhe, Festigkeit, Sicherheit der Lebenslage des Arbeiters aufhebt, ihm mit dem Arbeitsmittel beständig das Lebensmittel aus der Hand zu schlagen(FN 307) und mit seiner Theilfunktion ihn selbst überflüssig zu machen droht, wie dieser Widerspruch im ununterbrochnen Opferfest der Arbeiterklasse, masslosester Vergeudung der Arbeitskräfte und den Verheerungen gesellschaftlicher Anarchie sich austobt. Diess ist die negative Seite. Wenn aber der Wechsel der Arbeit sich jetzt nur als überwältigendes Naturgesetz und mit der blind zerstörenden Wirkung eines Naturgesetzes durchsetzt, das überall auf Hindernisse stösst(FN 308), macht die grosse Industrie durch ihre Katastrophen selbst
es zur Frage von Leben oder Tod, den Wechsel der Arbeiten und daher möglichste Vielseitigkeit des Arbeiters als allgemeines gesellschaftliches Gesetz der Produktion anzuerkennen, und die Verhältnisse seiner normalen Verwirklichung gemäss umzugestalten. Sie macht es zu einer Frage von Leben oder Tod, die Ungeheuerlichkeit einer elenden, für die wechselnden Exploitationsbedürfnisse des Kapitals in Reserve gehaltenen, disponiblen Arbeiterbevölkerung zu ersetzen durch die absolute Disponibilität des Menschen für wechselnde Arbeitserfordernisse; das Theilindividuum, welches blosser Träger einer gesellschaftlichen Detailfunktion ist, durch das total entwickelte Individuum, für welches die gesellschaftlichen Funktionen eben so viele verschiedne Bethätigungsweisen sind. Ein auf Grundlage der grossen Industrie naturwüchsig entwickeltes Moment dieses Umwälzungsprozesses sind polytechnische und agronomische Schulen, ein anderes sind die „ écoles d’enseignement professionnel“, worin die Kinder der Arbeiter einigen Unterricht in der Technologie und praktischen Handhabe der verschiednen Produktionsinstrumente erhalten. Wenn die Fabrikgesetzgebung als erste, dem Kapital nothdürftig abgerungene Koncession nur Elementarunterricht mit fabrikmässiger Arbeit verbindet, unterliegt es keinem Zweifel, dass die unvermeidliche Eroberung der politischen Gewalt durch die Arbeiterklasse auch dem technologischen Unterricht, theoretisch und praktisch, seinen Platz in den Arbeiterschulen erobern wird. Es unterliegt ebenso wenig einem Zweifel, dass die kapitalistische Form der Produktion und die ihr entsprechenden ökonomischen Arbeiterverhältnisse im diametralsten Widerspruch stehn mit solchen Umwälzungsfermenten und ihrem Ziel, der Aufhebung der alten Theilung der Arbeit. Die Entwicklung der Widersprüche einer geschichtlichen Produktionsform ist jedoch der einzig geschichtliche Weg ihrer Auflösung und Neugestaltung. „Ne sutor ultra crepidam“!, diess nec plus ultra hand werksmässiger Weisheit, wurde zur furchtbaren Narrheit von dem Moment, wo der Uhrmacher Watt die Dampfmaschine, der Barbier Arkwright den Kettenstuhl, der Juwelierarbeiter Fulton das Dampfschiff erfunden hatte(FN 309).
Soweit die Fabrikgesetzgebung die Arbeit in Fabriken, Manufakturen u. s. w. regulirt, erscheint diess zunächst nur als Einmischung in die Exploitationsrechte des Kapitals. Jede Regulation der s. g. Hausarbeit(FN 310) stellt sich dagegen sofort als direkter Eingriff in die patria Potestas dar, d. h. modern interpretirt, in die elterliche Autorität, ein Schritt, wovor das zartfühlende englische Parlament lang zurückzubeben affektirte. Die Gewalt der Thatsachen zwang jedoch endlich anzuerkennen, dass die grosse Industrie mit der ökonomischen Grundlage des alten Familienwesens und der ihr entsprechenden Familienarbeit auch die alten Familienverhältnisse selbst auflöst. Das Recht der Kinder musste proklamirt werden. „Unglücklicher Weise“, heisst es im Schlussbericht der „Child. Empl. Comm.“ von 1866, „leuchtet aus der Gesammtheit der Zeugenaussagen hervor, dass die Kinder beiderlei Geschlechts gegen Niemand so sehr des Schutzes bedürfen als gegen ihre Eltern.“ Das System der masslosen Exploitation der Kinderarbeit überhaupt und der Hausarbeit im Besondern wird dadurch „erhalten, dass die Eltern über ihre jungen und zarten Sprösslinge eine willkührliche und heillose Gewalt ohne Zügel oder Kontrole ausüben … Eltern dürfen nicht die absolute Macht besitzen, ihre Kinder zu reinen Maschinen zu machen, um so und so viel wöchentlichen Lohn herauszuschlagen … Kinder und junge Personen haben ein Recht auf den Schutz der Legislatur wider den Missbrauch der elterlichen Gewalt, der ihre physische Kraft vorzeitig bricht und sie degradirt auf der Staffel moralischer und intellektueller Wesen“(FN 311). Es ist
jedoch nicht der Missbrauch der elterlichen Gewalt, der die direkte oder indirekte Exploitation unreifer Arbeitskräfte durch das Kapital schuf, sondern es ist umgekehrt die kapitalistische Exploitationsweise, welche die elterliche Gewalt, durch Aufhebung der ihr entsprechenden ökonomischen Grundlage, zu einem Missbrauch gemacht hat. So furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, so schafft nichtsdestoweniger die grosse Industrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisirten Produktionsprozessen jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form der Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter. Es ist natürlich ebenso albern die christlich germanische Form der Familie für absolut zu halten als die altrömische Form, oder die altgriechische, oder die orientalische, die übrigens untereinander eine geschichtliche Entwicklungsreihe bilden. Ebenso leuchtet ein, dass die Zusammensetzung des kombinirten Arbeitspersonals aus Individuen beiderlei Geschlechts und der verschiedensten Altersstufen, obgleich in ihrer naturwüchsig brutalen, kapitalistischen Form, wo der Arbeiter für den Produktionsprozess, nicht der Produktionsprozess für den Arbeiter da ist, Pestquelle des Verderbs und der Sklaverei, unter entsprechenden Verhältnissen umgekehrt zur Quelle humaner Entwicklung umschlagen muss(FN 312).
Die Nothwendigkeit, das Fabrikgesetz aus einem Ausnahmsgesetz für Spinnereien und Webereien, diese ersten Gebilde des Maschinenbetriebs, in ein Gesetz aller gesellschaftlichen Produktion zu verallgemeinern, entspringt, wie man sah, aus dem geschichtlichen Entwicklungsgang der grossen Industrie, auf deren Hintergrund die überlieferte Gestalt von Manufaktur, Handwerk und Hausarbeit gänzlich umgewälzt wird, die Manufaktur beständig in die Fabrik, das Handwerk beständig in die Manufaktur umschlägt, und endlich die Sphären des Handwerks und der Hausarbeit sich in relativ wunderbar kurzer Zeit zu Jammerhöhlen gestalten, wo die tollsten Ungeheuerlichkeiten der kapitalistischen Exploitation ihr freies Spiel treiben. Es sind zwei Umstände, welche zuletzt den Ausschlag geben, erstens die stets neu wiederholte Erfahrung, dass das Kapital, sobald es der
Staatskontrole nur auf einzelnen Punkten der gesellschaftlichen Peripherie anheimfällt, sich um so massloser auf den andern Punkten entschädigt(FN 313), zweitens der Schrei der Kapitalisten selbst nach Gleichheit der Konkurrenzbedingungen, d. h. gleichen Schranken der Arbeitsexploitation(FN 314). Hören wir hierüber zwei Herzensstösse. Die Herrn W. Cooksley (Nagel-, Kettenu. s. w. Fabrikanten zu Bristol) führten die Fabrikregulation freiwillig in ihrem Geschäft ein. „Da das alte, unregelmässige System in den benachbarten Werken fortdauert, sind sie der Unbill ausgesetzt ihre Arbeitsjungen zur Fortsetzung der Arbeit anderswo nach 6 Uhr Abends verlockt (enticed) zu sehn. ‚Diess‘, sagen sie natürlich, ‚ist eine Ungerechtigkeit gegen uns und ein Verlust, da es einen Theil der Kraft der Jungen erschöpft, deren voller Vortheil uns gebührt‘(FN 315). Herr J. Simpson (Paper-Box Bag maker, London) erklärt den Kommissären der „ Child. Empl. Comm.“: „Er wolle jede Petition für Einführung der Fabrikakte unterzeichnen. Wie es sei, fühle er sich stets rastlos des Nachts („he always felt restless at night“), nach Schluss seiner Werkstatt, bei dem Gedanken, dass andre länger arbeiten liessen und ihm Aufträge vor der Nase wegschnappten“(FN 316). „Es wäre ein Unrecht,“ sagt die Child. Empl. Comm. zusammenfassend, „gegen die grösseren Arbeitsanwender ihre Fabriken der Regulation zu unterwerfen, während in ihrem eignen Geschäftszweig der Kleinbetrieb keiner gesetzlichen Beschränkung der Arbeitszeit unterliegt. Zur Ungerechtigkeit ungleicher Konkurrenzbedingungen in Bezug auf die Arbeitsstunden bei Ausnahme kleinerer Werkstätten, käme noch der andere Nachtheil für die grösseren Fabrikanten hinzu, dass ihre Zufuhr von jugendlicher und weiblicher Arbeit abgelenkt würde nach den vom Gesetz verschonten Werkstätten. Endlich gäbe diess Anstoss zur Vermehrung der kleineren Werkstätten, die fast ausnahmslos die mindest günstigen für Gesundheit, Komfort, Erziehung und allgemeine Verbesserung des Volks sind“(FN 317).
In ihrem Schlussbericht schlägt die „Children’s Employment“ Kommission vor, über 1,400,000 Kinder, junge Personen und Weiber, wovon ungefähr die Hälfte vom Kleinbetrieb und der Hausarbeit exploitirt wird, dem Fabrikakt zu unterwerfen(FN 318). „Sollte,“ sagt sie, „das Parlament unsern Vorschlag in seinem ganzen Umfang annehmen, so ist es zweifellos, dass solche Gesetzgebung den wohlthätigsten Einfluss ausüben würde, nicht nur auf die Jungen und Schwachen, mit denen sie sich zunächst beschäftigt, sondern auf die noch grössere Masse von erwachsnen Arbeitern, die direkt (die Weiber) und indirekt (die Männer) unter ihren Wirkungskreis fallen. Sie würde ihnen regelmässige und ermässigte Arbeitsstunden aufzwingen; sie würde einen gesunderen und reinlicheren Zustand der Arbeitslokale herbeiführen; sie würde den Vorrath physischer Kraft, wovon ihr eignes Wohlergehen und das des Landes so sehr abhängt, haushalten und häufen; sie würde die aufsprossende Generation vor der Ueberanstrengung in frühem Alter schützen, welche ihre Konstitution untergräbt und zu vorzeitigem Verfall führt; sie würde schliesslich, wenigstens bis zum 13. Jahr die Gelegenheit des Elementarunterrichts bieten und damit der unglaublichen Unwissenheit ein Ende machen, die so treu in den Kommissionsberichten geschildert ist und nur mit qualvollster Empfindung und dem tiefen Gefühl nationaler Erniedrigung betrachtet werden kann“(FN 319). Das Toryministerium kündigte in der Thronrede vom 5. Februar 1867 an, dass es die Vorschläge der industriellen Untersuchungskommission in „Bills“ formulirt habe. Dazu bedurfte es eines neuen zwanzigjährigen Experimentum in corpore vili.
Bereits im Jahr 1840 war eine parlamentarische Kommission zur Untersuchung über Kinderarbeit ernannt worden. Ihr Bericht von 1842 entrollte in den Worten N. W. Senior’s „das furchtbarste Gemälde von Habsucht, Selbstsucht und Grausamkeit der Kapitalisten und Eltern, von Elend, Degradation und Zerstörung der Kinder und jungen Personen, das jemals das Auge der Welt schlug … Man wähnt vielleicht, der Bericht beschreibe die Greuel eines vergangenen Zeitalters … Diese Greuel dauern fort, intensiver als jemals … Die 1842 denuncirten Missbräuche stehn heut zu Tage (Oktober 1863) in voller Blüthe … Der Bericht von 1842 wurde ohne weitere Notiznahme zu den Akten gelegt und da lag er zwanzig volle Jahre, während deren man den physisch, geistig und moralisch niedergetretenen Kindern erlaubte, die Eltern der jetzigen Generation zu werden“(FN 320). Die jetzige Untersuchungskommission schlägt ebenfalls neue Reglung der Minenindustrie vor(FN 321). Endlich brachte Professor
Fawcett im Unterhaus (1867) ähnliche Resolutionen für die Agrikulturarbeiter ein, das Kabinet übernahm jedoch die Initiative.
Wenn die Verallgemeinerung der Fabrikgesetzgebung als physisches und geistiges Schutzmittel der Arbeiterklasse unvermeidlich geworden ist,
verallgemeinert und beschleunigt sie andrerseits, wie bereits angedeutet, die Verwandlung zerstreuter Arbeitsprozesse auf Zwergmassstab in kom-
binirte Arbeitsprozesse auf grosser, gesellschaftlicher Stufenleiter, die Koncentration des Kapitals und das Fabrikregime selbst. Sie zerstört alle
alterthümlichen und Uebergangsformen, wohinter sich die Herrschaft des Kapitals noch theilweis versteckt, und ersetzt sie durch seine direkte, un-
verhüllte Herrschaft. Sie verallgemeinert damit auch den direkten Kampf gegen diese Herrschaft. Während sie in den individuellen Werkstätten Gleichförmigkeit, Regelmässigkeit, Ordnung und Oekonomie erzwingt, vermehrt sie durch den ungeheuren Sporn, den Schranke und Regel des Arbeitstags der Technik aufdrücken, die Anarchie und Katastrophen der kapitalistischen Produktion im Grossen und Ganzen, die Intensivität der Arbeit und die Konkurrenz der Maschinerie mit dem Arbeiter. Mit den Sphären des Kleinbetriebs und der Hausarbeit vernichtet sie die letzten Zufluchtsstätten der unaufhörlich „überzählig“ gemachten und damit das bisherige Sicherheitsventil des ganzen Gesellschaftsmechanismus. Mit den materiellen Bedingungen und der gesellschaftlichen Kombination des Produktionsprozesses reift sie die Widersprüche und Antagonismen seiner kapitalistischen Form, daher gleichzeitig die Bildungselemente
einer neuen und die Umwälzungsmomente der alten Gesellschaft(FN 322).
Die Revolution, welche die grosse Industrie im Ackerbau und den socialen Verhältnissen seiner Produktionsagenten hervorruft, kann erst später dargestellt werden. Hier genügt kurze Andeutung einiger vorweggenommener Resultate. Wenn der Gebrauch der Maschinerie im Ackerbau grossentheils frei ist von den physischen Nachtheilen, die sie dem Fabrikarbeiter zufügt(FN 323), wirkt sie hier noch intensiver und ohne Gegenstoss auf die „Ueberzähligmachung“ der Arbeiter, wie man später im Detail sehn wird. In den Grafschaften von Cambridge und Suffolk z. B. hat sich das Areal des bebauten Landes seit den letzten zwanzig Jahren sehr ausgedehnt, während die Landbevölkerung in derselben Periode nicht nur relativ, sondern absolut abnahm. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ersetzen Agrikultur Maschinen einstweilen nur virtuell Arbeiter, d. h. sie erlauben dem Producenten Bebauung einer grösseren Fläche, verjagen aber nicht wirklich beschäftigte Arbeiter. In England und Wales betrug 1861 die Zahl der in der Fabrikation von AckerbauMaschinen betheiligten Personen 1034, während die Zahl der an Dampfund Arbeitsmaschinen beschäftigten Agrikulturarbeiter nur 1205 betrug.
In der Sphäre der Agrikultur wirkt die grosse Industrie in sofern am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der alten Gesellschaft vernichtet,
den „ Bauer“, und ihm den Lohnarbeiter unterschiebt. Die socialen Umwälzungsbedürfnisse und Gegensätze des Landes werden so mit denen der Stadt ausgeglichen. An die Stelle des gewohnheitsfaulsten und irrationellsten Betriebs tritt bewusste, technologische Anwendung der Wissenschaft. Die Zerreissung des ursprünglichen Familienbandes von Agrikultur und Manufaktur, welches die kindlich unentwickelte Gestalt beider umschlang, wird durch die kapitalistische Produktionsweise vollendet. Sie schafft aber zugleich die materiellen Voraussetzungen einer neuen, höheren Synthese, des Vereins von Agrikultur und Industrie, auf Grundlage ihrer gegensätzlich ausgearbeiteten Gestalten. Mit dem stets wachsenden Uebergewicht der städtischen Bevölkerung, die sie in grossen Centren zusammenhäuft, häuft die kapitalistische Produktion einerseits die geschichtliche Bewegungskraft der Gesellschaft, stört sie andrerseits den Stoffwechsel zwischen Mensch und Erde, d. h. die Rückkehr der vom Menschen in der Form von Nahrungsund Kleidungsmitteln vernutzten Bodenbestandtheile zum Boden, also die ewige Naturbedingung dauernder Bodenfruchtbarkeit. Sie zerstört damit zugleich die physische Gesundheit der Stadtarbeiter und das geistige Leben der Landarbeiter(FN 324). Aber sie zwingt zugleich durch die Zerstörung der bloss naturwüchsig entstandenen Umstände jenes Stoffwechsels ihn systematisch als regelndes Gesetz der gesellschaftlichen Produktion und in einer der vollen menschlichen Entwicklung adäquaten Form herzustellen. In der Agrikultur wie in der Manufaktur erscheint die kapitalistische Umwandlung des Produktionsprozesses zugleich als Martyrologie der Producenten, das Arbeitsmittel als Unterjochungsmittel, Exploitationsmittel und Verarmungsmittel des Arbeiters, die gesellschaftliche Kombination der Arbeitsprozesse als organisirte Unterdrückung seiner individuellen Lebendigkeit, Freiheit und Selbstständigkeit. Die Zerstreuung der Landarbeiter über grössere Flächen bricht zugleich ihre Widerstandskraft,
während Koncentration die der städtischen Arbeiter steigert. Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und grössere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebne Zeitfrist zugleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika z. B., von der grossen Industrie als dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess(FN 325). Die kapitalistische Produk-
tion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen allen Reichthums untergräbt: Die Erde und den Arbeiter.
Fünftes Kapitel. Weitere Untersuchungen über die Produktion des absoluten und relativen Mehrwerths.↑
1) Absoluter und relativer Mehrwerth.↑Der Arbeitsprozess wurde (sieh drittes Kapitel) zunächst abstrakt betrachtet, unabhängig von seinen geschichtlichen Formen, als Prozess zwischen Mensch und Natur. Soweit der Prozess rein individuell, vereinigt derselbe Arbeiter alle Funktionen, die sich später trennen. In der individuellen Aneignung von Naturgegenständen zu seinen Lebenszwecken kontrolirt er sich selbst. Später wird er kontrolirt. Der einzelne Mensch kann nicht auf die Natur wirken ohne Bethätigung seiner eignen Muskeln unter Kontrole seines eignen Hirns. Wie im Natursystem Kopf und Hand zusammengehören, vereint der Arbeitsprozess Kopfarbeit und Handarbeit. Später scheiden sie sich, bis zum feindlichen Gegensatz. Das Produkt verwandelt sich überhaupt aus dem unmittelbaren Produkt des individuellen Producenten in das gemeinsame Produkt eines kombinirten Arbeitspersonals, dessen Glieder der Handhabung des Arbeitsgegenstandes näher oder ferner stehn. Mit dem cooperativen Charakter des
Arbeitsprozesses selbst erweitert sich daher nothwendig der Begriff der produktiven Arbeit und ihres Trägers, des produktiven Arbeiters. Andrerseits verengt er sich. Die kapitalistische Produktion ist nicht nur Produktion von Waare, sie ist wesentlich Produktion von Mehrwerth. Der Arbeiter producirt nicht für sich, sondern für das Kapital. Es genügt daher nicht länger, dass er überhaupt producirt. Er muss Mehrwerth produciren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwerth für den Kapitalisten producirt oder zur Selbstverwerthung des Kapitals dient. Steht es frei ein Beispiel ausserhalb der Sphäre der materiellen Produktion zu wählen, so ist ein Schulmeister produktiver Arbeiter, wenn er nicht nur Kinderköpfe bearbeitet, sondern sich selbst abarbeitet zur Bereicherung des Unternehmers. Dass der sein Kapital in einer Lehrfabrik angelegt hat, statt in einer Wurstfabrik, ändert nichts an dem Verhältniss. Der Begriff des produktiven Arbeiters schliesst daher keineswegs bloss ein Verhältniss zwischen Thätigkeit und Nutzeffekt, zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, sondern auch ein spezifisch gesellschaftliches Produktionsverhältniss, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwerthungsmittel des Kapitals stempelt. Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech. Im vierten Buch dieser Schrift, welches die Geschichte der Theorie behandelt, wird man näher sehn, dass die klassische politische Oekonomie von jeher die Produktion von Mehrwerth zum entscheidenden Charakter des produktiven Arbeiters machte. Mit ihrer Auffassung von der Natur des Mehrwerths wechselt daher ihre Definition des produktiven Arbeiters.
Zunächst erschienen uns die Produktion von absolutem Mehrwerth und die Produktion von relativem Mehrwerth als zwei verschiedne, verschiednen Entwicklungsepochen des Kapitals angehörige, Produktionsarten. Die Produktion des absoluten Mehrwerths bedingt, dass die sachlichen Arbeitsbedingungen in Kapital und die Arbeiter in Lohnarbeiter verwandelt sind, dass die Produkte als Waaren, d. h. für den Verkauf producirt werden, dass der Produktionsprozess zugleich Konsumtionsprozess der Arbeitskraft durch das Kapital und daher der direkten Kontrole des Kapitalisten unterworfen ist, endlich, dass der Arbeitsprozess, also der Arbeitstag, über den Punkt hinaus verlängert wird, wo der Arbeiter nur ein Aequivalent für den Werth seiner Arbeits-
kraft producirt hätte. Die allgemeinen Bedingungen aller Produktion von Waaren vorausgesetzt, besteht die Produktion des absoluten Mehrwerths einfach in der Verlängerung des Arbeitstags über die Grenze der zum Leben des Arbeiters selbst nothwendigen Arbeitszeit, und in der Aneignung der Mehrarbeit durch das Kapital. Dieser Prozess kann vorgehn und geht vor auf Grundlage von Betriebsweisen, die ohne Zuthun des Kapitals historisch überliefert sind. Es findet dann nur eine formelle Metamorphose statt, oder die kapitalistische Ausbeutungsweise unterscheidet sich von den früheren, wie Sklavensystem u. s. w., nur dadurch, dass die Mehrarbeit hier durch direkten Zwang abgerungen, dort durch „freiwilligen“ Verkauf der Arbeitskraft vermittelt wird. Die Produktion des absoluten Mehrwerths unterstellt also nur formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.
Die Produktion des relativen Mehrwerths setzt die Produktion des absoluten Mehrwerths voraus, also auch die entsprechende allgemeine Form der kapitalistischen Produktion. Ihr Zweck ist Erhöhung des Mehrwerths durch Verkürzung der nothwendigen Arbeitszeit, unabhängig von den Grenzen des Arbeitstags. Das Ziel wird erreicht durch Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Diess bedingt jedoch eine Revolution des Arbeitsprozesses selbst. Es genügt nicht mehr ihn zu verlängern, er muss neu gestaltet werden. Die Produktion des relativen Mehrwerths unterstellt also eine specifisch kapitalistische Produktionsweise, die mit ihren Methoden, Mitteln und Bedingungen selbst erst auf Grundlage der formellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital naturwüchsig entsteht und ausgebildet wird. An die Stelle der formellen tritt die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.
Es genügt blosser Hinweis auf Zwitterformen, worin die Mehrarbeit weder durch direkten Zwang dem Producenten ausgepumpt wird, noch auch dessen formelle Unterordnung unter das Kapital eingetreten ist. Das Kapital hat sich hier noch nicht unmittelbar des Arbeitsprozesses bemächtigt. Neben die selbstständigen Producenten, die in überlieferter, urväterlicher Betriebsweise handwerkern oder ackerbauen, tritt der Wucherer oder der Kaufmann, dasWucherkapital oder das Handelskapital, das sie parasitenmässig aussaugt. Vorherrschaft dieser
Exploitationsform in einer Gesellschaft schliesst die kapitalistische Produktionsweise aus, zu der sie andrerseits, wie im späteren Mittelalter, den Uebergang bilden kann. Endlich, wie das Beispiel der modernen Hausarbeit gezeigt, werden gewisse Zwitterformen auf dem Hintergrund der grossen Industrie stellenweis reproducirt, wenn auch mit gänzlich veränderter Physiognomie.
Wenn zur Produktion des absoluten Mehrwerths die bloss formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital genügt, z. B. dass Handwerker, die früher für sich selbst oder auch als Gesellen eines Zunftmeisters arbeiteten, nun als Lohnarbeiter unter die direkte Kontrole des Kapitalisten treten, zeigte sich andrerseits, wie die Methoden zur Produktion des relativen Mehrwerths zugleich Methoden zur Produktion des absoluten Mehrwerths sind. Ja die masslose Verlängerung des Arbeitstags stellte sich als eigenstes Produkt der grossen Industrie dar. Ueberhaupt hört die spezifisch kapitalistische Produktionsweise auf blosses Mittel zur Produktion des relativen Mehrwerths zu sein, sobald sie sich eines ganzen Produktionszweigs und noch mehr, sobald sie sich aller entscheidenden Produktionszweige bemächtigt hat. Sie wird jetzt allgemeine, gesellschaftlich herrschende Form des Produktionsprozesses. Als besondre Methode zur Produktion des relativen Mehrwerths wirkt sie nur noch, erstens soweit sie dem Kapital bisher nur formell untergeordnete Industrieen ergreift, also in ihrer Propaganda. Zweitens, soweit in den ihr bereits anheimgefallenen Industrieen fortwährende Revolution in der Anwendung der Maschinerie, der Naturkräfte und der Produktionsmethode überhaupt stattfindet.
Von gewissem Gesichtspunkt scheint der Unterschied zwischen absolutem und relativem Mehrwerth überhaupt illusorisch. Der relative Mehrwerth ist absolut, denn er bedingt absolute Verlängerung des Arbeitstags über die zur Existenz des Arbeiters selbst nothwendige Arbeitszeit. Der absolute Mehrwerth ist relativ, denn er bedingt eine Entwicklung der Arbeitsproduktivität, welche erlaubt, die nothwendige Arbeitszeit auf einen Theil des Arbeitstags zu beschränken. Fasst man aber die Bewegung des Mehrwerths ins Auge, so verschwindet dieser Schein der Einerleiheit. Die Produktivkraft der Arbeit und ihren Normalgrad von Intensivität gegeben, ist die Rate des Mehrwerths nur erhöhbar durch absolute Verlängerung des Arbeitstags.
Andrerseits ist die Rate des Mehrwerths nur erhöhbar, bei gegebner Grenze des Arbeitstags, durch relativen Grössenwechsel seiner Bestandtheile, der nothwendigen Arbeit und der Mehrarbeit, was seinerseits, soll der Lohn nicht unter den Werth der Arbeitskraft sinken, Wechsel in der Produktivität oder Intensivität der Arbeit voraussetzt.
Braucht der Arbeiter alle seine Zeit, um die zur Erhaltung seiner selbst und seiner Race nöthigen Lebensmittel zu produciren, so bleibt ihm keine Zeit, um unentgeldlich für dritte Personen zu arbeiten. Ohne einen gewissen Produktivitätsgrad der Arbeit keine solche disponible Zeit des Arbeiters, ohne solche überschüssige Zeit keine Mehrarbeit und daher keine Kapitalistenklasse. Ein gewisser Höhepunkt der Arbeitsproduktivität ist also überhaupt Existenzbedingung der kapitalistischen Produktion, wie aller früheren Produktionsweisen, worin ein Theil der Gesellschaft nicht nur für sich selbst, sondern auch für den andern arbeitet(FN 1).
So kann von einer Naturbasis des Mehrwerths gesprochen werden, aber nur in dem ganz allgemeinen Sinn, dass kein absolutes Naturhinderniss den einen abhält die zu seiner eignen Existenz nöthige Arbeit von sich selbst abund einem andern aufzuwälzen. Es sind durchaus nicht, wie es hier und da geschehn, mystische Vorstellungen mit dieser naturwüchsigen Produktivität der Arbeit zu verbinden. Nur sobald die Menschen sich aus ihren ersten Thierzuständen herausgearbeitet, ihre Arbeit selbst also schon in gewissem Grad vergesellschaftet ist, treten Verhältnisse ein, worin die Mehrarbeit des einen zur Existenzbedingung des andern wird. In den Kulturanfängen sind die erworbnen Produktivkräfte der Arbeit gering, aber so sind die Bedürfnisse, die sich mit und an den Mitteln ihrer Befriedigung entwickeln. Ferner ist in jenen Anfängen die Proportion der Gesellschaftstheile, die von fremder Arbeit leben, verschwindend klein gegen die Masse der unmittelbaren Producenten. Mit dem Fortschritt der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit wächst diese Proportion absolut und relativ(FN 2). Das Kapitalverhältniss
entspringt übrigens auf einem ökonomischen Boden, der das Produkt einer langen Reihe früherer Entwicklungsphasen ist. Die vorhandne Produktivität der Arbeit, wovon es als Grundlage ausgeht, ist nicht Gabe der Natur, sondern der Geschichte.
Von der mehr oder minder entwickelten Gestalt des gesellschaftlichen Produktionsprozesses abgesehn, bleibt die Produktivität der Arbeit an Naturbedingungen gebunden, und wechselt der Grad ihrer Produktivität mit dem Reichthum dieser Naturbedingungen. Sie sind alle rückführbar auf die Natur des Menschen selbst und die ihn umgebende Natur. Der grössere oder geringere Reichthum der menschlichen Natur hängt ab von Race, Boden und Klima. Die äussern Naturbedingungen zerfallen ökonomisch in zwei grosse Klassen, natürlicher Reichthum an Lebensmitteln, also Bodenfruchtbarkeit, fischreiche Gewässer u. s. w., und natürlicher Reichthum an Arbeitsmitteln, wie lebendige Wassergefälle, schiffbare Flüsse, Holz, Metalle, Kohle u. s. w. In den Kulturanfängen giebt die erstere, auf höherer Entwicklungsstufe die zweite Art des natürlichen Reichthums den Ausschlag. Man vergleiche z. B. England mit Indien oder, in der antiken Welt, Athen und Korinth mit den Uferländern des schwarzen Meeres.
Je geringer die Zahl der absolut zu befriedigenden Naturbedürfnisse, und je grösser die natürliche Bodenfruchtbarkeit und Gunst des Klimas, desto geringer die zur Erhaltung und Reproduktion des Producenten nothwendige Arbeitszeit. Desto grösser kann also der Ueberschuss seiner Arbeit für Andere über seine Arbeit für sich selbst sein. So bemerkt schon Diodor über die alten Aegypter: „Es ist ganz unglaublich, wie wenig Mühe und Kosten die Erziehung ihrer Kinder ihnen verursacht. Sie kochen ihnen die nächste beste einfache Speise; auch geben sie ihnen von der Papierstaude den unteren Theil zu essen, soweit man ihn im Feuer rösten kann, und die Wurzel und Stengel der Sumpfgewächse, theils roh, theils gesotten und gebraten. Die meisten Kinder gehn ohne Schuhe und unbekleidet, da die Luft so mild ist. Daher kostet ein Kind seinen Aeltern, bis es erwachsen ist, im Ganzen nicht über zwanzig Drachmen. Hieraus ist es hauptsächlich zu erklären, dass in Aegypten die Bevölkerung so zahlreich ist und
darum so viel grosse Werke angelegt werden konnten“(FN 3). Indess sind die grossen Bauwerke des alten Aegyptens dem Umfang seiner Bevölkerung weniger geschuldet als der grossen Proportion, worin sie disponibel war. Wie der individuelle Arbeiter um so mehr Mehrarbeit liefern kann, je geringer seine nothwendige Arbeitszeit, so, je geringer der zur Produktion der nothwendigen Lebensmittel erheischte Theil der Arbeiterbevölkerung, desto grösser der für andres Werk disponible Theil.
Die kapitalistische Produktion einmal vorausgesetzt, wird, unter sonst gleichbleibenden Umständen und bei gegebner Länge des Arbeitstags, die Grösse der Mehrarbeit mit den Naturbedingungen der Arbeit, namentlich auch der Bodenfruchtbarkeit, variiren. Es folgt aber keineswegs umgekehrt, dass der fruchtbarste Boden der geeignetste zum Wachsthum der kapitalistischen Produktionsweise. Sie unterstellt Herrschaft des Menschen über die Natur. Eine zu verschwenderische Natur „hält ihn an ihrer Hand wie ein Kind am Gängelband“. Sie macht seine eigne Entwicklung nicht zu einer Naturnothwendigkeit(FN 4). Nicht das tropische Klima mit seiner überwuchernden Vegetation, sondern die gemässigte Zone ist das Mutterland des Kapitals. Es ist nicht die absolute Fruchtbarkeit des Bodens, sondern seine Differenzirung, die Mannigfaltigkeit seiner natürlichen Produkte, welche die Naturgrundlage der gesellschaftlichen Theilung der Arbeit bildet, und den Menschen durch den Wechsel der Naturumstände, innerhalb deren er haust, zur Vermannigfachung seiner eignen Be-
dürfnisse, Fähigkeiten, Arbeitsmittel und Arbeitsweisen spornt. Die Nothwendigkeit eine Naturkraft gesellschaftlich zu kontroliren, damit Haus zu halten, sie durch Werke von Menschenhand auf grossem Massstab erst anzueignen oder zu zähmen, spielt die entscheidendste Rolle in der Geschichte der Industrie. So z. B. die Wasserreglung in Aegypten(FN 5), Lombardei, Holland u. s. w. Oder in Indien, Persien u. s. w., wo die Ueberrieselung durch künstliche Kanäle dem Boden nicht nur das unentbehrliche Wasser, sondern mit dessen Geschlämme zugleich den Mineraldünger von den Bergen zuführt. Das Geheimniss der Industrieblüthe von Spanien und Sicilien unter arabischer Herrschaft war die Kanalisation(FN 6).
Die Gunst der Naturbedingungen liefert immer nur die Möglichkeit, niemals die Wirklichkeit der Mehrarbeit, also des Mehrwerths oder des Surplusprodukts. Die verschiednen Naturbedingungen der Arbeit bewirken, dass dieselbe Quantität Arbeit in verschiednen Ländern verschiedne Bedürfnissmassen befriedigt(FN 7), dass also, unter sonst analogen
Umständen, die nothwendige Arbeitszeit verschieden ist. Auf die Mehrarbeit wirken sie nur als Naturschranke, d. h. durch die Bestimmung des Punkts, wo die Arbeit für Andre beginnen kann. In demselben Mass, worin die Industrie vortritt, weicht diese Naturschranke zurück. Mitten in der westeuropäischen Gesellschaft, wo der Arbeiter die Erlaubniss für seine eigne Existenz zu arbeiten nur durch Mehrarbeit erkauft, wird sich leicht eingebildet, es sei eine der menschlichen Arbeit eingeborne Qualität, ein Surplusprodukt zu liefern(FN 8). Man nehme aber z. B. den Einwohner der östlichen Inseln des asiatischen Archipelagus, wo der Sago wild im Walde wächst. „Wenn die Bewohner, indem sie ein Loch in den Baum bohren, sich davon überzeugt haben, dass das Mark reif ist, so wird der Stamm umgeschlagen und in mehrere Stücke getheilt, das Mark wird herausgekratzt, mit Wasser gemischt und geseiht, es ist dann vollkommen brauchbares Sagomehl. Ein Baum giebt gemeiniglich 300 Pfund und kann 5 bis 600 Pfund geben. Man geht dort also in den Wald und schneidet sich sein Brod, wie man bei uns sein Brennholz schlägt“(FN 9). Gesetzt ein solcher ostasiatischer Brodschneider brauche 12 Arbeitsstunden in der Woche zur Befriedigung aller seiner Bedürfnisse. Was ihm die Gunst der Natur unmittelbar giebt, ist viel Mussezeit. Damit er diese produktiv für sich selbst verwende, ist eine ganze Reihe geschichtlicher Umstände, damit er sie in Mehrarbeit für fremde Personen verausgabe, ist äusserer Zwang erheischt. Würde kapitalistische Produktion eingeführt, so müsste der Brave vielleicht 6 Tage in der Woche arbeiten, um sich selbst das Produkt eines Arbeitstags anzueignen. Die Gunst der Natur erklärt nicht, warum er jetzt 6 Tage in der Woche arbeitet oder warum er 5 Tage Mehrarbeit liefert. Sie erklärt nur, warum seine nothwendige Arbeitszeit auf einen Tag in der Woche beschränkt ist. In keinem Fall
aber entspränge sein Mehrprodukt aus einer der menschlichen Arbeit eingebornen, occulten Qualität.
Wie die geschichtlich entwickelten, gesellschaftlichen, so erscheinen die naturbedingten Produktivkräfte der Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals, dem sie einverleibt wird.
2) Grössenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth.↑In Kapitel III, 3. Abschnitt, analysirten wir die Rate des Mehrwerths, aber nur vom Standpunkt der Produktion des absoluten Mehrwerths. In Kapitel IV fanden wir zusätzliche Bestimmungen. Das Wesentliche ist hier zu späterem Gebrauch kurz zusammenzufassen.
Der Werth der Arbeitskraft ist bestimmt durch den Werth der gewohnheitsmässig nothwendigen Lebensmittel des Durchschnittsarbeiters. Die Masse dieser Lebensmittel, obgleich ihre Form wechseln mag, ist in einer bestimmten Epoche einer bestimmten Gesellschaft gegeben, und daher als constante Grösse zu behandeln. Was wechselt, ist der Werth dieser Masse. Zwei andre Faktoren gehn in die Werthbestimmung der Arbeitskraft ein. Einerseits ihre Entwicklungskosten, die sich mit der Produktionsweise ändern, andrerseits ihre Naturdifferenz, ob sie männlich oder weiblich, reif oder unreif. Der Verbrauch dieser differenten Arbeitskräfte, wieder bedingt durch die Produktionsweise, macht grossen Unterschied in den Reproduktionskosten der Arbeiterfamilie und dem Werth des erwachsnen männlichen Arbeiters. Beide Faktoren bleiben jedoch bei der folgenden Untersuchung ausgeschlossen.
Wir unterstellen, 1) dass die Waaren zu ihrem Werth verkauft werden, 2) dass der Preis der Arbeitskraft wohl gelegentlich über ihren Werth steigt, aber nie unter ihn sinkt.
Diess einmal unterstellt, fand sich, dass die relativen Grössen von Preis der Arbeitskraft und von Mehrwerth durch drei Umstände bedingt sind, die Länge des Arbeitstags oder die extensive Grösse der Arbeit, die normale Intensivität der Arbeit, oder ihre intensive Grösse, so dass bestimmtes Arbeitsquantum in bestimmter Zeit verausgabt wird, endlich die Produktivkraft der Arbeit, so dass je nach dem Entwicklungsgrad der Produktionsbedingungen dasselbe Quantum Arbeit in derselben Zeit ein grösseres oder kleineres Quantum Produkt liefert. Sehr verschiedne Kombinationen sind offenbar
möglich, je nachdem einer der drei Faktoren constant und zwei variabel, oder zwei Faktoren constant und einer variabel, oder endlich alle drei gleichzeitig variabel sind. Diese Kombinationen werden noch dadurch vermannigfacht, dass bei gleichzeitiger Variation verschiedner Faktoren die Grösse und Richtung der Variation verschieden sein können. Im Folgenden sind nur die Hauptkombinationen dargestellt.
Unter dieser Voraussetzung sind Werth der Arbeitskraft und Mehrwerth durch drei Gesetze bestimmt:
Erstens: Der Arbeitstag von gegebner Grösse stellt sich stets in demselben Werthprodukt dar, wie auch die Produktivität der Arbeit, mit ihr die Produktenmasse und daher der Preis der einzelnen Waare wechsle.
Das Werthprodukt eines zwölfstündigen Arbeitstags ist 6 sh. z. B., obgleich die Masse des producirten Gebrauchswerths mit der Produktivkraft der Arbeit wechselt, der Werth von 6 sh. sich also über mehr oder weniger Waaren vertheilt.
Zweitens: Werth der Arbeitskraft und Mehrwerth wechseln in umgekehrter Richtung zu einander und zum Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit.
Das Werthprodukt des zwölfstündigen Arbeitstags ist eine constante Grösse, z. B. 6 sh. Diese constante Grösse ist gleich der Summe des Mehrwerths plus dem Werth der Arbeitskraft, den der Arbeiter durch ein Aequivalent ersetzt. Es ist selbstverständlich, dass von zwei Theilen einer constanten Grösse keiner zunehmen kann, ohne dass der andre abnimmt und keiner abnehmen, ohne dass der andre zunimmt. Der Werth der Arbeitskraft kann nicht von 3 sh. auf 4 steigen, ohne dass der Mehrwerth von 3 sh. auf 2 fällt und der Mehrwerth kann nicht von 3 auf 4 sh. steigen, ohne dass der Werth der Arbeitskraft von 3 sh. auf 2 fällt. Unter diesen Umständen also ist kein Wechsel in der absoluten Grösse, sei es des Werths der Arbeitskraft, sei es des Mehrwerths, möglich ohne einen Wechsel ihrer relativen oder verhältnissmässigen Grössen. Es ist unmöglich, dass sie gleichzeitig fallen oder steigen.
Der Werth der Arbeitskraft kann ferner nicht fallen, also der Mehrwerth nicht steigen, ohne dass die Produktivkraft der Arbeit steigt, z. B. im obigen Fall kann der Werth der Arbeitskraft nicht von 3 auf 2 sh. sinken, ohne dass erhöhte Produktivkraft der Arbeit erlaubt in 4 Stunden dieselbe Masse Lebensmittel zu produciren, die vorher 6 Stunden zu ihrer Produktion erheischten. Umgekehrt kann der Werth der Arbeitskraft nicht von 3 auf 4 sh. steigen, ohne dass die Produktivkraft der Arbeit fällt, also 8 Stunden zur Produktion derselben Masse von Lebensmitteln erheischt sind, wozu früher 6 Stunden genügten. Dieselbe Richtung im Wechsel der Produktivkraft der Arbeit, ihre Zunahme oder Abnahme, wirkt in entgegengesetzter Richtung auf den gleichzeitigen Grössenwechsel von Werth der Arbeitskraft und Mehrwerth.
Bei Formulirung dieses Gesetzes übersah Ricardo einen Umstand: Obgleich der Wechsel in der Grösse des Mehrwerths oder der Mehrarbeit einen umgekehrten Wechsel in der Grösse des Werths der Arbeitskraft oder der nothwendigen Arbeit bedingt, folgt keineswegs, dass sie in demselben Verhältniss wechseln. Sie nehmen zu oder ab um dieselbe Grösse. Das Verhältniss aber, worin jeder Theil des Werthprodukts oder des Arbeitstags zuoder abnimmt, hängt von der ursprünglichen Theilung ab, die vor dem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit stattfand. War der Weith der Arbeitskraft z. B. 4 sh. oder die nothwendige Arbeitszeit gleich 8 Stunden, also der Mehrwerth 2 sh. oder die Mehrarbeit gleich 4 Stunden, und fällt, in Folge erhöhter Produktivkraft der Arbeit, der Werth der Arbeitskraft auf 3 sh. oder die nothwendige Arbeit auf 6 Stunden, so steigt der Mehrwerth auf 3 sh. oder die Mehrarbeit auf 6 Stunden. Es ist dieselbe Grösse von zwei Stunden oder 1 sh., die dort zugefügt, hier weggenommen wird. Aber das Verhältniss des Grössenwechsels ist auf beiden Seiten verschieden. Während der Werth der Arbeitskraft von 4 sh. auf 3, also um ¼ oder 25 % sinkt, steigt der Mehrwerth von 2 sh. auf 3, also um ½ oder 50 %. Es folgt daher, dass die proportionelle Zuoder Abnahme des Mehrwerths, in Folge eines gegebnen Wechsels in der Produktivkraft der Arbeit, um so grösser, je kleiner, und um so kleiner, je grösser ursprünglich der Theil des Arbeitstags war, der sich in Mehrwerth darstellt.
Drittens: Zuoder Abnahme des Mehrwerths ist stets
Folge und nie Grund der entsprechenden Aboder Zunahme des Werths der Arbeitskraft(FN 10).
Da der Arbeitstag von constanter Grösse ist, sich in einer constanten Werthgrösse darstellt, jedem Grössenwechsel des Mehrwerths ein umgekehrter Grössenwechsel im Werth der Arbeitskraft entspricht und der Werth der Arbeitskraft nur wechseln kann mit einem Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit, folgt unter diesen Bedingungen offenbar, dass jeder Grössenwechsel des Mehrwerths aus einem Grössenwechsel im Werth der Arbeitskraft entspringt. Wenn man daher gesehn, dass kein absoluter Grössenwechsel im Werth der Arbeitskraft und des Mehrwerths möglich ist ohne einen Wechsel ihrer relativen Grössen, so folgt jetzt, dass kein Wechsel ihrer relativen Werthgrössen möglich ist ohne einen Wechsel der absoluten Werthgrösse der Arbeitskraft.
Ricardo hat die eben aufgestellten drei Gesetze zuerst streng formulirt. Die Mängel seiner Darstellung sind, 1) dass er die besondern Bedingungen, innerhalb deren jene Gesetze gelten, als sich von selbst verstehende allgemeine und ausschliessliche Bedingungen der kapitalistischen Produktion voraussetzt; 2), und diess verfälscht seine Analyse in viel höherem Grad, dass er überhaupt den Mehrwerth nicht rein darstellt, d. h. nicht unabhängig von seinen besondern Formen, wie Profit, Grundrente u. s. w. Er wirft daher die Gesetze über die Rate des Mehrwerths unmittelbar zusammen mit den Gesetzen der Profitrate. Ich werde später, im 3. Buch dieser Schrift beweisen, dass dieselbe Rate des Mehrwerths sich in den verschiedensten Profitraten und verschiedne Raten des Mehrwerths, unter
bestimmten Umständen, sich in derselben Profitrate ausdrücken können.
Nach dem dritten Gesetz unterstellt der Grössenwechsel des Mehrwerths eine durch Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit verursachte Werthbewegung der Arbeitskraft. Die Grenze jenes Wechsels ist durch die neue Werthgrenze der Arbeitskraft gegeben. Es können aber, auch wenn die Umstände dem Gesetz zu wirken erlauben, Zwischenbewegungen stattfinden. Fällt z. B. in Folge erhöhter Produktivkraft der Arbeit der Werth der Arbeitskraft von 4 sh. auf 3, oder die nothwendige Arbeitszeit von 8 Stunden auf 6, so könnte der Preis der Arbeitskraft nur auf 3 sh. 8 d., 3 sh. 6 d., 3 sh. 2 d. u. s. w. fallen, der Mehrwerth daher nur auf 3 sh. 4 d., 3 sh. 6 d., 3 sh. 10 d. u. s. w. steigen. Der Grad des Falls, dessen Minimalgrenze 3 sh., hängt von dem relativen Gewicht ab, das der Druck des Kapitals von der einen Seite, der Widerstand der Arbeiter von der andern Seite in die Wagschale wirft.
Der Werth der Arbeitskraft ist bestimmt durch den Werth eines bestimmten Quantums von Lebensmitteln. Was mit der Produktivkraft der Arbeit wechselt, ist der Werth dieser Lebensmittel, nicht ihre Masse. Die Masse selbst kann, bei steigender Produktivkraft der Arbeit, für Arbeiter und Kapitalist gleichzeitig und in demselben Verhältniss wachsen, ohne irgend einen Grössenwechsel zwischen Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth. Ist z. B. der ursprüngliche Werth der Arbeitskraft gleich 3 sh. und beträgt die nothwendige Arbeitszeit 6 Stunden, ist der Mehrwerth ebenfalls gleich 3 sh. oder beträgt die Mehrarbeit auch 6 Stunden, so würde eine Verdopplung in der Produktivkraft der Arbeit, bei gleichbleibender Theilung des Arbeitstags, Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth unverändert lassen. Nur stellte sich jeder derselben in doppelt so vielen, aber verhältnissmässig verwohlfeilerten Gebrauchswerthen dar. Obgleich der Preis der Arbeitskraft unverändert, wäre er über ihren Werth gestiegen. Fiele der Preis der Arbeitskraft, aber nicht zur Minimalgrenze ihres neuen Werths von 1½ sh., sondern nur auf 2 sh. 10 d., 2 sh. 6 d. u. s. w., so repräsentirte dieser fallende Preis immer noch eine wachsende Masse von Lebensmitteln. Der Preis der Arbeitskraft könnte so bei steigender Produktivkraft der Arbeit beständig fallen mit gleichzeitigem, fortwährendem Wachsthum der Lebensmittelmasse des
Arbeiters. Relativ aber, d. h. verglichen mit dem Mehrwerth, sänke der Werth der Arbeitskraft beständig, und erweiterte sich also die Kluft zwischen den Lebenslagen von Arbeiter und Kapitalist(FN 11).
Wachsende Intensivität der Arbeit unterstellt vermehrte Ausgabe von Arbeit in demselben Zeitraum. Der intensivere Arbeitstag verkörpert sich daher in mehr Produkten als der minder intensive von gleicher Stundenzahl. Mit erhöhter Produktivkraft liefert zwar auch derselbe Arbeitstag mehr Produkte. Aber im letztern Fall sinkt der Werth des einzelnen Produkts, weil es weniger Arbeit als vorher kostet, im erstern Fall bleibt er unverändert, weil das Produkt nach wie vor gleich viel Arbeit kostet. Die Zahl der Produkte steigt hier ohne Fall ihres Preises. Mit ihrer Anzahl wächst ihre Preissumme, während dort dieselbe Werthsumme sich nur in vergrösserter Produktenmasse darstellt. Bei gleichbleibender Stundenzahl verkörpert sich also der intensivere Arbeitstag in höherem Werthprodukt, also, bei gleichbleibendem Werth des Geldes, in mehr Geld. Sein Werthprodukt variirt mit den Abweichungen seiner Intensivität von dem gesellschaftlichen Normalgrad. Derselbe Arbeitstag stellt sich also nicht wie vorher in einem constanten, sondern in einem variablen Werthprodukt dar, der intensivere, zwölfstündige Arbeitstag z. B. in 7 sh., 8 sh u. s. w. statt in 6 sh. wie der zwölfstündige Arbeitstag von gewöhnlicher Intensivität. Es ist klar: Variirt das Werthprodukt des Arbeitstags, etwa von 6 auf 8 sh., so können beide Theile dieses Werthprodukts, Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth, gleichzeitig wachsen, sei es in gleichem oder ungleichem Grad. Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth können beide zur selben Zeit von 3 sh. auf 4 wachsen, wenn das Werthprodukt von 6 auf 8 sh. steigt. Preiserhöhung der Arbeitskraft schliesst hier nicht nothwendig Steigerung ihres Preises über ihren Werth ein. Sie kann umgekehrt von einem Fall ihres Werths begleitet scin. Diess findet stets statt, wenn die Preiser-
höhung der Arbeitskraft ihren beschleunigten Versch’eiss nicht kompensirt.
Man weiss, dass mit vorübergehenden, im vorigen Kapitel erklärten Ausnahmen, veränderte Produktivität der Arbeit nur dann einen Grössenwechsel im Werth der Arbeitskraft und daher in der Grösse des Mehrwerths bewirkt, wenn die Produkte der betroffenen Industriezweige in den gewohnheitsmässigen Konsum des Arbeiters eingehen. Diese Schranke fällt hier fort. Ob die Grösse der Arbeit extensiv oder intensiv wechsle, ihrem Grössenwechsel entspricht ein Wechsel in der Grösse ihres Werthprodukts, unabhängig von der Natur des Artikels, worin sich dieser Werth darstellt.
Steigerte sich die Intensivität der Arbeit in allen Industriezweigen, so würde der neue höhere Intensivitätsgrad nun seinerseits zum gewöhnlichen gesellschaftlichen Normalgrad der Arbeit und hörte damit auf als extensive Grösse zu zählen. Indess blieben selbst dann die durchschnittlichen Intensivitätsgrade der Arbeit bei verschiednen Nationen verschieden und modificirten daher die Anwendung des Werthgesetzes auf unterschiedne Nationalarbeitstage. Der intensivere Arbeitstag der einen Nation stellt sich in höherem Geldausdruck dar als der minder intensive der andern(FN 12).
Der Arbeitstag kann nach zwei Richtungen variiren. Er kann verkürzt oder verlängert werden.
Verkürzung des Arbeitstags unter den gegebnen Bedingungen, d. h. gleichbleibender Produktivkraft und Intensivität der Arbeit, lässt den Werth der Arbeitskraft und daher die nothwendige Arbeitszeit unverändert. Sie verkürzt die Mehrarbeit und den Mehrwerth. Mit der absoluten Grösse des letztern fällt auch seine relative Grösse, d. h. seine Grösse im Verhältniss zur gleichbleibenden Werthgrösse der Arbeits-
kraft. Nur durch Herabdrückung ihres Preises unter ihren Werth könnte der Kapitalist sich schadlos halten.
Alle hergebrachten Redensarten wider die Verkürzung des Arbeitstags unterstellen, dass das Phänomen sich unter den hier vorausgesetzten Umständen ereignet, während in der Wirklichkeit umgekehrt Wechsel in der Produktivität und Intensivität der Arbeit entweder der Verkürzung des Arbeitstags vorhergehn oder ihr unmittelbar nachfolgen(FN 13).
Verlängerung des Arbeitstags. Die nothwendige Arbeitszeit sei gleich 6 Stunden oder der Werth der Arbeitskraft gleich 3 sh., ebenso Mehrarbeit gleich 6 Stunden und Mehrwerth gleich 3 sh. Der Gesammtarbeitstag beträgt dann 12 Stunden und stellt sich in einem Werthprodukt von 6 sh. dar. Wird der Arbeitstag um 2 Stunden verlängert und bleibt der Preis der Arbeitskraft unverändert, so wächst mit der absoluten die relative Grösse des Mehrwerths. Obgleich die Werthgrösse der Arbeitskraft absolut unverändert bleibt, fällt sie relativ. Unter den Bedingungen von A) konnte die relative Werthgrösse der Arbeitskraft nicht wechseln ohne einen Wechsel ihrer absoluten Grösse. Hier, im Gegentheil, ist der relative Grössenwechsel im Werth der Arbeitskraft das Resultat eines absoluten Grössenwechsels des Mehrwerths.
Da das Werthprodukt, worin sich der Arbeitstag darstellt, mit seiner eignen Verlängerung wächst, können Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth gleichzeitig wachsen, sei es um gleiches oder ungleiches Increment. Diess gleichzeitige Wachsthum ist also in zwei Fällen möglich, bei absoluter Verlängerung des Arbeitstags, und bei wachsender Intensivität der Arbeit ohne solche Verlängerung.
Mit verlängertem Arbeitstag kann der Preis der Arbeitskraft unter ihren Werth fallen, obgleich er nominell unverändert bleibt oder selbst steigt. Der Tageswerth der Arbeitskraft ist nämlich, wie man sich erinnern wird, geschätzt auf ihre normale Durchschnittsdauer oder die normale Lebensperiode des Arbeiters, und auf entsprechenden, normalen, der Menschennatur angemessenen Umsatz von Lebenssubstanz in Bewe-
gung(FN 14). Bis zu einem gewissen Punkt kann der von Verlängerung des Arbeitstags untrennbare grössere Verschleiss der Arbeitskraft durch grösseren Ersatz kompensirt werden. Ueber diesen Punkt hinaus wächst der Verschleiss in geometrischer Progression und werden zugleich alle normalen Reproduktionsund Bethätigungsbedingungen der Arbeitskraft zerstört. Der Preis der Arbeitskraft und ihr Exploitationsgrad hören auf mit einander kommensurable Grössen zu sein.
Es ist hier offenbar eine grosse Anzahl Kombinationen möglich. Je zwei Faktoren können variiren und einer constant bleiben, oder alle drei können gleichzeitig variiren. Sie können in gleichem oder ungleichem Grad variiren, in derselben oder entgegengesetzter Richtung, ihre Variationen sich daher theilweis oder ganz aufheben. Indess ist die Analyse aller möglichen Fälle nach den unter A) B) und C) gegebnen Aufschlüssen leicht. Man findet das Resultat jeder möglichen Kombination, indem man der Reihe nach je einen Faktor als variabel und die andern zunächst als constant behandelt. Wir nehmen hier daher nur noch kurze Notiz von zwei wichtigen Fällen.
Abnehmende Produktivkraft der Arbeit mit gleichzeitiger Verlängerung des Arbeitstags.
Wenn wir hier von abnehmender Produktivkraft der Arbeit sprechen, so handelt es sich von Arbeitszweigen, deren Produkte den Werth der Arbeitskraft bestimmen, also z. B. von abnehmender Produktivkraft der Arbeit in Folge zunehmender Unfruchtbarkeit des Bodens und entsprechender Vertheurung der Bodenprodukte. Der Arbeitstag sei zwölfstündig, sein Werthprodukt 6 sh., wovon die Hälfte den Werth der Arbeitskraft ersetzt, die andre Hälfte Mehrwerth bildet. Der Arbeitstag zerfällt also in 6 Stunden nothwendiger Arbeit und 6 Stunden Mehrarbeit. In Folge der Vertheurung der Bodenprodukte steige der Werth der Arbeitskraft von 3 auf 4 sh.,
also die nothwendige Arbeitszeit von 6 auf 8 Stunden. Bleibt der Arbeitstag unverändert, so fällt die Mehrarbeit von 6 auf 4 Stunden, der Mehrwerth von 3 auf 2 sh. Wird der Arbeitstag um 2 Stunden verlängert, also von 12 auf 14 Stunden, so bleibt die Mehrarbeit 6 Stunden, der Mehrwerth 3 sh., aber seine Grösse im Vergleich zum Werth der Arbeitskraft, gemessen durch die nothwendige Arbeit, fällt. Wird der Arbeitstag um 4 Stunden verlängert, von 12 auf 16 Stunden, so bleiben die proportionellen Grössen von Mehrwerth und Werth der Arbeitskraft, Mehrarbeit und nothwendiger Arbeit unverändert, aber die absolute Grösse des Mehrwerths wächst von 3 auf 4 sh., die der Mehrarbeit von 6 auf 8 Arbeitsstunden, also um ⅓ oder 33⅓ %. Bei abnehmender Produktivkraft der Arbeit und gleichzeitiger Verlängerung des Arbeitstags kann also die absolute Grösse des Mehrwerths unverändert bleiben, während seine proportionelle Grösse fällt; seine proportionelle Grösse kann unverändert bleiben, während seine absolute Grösse wächst, und, je nach dem Grad der Verlängerung, können beide wachsen. Diess ist eine der Ursachen, warum in England von 1799—1815, grade als West, Ricardo u. s. w. den nur in ihrer Phantasie durch Vertheurung der Bodenprodukte bewirkten Fall der Rate des Mehrwerths zum Ausgangspunkt wichtiger Analysen machten, der Mehrwerth absolut und relativ stieg, und daher zugleich beschleunigtes Wachsthum des Kapitals und Verpauperung der Arbeiter stattfanden(FN 15). Es war diess die Periode, worin die masslose Verlängerung des Arbeitstags sich Bürgerrecht erwarb(FN 16).
Zunehmende Intensivität und Produktivkraft der Arbeit mit gleichzeitiger Verkürzung des Arbeitstags.
Gesteigerte Produktivkraft der Arbeit und ihre wachsende Intensivität wirken nach einer Seite hin gleichförmig. Beide vermehren die Produktenmasse in gegebnem Zeitraum. Beide verkürzen also den Theil des Arbeitstags, den der Arbeiter zur Produktion seiner Lebensmittel oder ihres Aequivalents braucht. Die absolute Grenze des Arbeitstags wird überhaupt gebildet durch diesen seinen nothwendigen, aber kontraktilen Bestandtheil. Schrumpfte darauf der ganze Arbeitstag zusammen, so verschwände die Mehrarbeit, was unter dem Regime des Kapitals unmöglich. Die Beseitigung der kapitalistischen Produktionsform erlaubt den Arbeitstag durch die nothwendige Arbeit zu beschränken. Jedoch würde die letztere mit ihrem Begriff, unter sonst gleichbleibenden Umständen, auch ihren Raum ausdehnen. Einerseits weil die Lebensbedingungen des Arbeiters reicher und seine Lebensansprüche grösser. Andrerseits würde ein Theil der jetzigen Mehrarbeit zur noth-
wendigen Arbeit zählen, nämlich die zur Erzielung eines gesellschaftlichen Reservefonds und Accumulationsfonds nöthige Arbeit.
Je mehr die Produktivkraft der Arbeit wächst, um so mehr kann der Arbeitstag verkürzt werden, und je mehr der Arbeitstag verkürzt wird, desto mehr kann die Intensivität der Arbeit wachsen. Die Produktivkraft der Arbeit wächst, gesellschaftlich betrachtet, auch mit der Oekonomie derselben. Diese schliesst nicht nur die Oekonomisirung der Produktionsmittel ein, sondern die Vermeidung aller nutzlosen Arbeit. Während die kapitalistische Produktionsweise in jedem individuellen Geschäft Oekonomie erzwingt, erzeugt ihr anarchisches System der Konkurrenz die massloseste Verschwendung der gesellschaftlichen Produktionsmittel und Arbeitskräfte, neben einer Unzahljetzt unentbehrlicher, aber an und für sich überflüssiger Funktionen.
Intensivität und Produktivkraft der Arbeit gegeben, ist der zur materiellen Produktion nothwendige Theil des gesellschaftlichen Arbeitstags um so kürzer, der für freie, geistige und gesellschaftliche Bethätigung der Individuen eroberte Zeittheil also um so grösser, je gleichmässiger die Arbeit unter alle werkfähigen Glieder der Gesellschaft vertheilt ist, je weniger eine Gesellschaftsschichte die Naturnothwendigkeit der Arbeit von sich selbst abund einer andern Schichte zuwälzen kann. Die absolute Grenze für die Verkürzung des Arbeitstags ist nach dieser Seite hin die Allgemeinheit der Arbeit. In der kapitalistischen Gesellschaft wird freie Zeit für eine Klasse producirt durch Verwandlung aller Lebenszeit der Massen in Arbeitszeit.
3) Verschiedne Formeln für die Rate des Mehrwerths.↑Man hat gesehn, dass die Rate des Mehrwerths sich darstellt in den Formeln:
I) [Formel 1] . Die zwei ersten Formeln stellen als Verhältniss von Werthen dar, was die dritte als Verhältniss der Zeiten, worin diese Werthe producirt werden. Diese einander ersetzenden Formeln sind begrifflich streng. Man findet sie daher wohl der Sache nach, aber nicht bewusst ausgearbeitet in der klassischen politischen Oekonomie. Hier begegnen wir dagegen den folgenden abgeleiteten Formeln.
II) [Formel 1] . Eine und dieselbe Proportion ist hier abwechselnd ausgedrückt in der Form der Arbeitszeiten, der Werthe, worin sie sich verkörpern, der Produkte, worin diese Werthe existiren. Es wird natürlich unterstellt, dass unter Werth des Produkts nur das Werthprodukt des Arbeitstags zu verstehn, der constante Theil des Produktenwerths aber ausgeschlossen ist.
In allen diesen Formeln ist der wirkliche Exploitationsgrad der Arbeit oder die Rate des Mehrwerths falsch ausgedrückt. Der Arbeitstag sei 12 Stunden. Mit den andern Annahmen unsres früheren Beispiels stellt sich in diesem Fall der wirkliche Exploitationsgrad der Arbeit dar in den Proportionen: [Formel 2] [Formel 3] . Nach den Formeln II) erhalten wir dagegen: [Formel 4] = 50 %.
Diese abgeleiteten Formeln drücken in der That die Proportion aus, worin der Arbeitstag oder sein Werthprodukt sich zwischen Kapitalist und Arbeiter theilt. Gelten sie daher als unmittelbare Ausdrücke des Selbstverwerthungsgrades des Kapitals, so gilt das falsche Gesetz: die Mehrarbeit oder der Mehrwerth kann nie 100 % erreichen(FN 17). Da die Mehrarbeit stets nur einen aliquoten Theil des Arbeitstags oder der Mehrwerth stets nur einen aliquoten Theil des Werthprodukts bilden kann, ist die Mehrarbeit nothwendiger Weise stets kleiner als der Arbeitstag oder der Mehrwerth stets kleiner als das Werthprodukt. Um sich zu verhalten wie , müssten sie aber gleich
sein. Damit die Mehrarbeit den ganzen Arbeitstag absorbire (es handelt sich hier um den Durchschnittstag der Arbeitswoche, des Arbeitsjahrs u. s. w.), müsste die nothwendige Arbeit auf Null sinken. Verschwindet aber die nothwendige Arbeit, so verschwindet auch die Mehrarbeit, da letztre nur eine Funktion der erstern. Die Proportion =
kann also niemals die Grenze
erreichen und noch weniger auf
steigen. Wohl aber die Rate des Mehrwerths oder der wirkliche Exploitationsgrad der Arbeit. Nimm z. B. die Schätzung des Herrn L. de Lavergne, wonach der englische Ackerbauarbeiter nur ¼, der Kapitalist (Pächter) dagegen ¾ des Produkts(FN 18) oder seines Werths erhält, wie die Beute sich immer zwischen Kapitalist und Grundeigenthümer u. s. w. nachträglich weiter vertheile. Die Mehrarbeit des englischen Landarbeiters verhält sich danach zu seiner nothwendigen Arbeit = 3 : 1, ein Prozentsatz der Exploitation von 300 %.
Die Schulmethode, den Arbeitstag als constante Grösse zu behandeln, wurde durch Anwendung der Formeln II) befestigt, weil man hier die Mehrarbeit stets mit einem Arbeitstag von gegebner Grösse vergleicht. Ebenso, wenn die Theilung des Werthprodukts ausschliesslich in’s Auge gefasst wird. Der Arbeitstag, der sich bereits in einem Werthprodukt vergegenständlicht hat, ist stets ein Arbeitstag von gegebnen Grenzen.
Die Darstellung von Mehrwerth und Werth der Arbeitskraft als Bruchtheilen des Werthprodukts — eine Darstellungsweise, die übrigens aus der kapitalistischen Produktionsweise selbst erwächst und deren Bedeutung sich später erschliessen wird — versteckt den spezifischen Charakter des Kapitalverhältnisses, nämlich den Austausch des variablen Kapitals mit der lebendigen Arbeitskraft, und den entsprechenden Ausschluss des Arbeiters vom Produkt. An die Stelle tritt der
falsche Schein eines Associationsverhältnisses, worin Arbeiter und Kapitalist das Produkt nach dem Verhältniss seiner verschiednen Bildungsfaktoren theilen(FN 19).
Uebrigens sind die Formeln II stets in die Formeln I rückverwandelbar. Haben wir z. B. , so ist die nothwendige Arbeitszeit = Arbeitstag von zwölf Stunden — Mehrarbeit von sechs Stunden, und so ergiebt sich:
=
.
Eine dritte Formel, die ich gelegentlich schon anticipirt habe, ist:
III) =
=
.
Das Missverständniss, wozu die Formel verleiten könnte, als zahle der Kapitalist die Arbeit und nicht die Arbeitskraft, fällt nach der früher gegebnen Entwicklung fort.
ist nur populärer Ausdruck für
. Der Kapitalist zahlt den Werth, resp. davon abweichenden Preis der Arbeitskraft, und erhält im Austausch die Verfügung über die lebendige Arbeitskraft selbst. Seine Nutzniessung dieser Arbeitskraft zerfällt in zwei Perioden. Während der einen Periode producirt der Arbeiter nur einen Werth = Werth seiner Arbeitskraft, also nur ein Aequivalent. Für den vorgeschossnen Preis der Arbeitskraft erhält der Kapitalist so ein Produkt vom selben Preis. Es ist als ob er das Produkt fertig auf dem Markt gekauft hätte. In der Periode der Mehrarbeit dagegen bildet die Nutzniessung der Arbeitskraft Werth für
den Kapitalisten, ohne ihm einen Werthersatz zu kosten(FN 20). Er hat diese Flüssigmachung der Arbeitskraft umsonst. In diesem Sinn kann diese Mehrarbeit unbezahlte Arbeit heissen.
Das Kapital ist also nicht nur Kommando über Arbeit, wie A. Smith sagt. Es ist wesentlich Kommando über unbezahlte Arbeit. Aller Mehrwerth, in welcher besondern Gestalt von Profit, Zins, Rente u. s. w. er sich später krystallisire, ist seiner Substanz nach Materiatur unbezahlter Arbeitszeit. Das Geheimniss von der Selbstverwerthung des Kapitals löst sich auf in seine Verfügung über ein bestimmtes Quantum unbezahlter fremder Arbeit.
4) Werth, resp. Preis der Arbeitskraft in der verwandelten Form des Arbeitslohns.↑Auf der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft erscheint der Lohn des Arbeiters als Lohn der Arbeit, ein bestimmtes Quantum Geld, das für ein bestimmtes Quantum Arbeit gezahlt wird. Man spricht hier von einem Werth der Arbeit und nennt den Geldausdruck dieses Werths den nothwendigen oder natürlichen Preis der Arbeit. Man spricht andrerseits von Marktpreisen der Arbeit, d. h. über oder unter ihrem nothwendigen Preis oscillirenden Preisen.
Aber was ist der Werth einer Waare? Die Vergegenständlichung der zu ihrer Produktion gesellschaftlich nothwendigen Arbeit. Und wodurch messen wir die Grösse ihres Werths? Durch die Grösse der in ihr enthaltenen Arbeitszeit. Wodurch wäre also der Werth z. B. eines zwölfstündigen Arbeitstags bestimmt? Durch die in einem Arbeitstag von 12 Stunden enthaltenen 12 Arbeitsstunden, was eine abgeschmackte Tautologie ist(FN 21).
Um als Waare auf dem Markt verkauft zu werden, müsste die Arbeit jedenfalls existiren, bevor sie verkauft wird. Könnte der Arbeiter ihr aber eine selbstständige Existenz geben, so würde er Waare verkaufen und nicht Arbeit(FN 22).
Von diesen Widersprüchen abgesehn, würde ein direkter Austausch von Geld, d. h. vergegenständlichter Arbeit, mit lebendiger Arbeit entweder das Werthgesetz aufheben, welches sich grade erst auf Grundlage der kapitalistischen Produktion frei entwickelt, oder die kapitalistische Produktion selbst aufheben, welche grade auf der Lohnarbeit beruht. Der Arbeitstag von 12 Stunden stellt sich z. B. in einem Geldwerth von 6 sh. dar. Werden Aequivalente ausgetauscht, so erhält der Arbeiter für zwölfstündige Arbeit 6 sh. Der Preis seiner Arbeit wäre gleich dem Preis seines Produkts. In diesem Fall producirte er keinen Mehrwerth für den Käufer seiner Arbeit, die 6 sh. verwandelten sich nicht in Kapital, die Grundlage der kapitalistischen Produktion verschwände, aber grade auf dieser Grundlage verkauft er seine Arbeit und ist seine Arbeit wesentlich Lohnarbeit. Oder er erhält für 12 Stunden Arbeit weniger als 6 sh., d. h. weniger als 12 Stunden Arbeit. Zwölf Stunden Arbeit tauschen sich aus gegen 10, 6 u. s. w. Stunden Arbeit. Diese Gleichsetzung ungleicher Grössen hebt nicht nur die Werthbestimmung auf. Ein
solcher sich selbst aufhebender Widerspruch kann überhaupt nicht als Gesetz auch nur ausgesprochen oder formulirt werden(FN 23).
Es nützt nichts den Austausch von mehr Arbeit gegen weniger Arbeit aus dem Formunterschied der Arbeit herzuleiten, dass sie nämlich das einemal vergegenständlicht, das andremal lebendig ist(FN 24). Diess ist um so abgeschmackter als der Werth einer Waare nicht durch das Quantum wirklich in ihr vergegenständlichter, sondern durch das Quantum der zu ihrer Reproduktion nothwendigen lebendigen Arbeit bestimmt wird. Eine Waare stelle z. B. 6 Arbeitsstunden dar. Werden Erfindungen gemacht, wodurch sie in 3 Stunden producirt werden kann, so sinkt der Werth auch der bereits producirten Waare um die Hälfte. Sie stellt jetzt 3 statt früher 6 Stunden nothwendige gesellschaftliche Arbeit dar. Es ist also das zu ihrer Produktion erheischte Quantum Arbeit, nicht deren gegenständliche Form, wodurch ihre Werthgrösse bestimmt wird.
Was dem Geldbesitzer auf dem Waarenmarkt direkt gegenübertritt, ist in der That nicht die Arbeit, sondern der Arbeiter. Was letztrer verkauft, ist seine Arbeitskraft. Sobald seine Arbeit wirklich beginnt, hat sie bereits aufgehört ihm zu gehören, kann also nicht mehr von ihm verkauft werden. Die Arbeit ist die Substanz und das immanente Mass der Werthe, aber sie selbst hat keinen Werth(FN 25).
Im Ausdruck: Werth der Arbeit ist der Werthbegriff nicht nur völlig ausgelöscht, sondern in sein Gegentheil verkehrt. Es ist ein imaginärer Ausdruck wie etwa Werth der Erde. Diese imaginären Ausdrücke entspringen jedoch aus den Produktionsverhältnissen selbst. Sie sind Kategorieen für Erscheinungsformen wesentlicher Werthverhältnisse. Dass in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, ausser in der politischen Oekonomie(FN 26).
Die klassische politische Oekonomie entlehnte dem Alltagsleben ohne weitere Kritik die Kategorie Preis der Arbeit, um sich dann hinterher zu fragen, wie wird dieser Preis bestimmt? Sie erkannte bald, dass der Wechsel im Verhältniss von Nachfrage und Zufuhr für den Preis der Arbeit, gleich dem jeder andern Waare, nichts erklärt ausser dem Wechsel des Preises, die Oscillationen der Marktpreise unter oder über eine gewisse Grösse. Decken sich Nachfrage und Zufuhr, so hört, unter sonst gleichbleibenden Umständen, die Preisoscillation auf. Aber dann hören auch Nachfrage und Zufuhr auf irgend etwas zu erklären. Der Preis der
Arbeit, wenn Nachfrage und Zufuhr sich decken, ist der vom Verhältniss der Nachfrage und Zufuhr unabhängig bestimmte Preis der Arbeit, ihr natürlicher Preis, der so als der eigentliche Gegenstand der Analyse gefunden ward. Oder man nahm eine längere Periode der Oscillationen des Marktpreises, z. B. ein Jahr, und fand dann, dass sich ihr Auf und Ab ausgleicht zu einer mittlern Durchschnittsgrösse, einer constanten Grösse. Sie musste natürlich anders bestimmt werden als die sich kompensirenden Abweichungen von ihr selbst. Dieser über die zufälligen Marktpreise der Arbeit übergreifende und sie regulirende Preis, nothwendige Preis (Physiokraten) oder „ natürliche Preis der Arbeit“ (Adam Smith) kann, wie bei andern Waaren, nur ihr in Geld ausgedrückter Werth sein. In dieser Art glaubte die politische Oekonomie durch die zufälligen Preise der Arbeit zu ihrem Werth vorzudringen. Wie bei den andern Waaren wurde dieser Werth dann weiter durch die Produktionskosten bestimmt. Aber was sind die Produktionskosten — des Arbeiters, d. h. die Kosten, um den Arbeiter selbst zu produciren oder zu reproduciren? Diese Frage schob sich der politischen Oekonomie bewusstlos für die ursprüngliche unter, da sie mit den Produktionskosten der Arbeit als solcher sich im Kreise drehte und nicht vom Flecke kam. Was sie also Werth der Arbeit (value of labour) nennt, ist in der That der Werth der Arbeitskraft, die in der Persönlichkeit des Arbeiters existirt, und von ihrer Funktion, der Arbeit, ebenso verschieden ist, wie eine Maschine von ihren Operationen. Beschäftigt mit dem Unterschied zwischen den Marktpreisen der Arbeit und ihrem s. g. Werth, mit dem Verhältniss dieses Werths zur Profitrate, zu den vermittelst der Arbeit producirten Waarenwerthen u. s. w., entdeckte man niemals, dass der Gang der Analyse nicht nur von den Marktpreisen der Arbeit zu ihrem Werth, sondern dahin geführt hatte, diesen Werth der Arbeit selbst wieder aufzulösen in den Werth der Arbeitskraft. Die Bewusstlosigkeit über diess Resultat ihrer eignen Analyse, die kritiklose Annahme der Kategorieen Werth der Arbeit, natürlicher Preis der Arbeit u. s. w. als letzter adäquater Ausdrücke des behandelten Werthverhältnisses, verwickelte, wie man später sehn wird, die klassische politische Oekonomie in unauflösbare Wirren und Widersprüche, während sie der Vulgärökonomie eine sichre Operationsbasis für ihre principiell nur dem Schein huldigende Flachheit bot.
Sehn wir nun zunächst, wie Werth und Preise der Arbeitskraft in ihrer verwandelten Form als Arbeitslohn sich darstellen.
Man weiss, dass der Tageswerth der Arbeitskraft berechnet ist auf eine gewisse Lebensdauer des Arbeiters, welcher eine gewisse Länge des Arbeitstags entspricht. Nimm an, der gewohnheitsmässige Arbeitstag betrage 12 Stunden und der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., der Geldausdruck eines Werths, worin sich 6 Arbeitsstunden darstellen. Erhält der Arbeiter 3 sh., so erhält er den Werth seiner während 12 Stunden funktionirenden Arbeitskraft. Wird nun dieser Tageswerth der Arbeitskraft als Werth der Tagesarbeit ausgedrückt, so ergiebt sich die Formel: Die zwölfstündige Arbeit hat einen Werth von 3 sh. Der Werth der Arbeitskraft bestimmt so den Werth der Arbeit oder, in Geld ausgedrückt, ihren nothwendigen Preis. Weicht dagegen der Preis der Arbeitskraft von ihrem Werth ab, so ebenfalls der Preis der Arbeit von ihrem s. g. Werth.
Da der Werth der Arbeit nur ein irrationeller Ausdruck für den Werth der Arbeitskraft, ergiebt sich von selbst, dass der Werth der Arbeit stets kleiner sein muss als ihr Werthprodukt, denn der Kapitalist lässt die Arbeitskraft stets länger funktioniren als zur Reproduktion ihres eignen Werths nöthig ist. Im obigen Beispiel ist der Werth der während 12 Stunden funktionirenden Arbeitskraft 3 sh., ein Werth, zu dessen Reproduktion sie 6 Stunden braucht. Ihr Werthprodukt ist dagegen 6 sh., weil sie in der That während 12 Stunden funktionirt, und ihr Werthprodukt nicht von ihrem eignen Werthe, sondern von der Zeitdauer ihrer Funktion abhängt. Man erhält so das auf den ersten Blick abgeschmackte Resultat, dass Arbeit, die einen Werth von 6 sh. schafft, einen Werth von 3 sh. besitzt(FN 27).
Man sieht ferner, dass der Werth von 3 sh., worin sich der bezahlte Theil des Arbeitstags, d. h. sechsstündige Arbeit darstellt, als Werth oder Preis des Gesammtarbeitstags von 12 Stunden, darunter 6 unbezahlte Stunden, er-
scheint. Die Form des Arbeitslohnes löscht also jede Spur der Theilung des Arbeitstags in nothwendige Arbeit und Mehrarbeit, in bezahlte und unbezahlte Arbeit völlig aus. Alle Arbeit erscheint als bezahlte Arbeit. Bei der Frohnarbeit unterscheiden sich räumlich und zeitlich, handgreiflich sinnlich, die Arbeit des Fröhners für sich selbst und die Zwangsarbeit für seinen Grundherrn. Bei der Sklavenarbeit erscheint selbst der Theil des Arbeitstags, worin der Sklave nur den Werth seiner eignen Lebensmittel ersetzt, den er in der That also für sich selbst arbeitet, als Arbeit für seinen Meister. Alle seine Arbeit erscheint als unbezahlte Arbeit(FN 28). Bei der Lohnarbeit erscheint umgekehrt selbst die Mehrarbeit oder unbezahlte Arbeit als bezahlt. Dort verbirgt das Eigenthumsverhältniss das Fürsichselbst arbeiten des Sklaven, hier das Geldverhältniss das Umsonstarbeiten des Lohnarbeiters.
Man begreift also, von welcher entscheidenden Wichtigkeit die Formverwandlung von Werth und Preis der Arbeitskraft in Arbeitslohn oder in Werth und Preis der Arbeit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältniss unsichtbar macht und grade sein Gegentheil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie.
Braucht die Weltgeschichte viele Zeit, um hinter das Geheimniss des Arbeitslohns zu kommen, so ist dagegen nichts leichter zu verstehn als die Nothwendigkeit, die raisons d’être dieser Erscheinungsform.
Der Austausch zwischen Kapital und Arbeit stellt sich der Wahrnehmung zunächst ganz in derselben Art dar wie der Kauf und Verkauf aller andern Waaren. Der Käufer giebt eine gewisse Geldsumme, der Verkäu-
fer einen von Geld verschiedenen Artikel. Das Rechtsbewusstsein erkennt hier höchstens einen stofflichen Unterschied, der sich in den rechtlich äquivalenten Formeln: Do ut des, do ut facias, facio ut des und facio ut facias, ausdrückt.
Aller Kauf und Verkauf von Waaren ist ferner von der Illusion begleitet, dass das, was gezahlt wird, der Gebrauchswerth der Waare ist, obgleich diese Illusion schon über die einfache Thatsache stolpert, dass die verschiedensten Artikel denselben Preis und derselbe Artikel, ohne dass sich sein Gebrauchswerth oder das Bedürfniss dafür ändert, wechselnde Preise hat. Da aber Tauschwerth und Gebrauchswerth an und für sich inkommensurable Grössen sind, so existirt von diesem Standpunkt keine grössere Irrationalität in dem Ausdruck „Werth der Arbeit“, „Preis der Arbeit“ als in dem Ausdruck „Werth der Baumwolle“, „Preis der Baumwolle“. Das Missverständniss ist bei Kauf und Verkauf der Arbeit noch unvermeidlicher als bei andern Waaren. Erstens, weil das Geld im Kauf der Arbeit als Zahlungsmittel funktionirt. Der Arbeiter wird gezahlt, nachdem er seine Arbeit geliefert hat. Begrifflich aber enthält die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel, dass es den Werth oder Preis des gelieferten Artikels nachträglich realisirt, also im gegebnen Fall den Werth oder Preis der gelieferten Arbeit. Zweitens: Der Gebrauchswerth, den der Arbeiter dem Kapitalisten liefert, ist in der That nicht seine Arbeitskraft, sondern ihre besondre Funktion, Arbeit von besondrem Inhalt, Schneiderarbeit, Schusterarbeit, Spinnarbeit u. s. w. Dass dieselbe Arbeit nach einer andern Seite hin allgemeines werthbildendes Element ist, eine Eigenschaft, wodurch sie sich von allen andern Waaren unterscheidet, fällt ausserhalb des Bereichs des gewöhnlichen Bewusstseins.
Stellen wir uns auf den Standpunkt des Arbeiters, der für zwölfstündige Arbeit z. B. das Werthprodukt sechsstündiger Arbeit erhält, sage 3 sh., so ist für ihn in der That seine zwölfstündige Arbeit das Kaufmittel der 3 sh. Der Werth seiner Arbeitskraft mag variiren mit dem Werth seiner gewohnheitsmässigen Lebensmittel von 3 auf 4 sh. oder von 3 auf 2 sh., oder bei gleichbleibendem Werth seiner Arbeitskraft mag ihr Preis, in Folge wechselnden Verhältnisses von Nachfrage und Zufuhr, auf 4 sh. steigen oder auf 2 sh. fallen, er giebt stets 12 Arbeitsstunden. Jeder Wechsel in der Grösse des Aequivalents, das er
erhält, erscheint ihm daher nothwendig als Wechsel im Werth oder Preis dieser 12 Arbeitsstunden. Dieser Umstand verleitete umgekehrt Adam Smith, der den Arbeitstag als eine constante Grösse behandelt(FN 29), zur Behauptung, der Werth der Arbeit sei constant, obgleich der Werth der Lebensmittel wechsle und derselbe Arbeitstag sich daher in mehr oder weniger Geld für den Arbeiter darstelle.
Nehmen wir andrerseits den Kapitalisten, so will er zwar möglichst viel Arbeit für möglichst wenig Geld erhalten. Praktisch interessirt ihn daher nur die Differenz zwischen dem Preis der Arbeitskraft und dem Werth, den ihre Funktion schafft. Aber er sucht alle Waare möglichst wohlfeil zu kaufen und erklärt sich überall seinen Profit aus der einfachen Prellerei, dem Verkauf über dem Werth. Er kommt daher nicht zur Einsicht, dass wenn so ein Ding wie Werth der Arbeit wirklich existirte, und er diesen Werth wirklich zahlte, kein Kapital existiren, sein Geld sich nicht in Kapital verwandeln würde.
Es kommt hinzu, dass die wirkliche Bewegung des Arbeitslohns Phänomene zeigt, die zu beweisen scheinen, dass nicht der Werth der Arbeitskraft, sondern der Werth ihrer Funktion, der Arbeitselbst, bezahlt wird. Diese Phänomene können wir auf zwei grosse Klassen zurückführen. Erstens: Wechsel des Arbeitslohns mit wechselnder Länge des Arbeitstags. Man könnte eben so wohl schliessen, dass nicht der Werth der Maschine, sondern der ihrer Operation bezahlt wird, weil es mehr kostet eine Maschine für eine Woche als für einen Tag zu dingen. Zweitens: Der individuelle Unterschied in den Arbeitslöhnen verschiedner Arbeiter, welche dieselbe Funktion verrichten. Diesen individuellen Unterschied findet man, aber ohne Anlass zu Illusionen, wieder im System der Sklaverei, wo frank und frei, ohne Schnörkel, die Arbeitskraft selbst verkauft wird. Nur fällt der Vortheil einer Arbeitskraft, die über dem Durchschnitt, oder der Nachtheil einer Arbeitskraft, die unter dem Durchschnitt steht, im Sklavensystem dem Sklaveneigner zu, im System der Lohnarbeit dem Arbeiter selbst, weil seine Arbeitskraft in dem einen Fall von ihm selbst, in dem andern von einer dritten Person verkauft wird.
Uebrigens gilt von der Erscheinungsform, „Werth und Preis der Arbeit“ oder „ Arbeitslohn“, im Unterschied zum wesentlichen Verhältniss, welches erscheint, dem Werth und Preis der Arbeitskraft, dasselbe, was von allen Erscheinungsformen und ihrem verborgnen Hintergrund. Die ersteren reproduciren sich unmittelbar, spontan, als gang und gäbe Denkformen, der andere muss durch die Wissenschaft erst entdeckt werden. Die klassische politische Oekonomie stösst annähernd auf den wahren Sachverhalt, ohne ihn jemals bewusst zu formuliren. Sie kann das nicht, so lange sie in ihrer bürgerlichen Haut steckt.
Der Arbeitslohn nimmt selbst wieder sehr mannigfaltige Formen an, ein Umstand, nicht erkennbar aus den ökonomischen Kompendien, die in ihrer brutalen Interessirtheit für den Stoff jeden Formunterschied vernachlässigen. Eine Darstellung aller dieser Formen gehört jedoch in die specielle Lehre von der Lohnarbeit, also nicht in diess Werk. Dagegen sind die zwei herrschenden Grundformen hier kurz zu entwickeln.
Der Verkauf der Arbeitskraft findet, wie man sich erinnert, stets für bestimmte Zeitperiode statt. Die verwandelte Form, worin der Tageswerth, Wochenwerth u. s. w. der Arbeitskraft unmittelbar erscheint, ist daher die des Zeitlohns, also Tageslohn, Wochenlohn u. s. w.
Es ist nun zunächst zu bemerken, dass die im 2. Abschnitt dieses Kapitels dargestellten Gesetze über den Grössenwechsel von Preis der Arbeitskraft und Mehrwerth sich durch einfache Formveränderung in Gesetze des Arbeitslohns verwandeln. Ebenso erscheint der Unterschied zwischen dem Tauschwerth der Arbeitskraft und der Masse der Lebensmittel, worin sich dieser Werth umsetzt, jetzt als Unterschied von nominellem und reellem Arbeitslohn. Es wäre nutzlos in der Erscheinungsform zu wiederholen, was in der wesentlichen Form bereits entwickelt. Wir beschränken uns daher auf wenige, den Zeitlohn charakterisirende Punkte.
Die Geldsumme(FN 30), die der Arbeiter für seine Tagesarbeit, Wochenarbeit u. s. w. erhält, bildet den wirklichen Betrag seines nominellen oder dem Werth nach geschätzten Arbeitslohns. Es ist aber klar, dass
je nach der Länge des Arbeitstags, also je nach der täglich von ihm gelieferten Quantität Arbeit, derselbe Tageslohn, Wochenlohn u. s. w. einen sehr verschiednen Preis der Arbeit d. h. sehr verschiedne Geldsummen für dasselbe Quantum Arbeit darstellen kann(FN 31). Man muss also bei dem Zeitlohn wieder unterscheiden zwischen dem Gesammtbetrag des Arbeitslohns, Taglohns, Wochenlohns u. s. w. und dem Preis der Arbeit. Wie nun den Preis der Arbeit finden, d. h. den Geldwerth eines gegebnen Quantums Arbeit? Der durchschnittliche Preis der Arbeit ergiebt sich, indem man den durchschnittlichen Tageswerth der Arbeitskraft durch die Stundenzahl des durchschnittlichen Arbeitstags dividirt. Ist z. B. der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., das Werthprodukt von 6 Arbeitsstunden, und ist der Arbeitstag zwölfstündig, so ist der Preis einer Arbeitsstunde = = 3 d. Der so gefundne Preis der Arbeitsstunde dient als Einheitsmass für den Preis der Arbeit.
Es folgt daher, dass der Taglohn, Wochenlohn u. s. w. derselbe bleiben kann, obgleich der Preis der Arbeit fortwährend sinkt. War z. B. der gewohnheitsmässige Arbeitstag 10 Stunden und der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., so betrug der Preis der Arbeitsstunde 3⅗d.; er sinkt auf 3 d., sobald der Arbeitstag zu 12 Stunden, und auf 2⅖ d., sobald er zu 15 Stunden steigt. Tagesoder Wochenlohn bleiben trotzdem unverändert. Umgekehrt kann der Taglohn oder Wochenlohn steigen, obgleich der Preis der Arbeit constant bleibt oder selbst sinkt. War z. B. der Arbeitstag zehnstündig und ist der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., so der Preis einer Arbeitsstunde 3⅗ d. Arbeitet der Arbeiter in Folge zunehmender Beschäftigung und bei gleichbleibendem Preise der Arbeit 12 Stunden, so steigt sein Tageslohn nun auf 3 sh. 7⅕d. ohne Variation im Preise der Arbeit. Dasselbe Resultat könnte herauskommen, wenn
statt der extensiven Grösse der Arbeit ihre intensive Grösse zunähme(FN 32). Steigen des nominellen Tagesoder Wochenlohns mag daher begleitet sein von gleichbleibendem oder sinkendem Preis der Arbeit. Dasselbe gilt von der Einnahme der Arbeiterfamilie, sobald das vom Familienhaupt gelieferte Arbeitsquantum durch die Arbeit der Familienglieder vermehrt wird. Es giebt also von der Schmälerung des nominellen Tagesoder Wochenlohns unabhängige Methoden zur Herabsetzung des Preises der Arbeit(FN 33). Als allgemeines Gesetz aber folgt: Ist die Quantität der Tages-, Wochenarbeit u. s. w. gegeben, so hängt der Tagesoder Wochenlohn vom Preise der Arbeit ab, der selbst variirt, entweder mit dem Werth der Arbeitskraft oder den Abweichungen ihres Preises von ihrem Werthe. Ist dagegen der Preis der Arbeit gegeben, so hängt der Tagesoder Wochenlohn von der Quantität der Tagesoder Wochenarbeit ab.
Die Masseinheit des Zeitlohns, der Preis der Arbeitsstunde, ist der Quotient des Tageswerths der Arbeitskraft, dividirt durch die Stundenzahl des gewohnheitsmässigen Arbeitstags. Gesetzt letztrer betrage 12 Stunden,
der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., das Werthprodukt von 6 Arbeitsstunden. Der Preis der Arbeitsstunde ist unter diesen Umständen 3 d., ihr Werthprodukt 6 d. Wird der Arbeiter nun weniger als 12 Stunden täglich (oder weniger als 6 Tage in der Woche) beschäftigt, z. B. nur 6 oder 8 Stunden, so erhält er, bei diesem Preise der Arbeit, nur 2 oder 1½ sh. Taglohn(FN 34). Da er nach der Voraussetzung im Durchschnitt 6 Stunden täglich arbeiten muss, um nur einen dem Werth seiner Arbeitskraft entsprechenden Taglohn zu produciren, da er nach derselben Voraussetzung von jeder Stunde nur ½ für sich selbst, ½ aber für den Kapitalisten arbeitet, so ist es klar, dass er das Werthprodukt von 6 Stunden nicht herausschlagen kann, wenn er weniger als 12 Stunden beschäftigt wird. Sah man früher die zerstörenden Folgen der Ueberarbeit, so entdeckt man hier die Quellen der Leiden, die für den Arbeiter aus seiner Unterbeschäftigung entspringen.
Wird der Stundenlohn in der Weise fixirt, dass der Kapitalist sich nicht zur Zahlung eines Tagesoder Wochenlohns verpflichtet, sondern nur zur Zahlung der Arbeitsstunden, während deren es ihm beliebt, den Arbeiter zu beschäftigen, so kann er ihn unter der Zeit beschäftigen, die der Schätzung des Stundenlohns oder der Masseinheit für den Preis der Arbeit ursprünglich zu Grunde liegt. Da diese Masseinheit bestimmt ist durch die Proportion [Formel 1] , verliert sie natürlich allen Sinn, sobald der Arbeitstag aufhört, eine bestimmte Stundenzahl zu zählen. Der Zusammenhang zwischen der bezahlten und unbezahlten Arbeitszeit ist aufgehoben. Der Kapitalist kann jetzt ein bestimmtes Quantum Mehrarbeit aus dem Arbeiter herausschlagen, ohne ihm die zu seiner Selbsterhaltung nothwendige Arbeitszeit einzuräumen. Er kann jede Regelmässigkeit der Beschäftigung vernichten und ganz nach
Bequemlichkeit, Willkühr und augenblicklichem Interesse die ungeheuerste Ueberarbeit mit relativer oder gänzlicher Arbeitslosigkeit abwechseln lassen. Er kann, unter dem Vorwand, den „normalen Preis der Arbeit“ zu zahlen, den Arbeitstag, ohne irgend entsprechende Kompensation für den Arbeiter, anormal verlängern. Daher der durchaus rationelle Aufstand (1860) der im Baufach beschäftigten Londoner Arbeiter gegen den Versuch der Kapitalisten diesen Stundenlohn aufzuherrschen. Die gesetzliche Beschränkung des Arbeitstags macht solchem Unfug ein Ende, obgleich natürlich nicht der aus Konkurrenz der Maschinerie, Wechsel in der Qualität der angewandten Arbeiter, partiellen und allgemeinen Krisen entspringenden Unterbeschäftigung.
Bei wachsendem Tagesoder Wochenlohn kann der Preis der Arbeit nominell constant bleiben und dennoch unter sein normales Niveau sinken. Diess findet jedesmal statt, sobald mit constantem Preis der Arbeit, resp. der Arbeitsstunde, der Arbeitstag über seine gewohnheitsmässige Dauer verlängert wird. Wenn in dem Bruch [Formel 1] der Nenner wächst, wächst der Zähler noch rascher. Der Werth der Arbeitskraft, weil ihr Verschleiss, wächst mit der Dauer ihrer Funktion, und in rascherer Proportion als das Increment ihrer Funktionsdauer. In vielen Industriezweigen, wo Zeitlohn vorherrscht, ohne gesetzliche Schranken der Arbeitszeit, hat sich daher naturwüchsig die Gewohnheit herausgebildet, dass der Arbeitstag nur bis zu einem gewissen Punkt, z. B. bis zum Ablauf der zehnten Stunde, als normal gilt („normal working day“, „the day’s work“, „the regular hours of work“). Jenseits dieser Grenze bildet die Arbeitszeit Ueberzeit (overtime) und wird, die Stunde als Masseinheit genommen, besser bezahlt (extra pay), obgleich oft in lächerlich kleiner Proportion(FN 35). Der normale Arbeitstag existirt hier als Bruchtheil des wirklichen Arbeitstags und der letztere währt oft während des ganzen Jahres
länger als der erstere(FN 36). Das Wachsthum im Preis der Arbeit mit der Verlängerung des Arbeitstags über eine gewisse Normalgrenze gestaltet sich in verschiedenen britischen Industriezweigen so, dass der niedrige Preis der Arbeit während der s. g. Normalzeit dem Arbeiter die besser bezahlte Ueberzeit aufzwingt, will er überhaupt einen genügenden Arbeitslohn herausschlagen(FN 37). Gesetzliche Beschränkung des Arbeitstags macht diesem Vergnügen ein Ende(FN 38).
Es ist allgemein bekannte Thatsache, dass je länger der Arbeitstag in einem Industriezweig, um so niedriger der Arbeitslohn(FN 39). Fabrikinspektor A. Redgrave illustrirt diess durch eine vergleichende Uebersicht der zwanzigjährigen Periode von 1839—1859, wonach der Arbeitslohn in den dem Zehnstundengesetz unterworfenen Fabriken stieg, während er in den Fabriken, wo 14 bis 15 Stunden täglich gearbeitet wird, fiel(FN 40).
Zunächst folgt aus dem Gesetz: „bei gegebnem Preis der Arbeit hängt der Tagesoder Wochenlohn von der Quantität der gelieferten Arbeit ab“, dass je niedriger der Preis der Arbeit, desto grösser das Arbeitsquantum sein muss oder desto länger der Arbeitstag, damit der Arbeiter auch nur einen kümmerlichen Durchschnittslohn sichre. Die Niedrigkeit des Arbeitspreises wirkt hier als Sporn zur Verlängerung der Arbeitszeit(FN 41).
Umgekehrt aber producirt ihrerseits die Verlängerung der Arbeitszeit einen Fall im Arbeitspreise und damit im Tagesoder Wochenlohn.
Die Bestimmung des Arbeitspreises durch [Formel 1] ergiebt, dass blosse Verlängerung des Arbeitstags den Arbeitspreis senkt, wenn keine Kompensation eintritt. Aber dieselben Umstände, welche den Kapitalisten befähigen, den Arbeitstag auf die Dauer zu verlängern, befähigen ihn erst und zwingen ihn schliesslich, den Arbeitspreis auch nominell zu senken, bis der Gesammtpreis der vermehrten Stundenzahl sinkt, also der Tagesoder Wochenlohn. Hinweis auf zwei Umstände genügt hier. Verrichtet ein Mann das Werk von 1½ oder 2 Männern, so wächst
die Zufuhr der Arbeit, wenn auch die Zufuhr der auf dem Markt befindlichen Arbeitskräfte constant bleibt. Die so unter den Arbeitern erzeugte Konkurrenz befähigt den Kapitalisten den Preis der Arbeit herabzudrücken, während der fallende Preis der Arbeit ihn umgekehrt befähigt, die Arbeitszeit noch weiter heraufzuschrauben(FN 42). Bald jedoch wird diese Verfügung über anormale, d. h. das gesellschaftliche Durchschnittsniveau überfliessende Quanta unbezahlter Arbeit zum Konkurrenzmittel unter den Kapitalisten selbst. Ein Theil des Waarenpreises besteht aus dem Preis der Arbeit. Der nicht gezahlte Theil des Arbeitspreises braucht nicht im Waarenpreis zu rechnen. Er kann dem Waarenkäufer geschenkt werden. Diess ist der erste Schritt, wozu die Konkurrenz treibt. Der zweite Schritt, wozu sie zwingt, ist wenigstens einen Theil des durch die Verlängerung des Arbeitstags erzeugten anormalen Mehrwerths ebenfalls aus dem Verkaufspreis der Waare zu eliminiren. In dieser Weise bildet sich erst sporadisch und fixirt sich nach und nach ein anormal niedriger Verkaufspreis der Waare, der von nun an zur constanten Grundlage kümmerlichen Arbeitslohns bei übermässiger Arbeitszeit wird, wie er ursprünglich das Produkt dieser Umstände war. Wir deuten diese Bewegung bloss an, da die Analyse der Konkurrenz nicht hierhin gehört. Doch mag für einen Augenblick der Kapitalist selbst sprechen. „In Birmingham ist so grosse Konkurrenz unter den Meistern, dass mancher von uns gezwungen ist als Arbeitsanwender zu thun, was er sich schämen würde sonst zu thun; und dennoch wird nicht mehr Geld gemacht (and yet no more money is made), sondern das Publikum allein hat den Vortheil davon“(FN 43). Man erinnert sich der zwei Sorten Londoner Bäcker, wovon die eine Brod zum vollen Preise (the „fullpriced“ bakers), die andre es unter seinem normalen
Preise verkauft („the underpriced“, „the undersellers“). Die „fullpriced“ denunciren ihre Konkurrenten vor der parlamentarischen Untersuchungskommission: „Sie existiren nur, indem sie erstens das Publikum betrügen (durch Fälschung der Waare) und zweitens 18 Arbeitsstunden aus ihren Leuten für den Lohn zwölfstündiger Arbeit herausschinden. … Die unbezahlte Arbeit (the unpaid labour) der Arbeiter ist das Mittel, wodurch der Konkurrenzkampf geführt wird. … Die Konkurrenz unter den Bäckermeistern ist die Ursache der Schwierigkeit in Beseitigung der Nachtarbeit. Ein Unterverkäufer, der sein Brod unter dem mit dem Mehlpreis wechselnden Kostpreis verkauft, hält sich schadlos, indem er mehr Arbeit aus seinen Leuten herausschlägt. Wenn ich nur 12 Stunden Arbeit aus meinen Leuten herausschlage, mein Nachbar dagegen 18 oder 20, muss er mich im Verkaufspreis schlagen. Könnten die Arbeiter auf Zahlung für Ueberzeit bestehn, so wäre es mit diesem Manöver bald zu Ende. … Eine grosse Anzahl der von den Unterverkäufern Beschäftigten sind Fremde, Jungen und Andre, die fast mit jedem Arbeitslohn, den sie kriegen können, vorlieb zu nehmen gezwungen sind“(FN 44).
Diese Jeremiade ist auch desswegen interessant, weil sie zeigt, wie nur der Schein der Produktionsverhältnisse sich im Kapitalistenhirn widerspiegelt. Der Kapitalist weiss nicht, dass auch der normale Preis der Arbeit ein bestimmtes Quantum unbezahlter Arbeit einschliesst und eben diese unbezahlte Arbeit die normale Quelle seines Gewinns ist. Die Kategorie der Mehrarbeitszeit existirt überhaupt nicht für ihn, denn sie ist eingeschlossen im normalen Arbeitstag, den er im Taglohn zu zahlen glaubt. Wohl aber existirt für ihn die Ueberzeit, die Verlängerung des Arbeitstags über die dem gewohnten Preis der Arbeit entsprechende Schranke. Seinem unterverkaufenden Konkurrenten gegenüber besteht er sogar auf Extrazahlung (extra pay)
für diese Ueberzeit. Er weiss wieder nicht, dass diese Extrazahlung ebensowohl unbezahlte Arbeit einschliesst, wie der Preis der gewöhnlichen Arbeitsstunde. Z. B. der Preis einer Stunde des zwölfstündigen Arbeitstags ist 3 d., das Werthprodukt von ½ Arbeitsstunde, während der Preis der überzeitigen Arbeitsstunde 4 d., das Werthprodukt von ⅔ Arbeitsstunde. Im ersten Fall eignet sich der Kapitalist von einer Arbeitsstunde die Hälfte, im andern ⅓ ohne Zahlung an.
Der Stücklohn ist nichts als eine verwandelte Form des Zeitlohns, wie der Zeitlohn die verwandelte Form des Werthes oder Preises der Arbeitskraft.
Beim Stücklohn sieht es auf den ersten Blick aus, als ob der vom Arbeiter verkaufte Gebrauchswerth nicht die Funktion seiner Arbeitskraft sei, lebendige Arbeit, sondern bereits im Produkt vergegenständlichte Arbeit, und als ob der Preis dieser Arbeit nicht wie beim Zeitlohn durch die Bruchzahl [Formel 1] , sondern durch die Leistungsfähigkeit des Producenten bestimmt werde(FN 45).
Zunächst müsste die Zuversicht, die an diesen Schein glaubt, bereits stark erschüttert werden durch die Thatsache, dass beide Formen des Arbeitslohns zur selben Zeit in denselben Geschäftszweigen neben einander bestehen. Z. B. „Die Setzer von London arbeiten in der Regel nach Stücklohn, während Zeitlohn bei ihnen die Ausnahme bildet. Umgekehrt
bei den Setzern in den Provinzen, wo der Zeitlohn die Regel und der Stücklohn die Ausnahme. Die Schiffszimmerleute im Hafen von London werden nach Stücklohn bezahlt, in allen andern englischen Häfen nach Zeitlohn“(FN 46). In denselben Londoner Sattlerwerkstätten wird oft für dieselbe Arbeit den Franzosen Stücklohn und den Engländern Zeitlohn gezahlt. In den eigentlichen Fabriken, wo Stücklohn allgemein vorherrscht, entziehn sich einzelne Arbeitsfunktionen aus technischen Gründen dieser Messung und werden daher nach Zeitlohn gezahlt(FN 47). An und für sich ist es jedoch klar, dass die Formverschieden heit in der Auszahlung des Arbeitslohns an seinem Wesen nichts ändert, obgleich die eine Form der Entwicklung der kapitalistischen Produktion günstiger sein mag als die andre.
Der gewöhnliche Arbeitstag betrage 12 Stunden, wovon 6 bezahlt, 6 unbezahlt. Sein Werthprodukt sei 6 sh., das einer Arbeitsstunde daher 6 d. Es stelle sich erfahrungsmässig heraus, dass ein Arbeiter, der mit dem Durchschnittsgrad von Intensivität und Geschick arbeitet, in der That also nur die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit zur Produktion eines Artikels verwendet, 24 Stücke, ob diskret, oder messbare Theile eines kontinuirlichen Machwerks, in 12 Stunden liefert. So ist der Werth dieser 24 Stücke, nach Abzug des in ihnen enthaltenen constanten Kapitaltheils, 6 sh. und der Werth des einzelnen Stücks 3 d. Der Arbeiter erhält per Stück 1½ d. und verdient so in
12 Stunden 3 sh. Wie es beim Zeitlohn gleichgültig ist, ob man annimmt, dass der Arbeiter 6 Stunden für sich und 6 für den Kapitalisten, oder von jeder Stunde die eine Hälfte für sich und die andre für den Kapitalisten arbeitet, so auch hier, ob man sagt, jedes einzelne Stück sei halb bezahlt und halb unbezahlt, oder der Preis von 12 Stücken ersetze nur den Werth der Arbeitskraft, während in den 12 andern sich der Mehrwerth verkörpere.
Die Form des Stücklohns ist ebenso irrationell als die des Zeitlohns. Während z. B. zwei Stück Waare, nach Abzug des Werths der in ihnen aufgezehrten Produktionsmittel, als Produkt einer Arbeitsstunde 6 d. werth sind, erhält der Arbeiter für sie einen Preis von 3 d. Der Stücklohn drückt unmittelbar in der That kein Werthverhältniss aus. Es handelt sich nicht darum den Werth des Stücks durch die in ihm verkörperte Arbeitszeit zu messen, sondern umgekehrt die vom Arbeiter verausgabte Arbeit durch die Zahl der von ihm producirten Stücke. Beim Zeitlohn misst sich die Arbeit an ihrer unmittelbaren Zeitdauer, beim Stücklohn am Produktenquantum, worin Arbeit während bestimmter Zeitdauer verdichtet(FN 48). Der Preis der Arbeitszeit selbst ist schliesslich bestimmt durch die Gleichung: Werth der Tagesarbeit = Tageswerth der Arbeitskraft. Der Stücklohn ist also nur eine modificirte Form des Zeitlohns.
Betrachten wir nun etwas näher die charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Stücklohns.
Die Qualität der Arbeit ist hier durch das Werk selbst kontrolirt, das die durchschnittliche Güte besitzen muss, soll der Stückpreis voll bezahlt werden. Der Stücklohn wird nach dieser Seite hin zu fruchtbarster Quelle von Lohnabzügen und kapitalistischer Prellerei.
Er bietet dem Kapitalisten ein ganz bestimmtes Mass für die Intensivität der Arbeit. Nur Arbeitszeit, die sich in einem vorher bestimmten und erfahrungsmässig festgesetzten Waarenquantum verkörpert, gilt als gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit und wird
als solche bezahlt. In den grösseren Schneiderwerkstätten Londons heisst daher ein gewisses Stück Arbeit, z. B. eine Weste u. s. w., Stunde, halbe Stunde u. s. w., die Stunde zu 6 d. Aus der Praxis ist bekannt, wie viel das Durchschnittsprodukt einer Stunde. Bei neuen Moden, Reparaturen u. s. w. entsteht Streit zwischen Anwender und Arbeiter, ob ein bestimmtes Arbeitsstück = einer Stunde u. s. w., bis auch hier die Erfahrung entscheidet. Aehnlich in den Londoner Möbelschreinereien u. s. w. Besitzt der Arbeiter nicht die durchschnittliche Leistungsfähigkeit, kann er daher ein bestimmtes Minimum von Tagwerk nicht liefern, so entlässt man ihn(FN 49).
Da Qualität und Intensivität der Arbeit hier durch die Form des Arbeitslohns selbst kontrolirt werden, macht sie grossen Theil der Arbeitsaufsicht überflüssig. Sie bildet daher sowohl die Grundlage der früher geschilderten modernen Hausarbeit als eines hierarchisch gegliederten Systems der Exploitation und Unterdrückung. Das letztere besitzt zwei Grundformen. Der Stücklohn erleichtert einerseits das Zwischenschieben von Parasiten zwischen Kapitalist und Lohnarbeiter, Unterverpachtung der Arbeit (subletting of labour). Der Gewinn der Zwischenpersonen fliesst ausschliesslich aus der Differenz zwischen dem Arbeitspreis, den der Kapitalist zahlt, und dem Theil dieses Preises, den sie dem Arbeiter wirklich zukommen lassen(FN 50). Diess System heisst in England charakteristisch das „ Sweating System“ (Ausschweissungssystem). Andrerseits erlaubt der Stücklohn dem Kapitalisten mit dem Hauptarbeiter — in der Manufaktur mit dem Chef einer Gruppe, in den Minen mit dem Ausbrecher der Kohle u. s. w., in der Fabrik mit dem eigentlichen Maschinenarbeiter — einen Kontrakt für so viel per Stück zu schliessen,
ein Preis, wofür der Hauptarbeiter selbst die Anwerbung und Zahlung seiner Hilfsarbeiter übernimmt. Die Exploitation der Arbeiter durch das Kapital verwirklicht sich hier vermittelst der Exploitation des Arbeiters durch den Arbeiter(FN 51).
Den Stücklohn gegeben, ist es natürlich das persönliche Interesse des Arbeiters, seine Arbeitskraft möglichst intensiv anzuspannen, was dem Kapitalisten eine Erhöhung des Normalgrads der Intensivität erleichtert(FN 51a). Es ist ebenso das persönliche Interesse des Arbeiters, den Arbeitstag zu verlängern, weil damit sein Tagesoder Wochenlohn steigt(FN 52). Es tritt damit die beim Zeitlohn bereits geschilderte Re-
aktion ein, abgesehn davon, dass die Verlängerung des Arbeitstags, selbst bei constant bleibendem Stücklohn, an und für sich eine Senkung im Preise der Arbeit einschliesst.
Beim Zeitlohn herrscht mit wenigen Ausnahmen gleicher Arbeitslohn für dieselben Funktionen, während beim Stücklohn der Preis der Arbeitszeit zwar durch ein bestimmtes Produktquantum gemessen ist, der Tagesoder Wochenlohn dagegen wechselt mit der individuellen Verschiedenheit der Arbeiter, wovon der Eine nur das Minimum des Produkts in einer gegebnen Zeit liefert, der Andre den Durchschnitt, der Dritte mehr als den Durchschnitt. In Bezug auf die wirkliche Einnahme treten hier also grosse Differenzen ein je nach dem verschiednen Geschick, Kraft, Energie, Ausdauer u. s. w. der individuellen Arbeiter(FN 53). Diess ändert natürlich nichts an dem allgemeinen Verhältniss zwischen Kapital und Lohnarbeit. Erstens gleichen sich diese individuellen Unterschiede für das Gesammtatelier aus, so dass es in einer bestimmten Arbeitszeit das Durchschnittsprodukt liefert und der gezahlte Gesammtlohn der Durchschnittslohn des Geschäftszweigs sein wird. Zweitens bleibt die Proportion zwischen Arbeitslohn und Mehrwerth unverändert, da dem individuellen Lohn des einzelnen Arbeiters die von ihm individuell gelieferte Masse von Mehrwerth entspricht. Aber der grössere Spielraum, den der Stücklohn der Individualität bietet, strebt einerseits dahin die Individualität und damit Freiheitsgefühl, Selbstständigkeit und Selbstkontrole der Arbeiter zu entwickeln, andrerseits ihre Konkurrenz unter und gegen einander. Er hat daher eine Tendenz mit der Erhebung individueller Arbeitslöhne über das Durchschnittsniveau diess Niveau selbst zu senken. Wo aber bestimmter Stücklohn sich seit lange traditionell befestigt hatte und seine Herabsetzung daher besondre Schwierigkeiten bot, flüchteten die Meister ausnahmsweis auch zu seiner gewaltsamen Verwandlung in Zeitlohn. Hiergegen z. B. 1860 grosser Strike unter den Bandwebern von
Coventry(FN 54). Der Stücklohn ist endlich eine Hauptstütze des früher geschilderten Stundensystems(FN 55).
Aus der bisherigen Darstellung ergiebt sich, dass der Stücklohn die der kapitalistischen Produktionsweise entsprechendste Form des Arbeitslohns ist. Obgleich keineswegs neu, — er figurirt neben dem Zeitlohn officiell u. a. in den französischen und englischen Arbeiterstatuten des vierzehnten Jahrhunderts — gewinnt er doch erst grösseren Spielraum während der eigentlichen Manufakturperiode. In der Sturmund Drangperiode der grossen Industrie, namentlich von 1797 bis 1815, dient er als Hebel zur Verlängerung der Arbeitszeit und Herabsetzung des Arbeitslohns. Sehr wichtiges Material für die Bewegung des Arbeitslohns während jener Periode findet man in den Blaubüchern: „ Report and Evidence from
the select Committee on Petitions respecting the Corn Laws“ (Parlamentssession 1813—14) und: „ Reports from the Lords’ Committee, on the state of Growth, Commerce, and Consumption of Grain, and all Laws relating thereto“. (Session 1814—15.) Man findet hier den dokumentarischen Nachweis für die fortwährende Senkung des Arbeitspreises seit dem Beginn des Antijakobinerkriegs. In der Weberei z. B. war der Stücklohn so gefallen, dass trotz des sehr verlängerten Arbeitstags der Taglohn jetzt niedriger stand als vorher. „Die reale Einnahme des Webers ist sehr viel weniger als früher: seine Superiorität über den gewöhnlichen Arbeiter, die erst sehr gross war, ist fast ganz verschwunden. In der That, der Unterschied in den Löhnen geschickter und gewöhnlicher Arbeit ist jetzt viel unbedeutender als während irgend einer früheren Periode“(FN 56). Wie wenig die mit dem Stücklohn gesteigerte Intensivität und Ausdehnung der Arbeit dem ländlichen Proletariat fruchteten, zeige folgende einer Parteischrift für Landlords und Pächter entlehnte Stelle: „Bei weitem der grössere Theil der Agrikulturoperationen ist durch Leute verrichtet, die für den Tag oder auf Stückwerk gedungen werden. Ihr Wochenlohn beträgt ungefähr 12 sh.; und obgleich man voraussetzen mag, dass ein Mann bei Stücklohn, unter dem grösseren Arbeitssporn, 1 sh. oder vielleicht 2 sh. mehr verdient als beim Wochenlohn, so findet man dennoch, bei Schätzung seiner Gesammteinnahme, dass sein Verlust an Beschäftigung im Lauf des Jahrs diesen Zuschuss aufwiegt. … Man wird ferner im Allgemeinen finden, dass die Löhne dieser Männer ein gewisses Verhältniss zum Preis der nothwendigen Lebensmittel haben; so dass ein Mann mit zwei Kindern fähig ist seine Familie ohne Zuflucht zur Pfarreiunterstützung zu erhalten“(FN 57). Malthus bemerkte damals mit Bezug auf die vom Parlament veröffentlichten Thatsachen: „Ich gestehe, ich sehe mit Missvergnügen die grosse Ausdehnung der Praxis des Stücklohns. Wirklich harte
Arbeit während 12 oder 14 Stunden des Tags, für irgend längere Zeitperioden, ist zu viel für ein menschliches Wesen“(FN 58).
In den dem Fabrikgesetz unterworfenen Werkstätten wird Stücklohn allgemeine Regel, weil das Kapital dort den Arbeitstag nur noch intensiv ausweiten kann(FN 59).
Mit der wechselnden Produktivität der Arbeit stellt dasselbe Produktenquantum wechselnde Arbeitszeit dar. Also wechselt auch der Stücklohn, da er Preisausdruck einer bestimmten Arbeitszeit. In unsrem obigen Beispiel wurden in 12 Stunden 24 Stück producirt, während das Werthprodukt der 12 Stunden 6 sh. war, der Tageswerth der Arbeitskraft 3 sh., der Preis der Arbeitsstunde 3 d. und der Lohn für ein Stück 1½ d. In einem Stück war ½ Arbeitsstunde eingesaugt. Liefert derselbe Arbeitstag nun etwa in Folge verdoppelter Produktivität der Arbeit 48 Stück statt 24, und bleiben alle andern Umstände unverändert, so sinkt der Stücklohn von 1½ d. auf ¾ d. oder 3 Farthing, da jedes Stück jetzt nur noch ¼ statt ½ Arbeitsstunde darstellt. 24 × 1½ d. = 3 sh. und ebenso 48 × ¾ d. = 3 sh. In andern Worten: Der Stücklohn wird in demselben Verhältniss heruntergesetzt, worin die Zahl der während derselben Zeit producirten Stücke wächst(FN 60), also die auf dasselbe Stück
verwandte Arbeitszeit abnimmt. Dieser Wechsel des Stücklohns, soweit rein nominell, ruft beständige Kämpfe zwischen Kapitalist und Arbeiter hervor. Entweder, weil der Kapitalist den Vorwand benutzt, um wirklich den Preis der Arbeit herabzusetzen. Oder weil die gesteigerte Produktivkraft der Arbeit von gesteigerter Intensivität derselben begleitet ist. Oder, weil der Arbeiter den Schein des Stücklohns, als ob ihm sein Produkt gezahlt werde und nicht seine Arbeitskraft, ernst nimmt und sich daher gegen eine Lohnherabsetzung sträubt, welcher die Herabsetzung im Verkaufspreis der Waare nicht entspricht. „Die Arbeiter überwachen sorgfältig den Preis des Rohmaterials und den Preis der fabricirten Güter und sind so fähig die Profite ihrer Meister genau zu veranschlagen“(FN 61). Solchen Anspruch fertigt das Kapital mit Recht als groben Irrthum über die Natur der Lohnarbeit ab(FN 62). Es zetert über diese Anmassung Steuern auf den Fortschritt der Industrie zu legen und erklärt rundweg, dass die Produktivität der Arbeit den Arbeiter überhaupt nichts angeht(FN 63).
Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels beschäftigten uns die mannigfachen Kombinationen, welche ein Wechsel in der absoluten oder relativen (d. h. mit dem Mehrwerth verglichenen) Werthgrösse der Arbeitskraft hervorbringen kann, während andrerseits wieder das Quantum von Lebensmitteln, worin der Preis der Arbeitskraft realisirt wird, von dem
Wechsel dieses Preises unabhängige(FN 64) oder verschiedne Bewegungen durchlaufen konnte. Wie bereits bemerkt, verwandeln sich durch einfache Uebersetzung des Werths, resp. Preises der Arbeitskraft in die exoterische Form des Arbeitslohns alle jene Gesetze in Gesetze der Bewegung des Arbeitslohns. Was innerhalb dieser Bewegung als wechselnde Kombination, kann für verschiedne Länder als gleichzeitige Verschiedenheit nationaler Arbeitslöhne erscheinen. Beim Vergleich nationaler Arbeitslöhne sind also alle den Grössenwechsel des Werths der Arbeitskraft bestimmende Momente zu erwägen, Preis und Umfang der natürlichen und historisch entwickelten ersten Lebensbedürfnisse, Erziehungskosten des Arbeiters, Rolle der Weiberund Kinderarbeit, Produktivität der Arbeit, ihre extensive und intensive Grösse. Selbst die oberflächlichste Vergleichung erheischt, zunächst den Durchschnitts-Taglohn für dieselben Gewerbe in verschiednen Ländern auf gleich grosse Arbeitstage zu reduciren. Nach solcher Ausgleichung der Taglöhne, muss der Zeitlohn wieder in Stücklohn übersetzt werden, da nur der letztere ein Gradmesser sowohl für die Produktivität als die intensive Grösse der Arbeit. Es wird sich dann meist finden, dass der niedrigere Taglohn bei einer Nation einen höheren Arbeitspreis und der höhere Taglohn bei einer andern Nation einen niedrigeren Arbeitspreis ausdrückt, ganz wie die Bewegung des Taglohns überhaupt die Möglichkeit dieser Kombination zeigte(FN 65).
Auf dem Weltmarkt zählt nicht nur der intensivere nationale Arbeitstag als Arbeitstag von grösserer Stundenzahl, als extensiv grösserer Arbeitstag, sondern der produktivere nationale Arbeitstag zählt als intensiver, so oft die produktivere Nation nicht durch die Konkurrenz gezwungen wird den Verkaufspreis der Waare auf ihren Werth zu senken. Der intensivere und produktivere nationale Arbeitstag stellt sich also im Ganzen auf dem Weltmarkt in höherem Geldausdruck dar als der minder intensive oder produktive nationale Arbeitstag. Was von dem Arbeits tag, gilt von jedem seiner aliquoten Theile. Der absolute Geldpreis der Arbeit kann also bei einer Nation höher stehn als bei der andern, obgleich der relative Arbeitslohn, d. h. der Arbeitslohn verglichen mit dem vom Arbeiter producirten Mehrwerth, oder seinem ganzen Werthprodukt, oder dem Preis der Nahrungsmittel, niedriger steht(FN 66).
In „Versuch über die Rate des Arbeitslohns“(FN 67), einer seiner frühsten ökonomischen Schriften, sucht H. Carey nachzuweisen, dass die verschiednen nationalen Arbeitslöhne sich direkt verhalten wie die Produktivitätsgrade der nationalen Arbeitstage, um aus diesem internationalen Verhältniss den Schluss zu ziehn, dass der Arbeitslohn überhaupt steigt und fällt wie die Produktivität der Arbeit. Unsre ganze Analyse der Produktion des Mehrwerths beweist die Abgeschmacktheit dieser Schlussfolgerung, hätte Carey selbst seine Prämisse bewiesen, statt seiner Gewohnheit gemäss unkritisch und oberflächlich zusammengerafftes statistisches Material kunterbunt durch einander zu würfeln. Das Beste ist, dass er nicht behauptet, die Sache verhalte sich wirklich so, wie sie sich der Theorie nach verhalten sollte. Die Staatseinmischung hat nämlich das naturgemässe ökonomische Verhältniss verfälscht. Man muss
daher die nationalen Arbeitslöhne so berechnen, als ob der Theil derselben, der dem Staat in der Form von Steuern zufällt, dem Arbeiter selbst zufiele. Sollte Herr Carey nicht weiter darüber nachdenken, ob diese „Staatskosten“ nicht auch „naturgemässe“ Früchte der kapitalistischen Entwicklung sind? Das Raisonnement ist ganz des Mannes würdig, der die kapitalistischen Produktionsverhältnisse erst für ewige Naturund Vernunftgesetze erklärte, deren frei harmonisches Spiel nur durch die Staatseinmischung gestört werde, um hinterher zu entdecken, dass Englands diabolischer Einfluss auf den Weltmarkt, ein Einfluss, der, wie es scheint, nicht den Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringt, die Staatseinmischung nöthig macht, nämlich den Schutz jener Naturund Vernunftgesetze durch den Staat, alias das Protektionssystem. Er entdeckte ferner, dass die Theoreme Ricardo’s u. s. w., worin existirende gesellschaftliche Gegensätze und Widersprüche formulirt sind, nicht das ideale Produkt der wirklichen ökonomischen Bewegung, sondern dass umgekehrt die wirklichen Gegensätze der kapitalistischen Produktion in England und anderswo das Resultat der Ricardo’schen u. s. w. Theorie sind! Er entdeckte schliesslich, dass es in letzter Instanz der Handel ist, der die eingebornen Schönheiten und Harmonieen der kapitalistischen Produktionsweise vernichtet. Noch einen Schritt weiter, und er entdeckt vielleicht, dass der einzige Missstand an der kapitalistischen Produktion das Kapital selbst ist. Nur ein Mann von so entsetzlicher Kritiklosigkeit und solcher Gelehrsamkeit de faux aloi verdiente, trotz seiner protektionistischen Ketzerei, die Geheimquelle der harmonischen Weisheit eines Bastiat und aller andern freihändlerischen Optimisten der Gegenwart zu werden(FN 68).
Sechstes Kapitel. Der Accumulationsprozess des Kapitals.↑
Man hat gesehn, wie das Kapital in der Form der Waare Mehrwerth producirt. Nur durch den Verkauf der Waare wird der in ihr steckende Mehrwerth zusammen mit dem in ihrer Produktion vorgeschossenen Kapitalwerth realisirt. Der Accumulationsprozess des Kapitals unterstellt daher seinen Cirkulationsprozess. Die Betrachtung des letzteren bleibt aber dem folgenden Buch vorbehalten. Die realen Bedingungen der Reproduktion, d. h. der kontinuirlichen Produktion, erscheinen theils erst innerhalb der Cirkulation, theils können sie erst nach der Analyse des Cirkulationsprozesses behandelt werden.
Das ist jedoch nicht alles. Der Kapitalist, der den Mehrwerth producirt, d. h. unbezahlte Arbeit unmittelbar aus den Arbeitern auspumpt und in Waaren fixirt, ist zwar der erste Aneigner, aber keineswegs der letzte Eigenthümer dieses Mehrwerths. Er hat ihn hinterher zu theilen mit Kapitalisten, die andre Funktionen im Grossen und Ganzen der gesellschaftlichen Produktion vollziehn, mit dem Grundeigenthümer u. s. w. Der Mehrwerth spaltet sich daher in verschiedne Theile. Seine Bruchstücke fallen verschiednen Kategorieen von Personen zu und krystallisiren zu verschiednen, gegen einander selbstständigen Formen, wie Profit, Zins, Handelsgewinn, Grundrente u. s. w. Diese verwandelten Formen des Mehrwerths können erst im dritten Buch behandelt werden.
Wir unterstellen hier also einerseits, dass der Kapitalist, der die Waare producirt, sie zu ihrem Werth verkauft, ohne bei seiner Rückkehr zum Waarenmarkt weiter zu verweilen, weder bei den neuen Formen, die dem Kapital anschiessen in der Cirkulationssphäre, noch den darin eingehüllten konkreten Bedingungen der Reproduktion. Andrerseits gilt uns der kapitalistische Producent als Eigenthümer des ganzen Mehrwerths oder, wenn man will, als Repräsentant aller seiner Theilnehmer an der Beute. Wir betrachten also zunächst die Accumulation abstrakt, d. h. als blosses Moment des unmittelbaren Produktionsprozesses.
So weit übrigens Accumulation stattfindet, gelingt dem Kapitalisten der Verkauf der producirten Waare und die Rückverwandlung des aus ihr gelösten Geldes in Kapital. Ferner: Der Bruch des Mehrwerths in verschiedne Stücke ändert nichts an seiner Natur, noch an den nothwendigen Bedingungen, worin er zum Element der Accumulation wird. Welche Proportion des Mehrwerths der kapitalistische Producent immer für sich selbst festhalte oder an andere abtrete, er eignet ihn stets in erster Hand an. Was also bei unsrer Darstellung der Accumulation unterstellt wird, ist bei ihrem wirklichen Vorgang unterstellt. Andrerseits verdunkeln die Zerspaltung des Mehrwerths und die vermittelnde Bewegung der Circulation die einfache Grundform des Accumulationsprozesses. Seine reine Analyse erheischt daher vorläufiges Wegsehn von allen Phänomenen, welche das innere Spiel seines Mechanismus verstecken. Der Fortgang der Darstellung führt später durch seine eigne Dialektik zu jenen konkreteren Formen.
1) Die kapitalistische Accumulation.↑Welches immer die gesellschaftliche Form des Produktionsprozesses, er muss kontinuirlich sein oder periodisch stets von neuem dieselben Stadien durchlaufen. So wenig eine Gesellschaft aufhören kann zu konsumiren, so wenig kann sie aufhören zu produciren. In seinem stetigen Zusammenhang und dem beständigen Fluss seiner Erneuerung betrachtet, ist jeder gesellschaftliche Produktionsprozess daher zugleich Reproduktionsprozess.
Die Bedingungen der Produktion sind zugleich die Bedingungen der Reproduktion. Keine Gesellschaft kann fortwährend produciren, d. h. reproduciren, ohne fortwährend einen Theil ihrer Produkte in Produktionsmittel oder Elemente der Neuproduktion rückzuverwandeln. Unter sonst gleichbleib nden Umständen kann sie ihren Reichthum nur auf derselben Stufenleiter reproduciren oder erhalten, indem sie die während des Jahrs z. B. verbrauchten Produktionsmittel, d. h. Arbeitsmittel, Rohmateriale und Hilfsstoffe, in natura durch ein gleiches Quantum neuer Exemplare ersetzt, welches von der jährlichen Produktenmasse abgeschieden und von neuem dem Produktionsprozess anheimgegeben wird. Ein bestimmtes Quantum des jährlichen Produkts gehört also der Produktion. Von Haus aus für
die produktive Konsumtion bestimmt, existirt es grossentheils in Naturalformen, die von selbst die individuelle Konsumtion ausschliessen.
Hat die Produktion kapitalistische Form, so die Reproduktion. Wie in der kapitalistischen Produktionsweise der Arbeitsprozess nur als ein Mittel für den Verwerthungsprozess erscheint, so die Reproduktion nur als ein Mittel den vorgeschossnen Werth als Kapital zu reproduciren, d. h. als sich erhaltenden und verwerthenden Werth. Die ökonomische Charaktermaske des Kapitalisten hängt nur dadurch an einem Menschen fest, dass sein Geld fortwährend als Kapital funktionirt. Hat z. B. die vorgeschossne Geldsumme von 100 Pfd. St. sich dieses Jahr in Kapital verwandelt und einen Mehrwerth von 20 Pfd. St. producirt, so muss sie das nächste Jahr u. s. f. dieselbe Operation wiederholen. Als periodisches Increment des Kapitalwerths, oder periodische Frucht des prozessirenden Kapitals, erhält der Mehrwerth die Form einer aus dem Kapital entspringenden Revenue(FN 1).
Dient diese Revenue dem Kapitalisten nur als Konsumtionsfonds oder wird sie ebenso periodisch von ihm verzehrt wie gewonnen, so findet, unter sonst gleichbleibenden Umständen, einfache Reproduktion statt. Obgleich letztere nun blosse Wiederholung des Produktionsprozesses auf derselben Stufenleiter, drückt die blosse Wiederholung oder Kontinuität dem Prozesse gewisse neue Charaktere auf oder löst vielmehr die Scheincharaktere seines nur vereinzelten Vorgangs auf.
Der Produktionsprozess wird eingeleitet mit dem Kauf der Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit und diese Einleitung erneuert sich beständig, sobald der Verkaufstermin der Arbeit fällig und damit eine bestimmte Produktionsperiode, Woche, Monat u. s. w. abgelaufen ist. Gezahlt wird der Arbeiter aber erst, nachdem seine Arbeitskraft gewirkt und sowohl ihren eignen Werth, als den Mehrwerth, in Waaren realisirt hat. Er hat
also wie den Mehrwerth, den wir einstweilen nur als Konsumtionsfonds des Kapitalisten betrachten, so den Fonds seiner eignen Zahlung, das variable Kapital, producirt, bevor es ihm in der Form des Arbeitslohns zurückfliesst, und er wird nur so lang beschäftigt als er ihn beständig reproducirt. Daher die im vorigen Kapitel erwähnte Formel der Oekonomen, die das Salair als Antheil am Produkt selbst darstellt(FN 2). Es ist ein Theil des vom Arbeiter selbst beständig reproducirten Produkts, das ihm in der Form des Arbeitslohns beständig zurückfliesst. Der Kapitalist zahlt ihm den Waarenwerth allerdings in Geld. Diess Geld ist aber nur die verwandelte Form des Arbeitsprodukts oder vielmehr eines Theils des Arbeitsprodukts. Während der Arbeiter einen Theil der Produktionsmittel in Produkt verwandelt, rückverwandelt sich ein Theil seines früheren Produkts in Geld. Es ist seine Arbeit von voriger Woche oder vom letzten halben Jahr, womit seine Arbeit von heute oder vom nächsten halben Jahr gezahlt wird. Die Illusion, welche die Geldform erzeugt, verschwindet sofort, sobald statt des einzelnen Kapitalisten und des einzelnen Arbeiters Kapitalistenklasse und Arbeiterklasse betrachtet werden. Die Kapitalistenklasse giebt der Arbeiterklasse beständig in Geldform Anweisungen auf einen Theil des von der letztern producirten und von der erstern angeeigneten Produkts. Diese Anweisungen giebt der Arbeiter der Kapitalistenklasse ebenso beständig zurück und entzieht ihm damit den ihm selbst zufallenden Theil seines eignen Produkts. Die Waarenform des Produkts und die Geldform der Waare verkleiden die Transaktion.
Das variable Kapital ist also nur eine besondre historische Erscheinungsform des Fonds von Lebensmitteln oder des Arbeitsfonds, den der Arbeiter zu seiner Selbsterhaltung und Reproduktion bedarf, und den er in allen Systemen der gesellschaftlichen Produktion stets selbst produciren und reproduciren muss. Der Arbeitsfonds fliesst ihm nur beständig in Form von Zahlungsmitteln seiner Arbeit zu, weil sein eignes Produkt sich beständig in der Form des
Kapitals von ihm entfernt. Aber diese Erscheinungsform des Arbeitsfonds ändert nichts daran, dass dem Arbeiter seine eigne vergegenständlichte Arbeit vom Kapitalisten vorgeschossen wird(FN 3). Nehmen wir einen Frohnbauer. Er arbeitet mit seinen eignen Produktionsmitteln auf seinem eignen Acker z. B. 3 Tage in der Woche. Die 3 andern Wochentage verrichtet er Frohnarbeit auf dem herrschaftlichen Gut. Er reproducirt seinen eignen Arbeitsfonds beständig und dieser nimmt ihm gegenüber nie die Form von einem Dritten für seine Arbeit vorgeschossener Zahlungsmittel an. Im Ersatz nimmt auch niemals seine unbezahlte Zwangsarbeit die Form freiwilliger und bezahlter Arbeit an. Wenn morgen der Gutsherr den Acker, das Zugvieh, die Samen, kurz die Produktionsmittel des Frohnbauern sich selbst aneignet, so hat dieser von nun an seine Arbeitskraft an den Frohnherrn zu verkaufen. Unter sonst gleichbleibenden Umständen wird er nach wie vor 6 Tage in der Woche arbeiten, 3 Tage für sich selbst, 3 für den Ex-Frohnherrn, der jetzt in einen Lohnherrn verwandelt ist. Er wird nach wie vor die Produktionsmittel als Produktionsmittel vernützen und ihren Werth auf das Produkt übertragen. Nach wie vor wird ein bestimmter Theil des Produkts in die Reproduktion eingehn. Wie aber die Frohnarbeit die Form der Lohnarbeit, nimmt der vom Frohnbauer nach wie vor producirte und reproducirte Arbeitsfonds die Form eines ihm vom Ex-Frohnherrn vorgeschossenen Kapitals an. Der bürgerliche Oekonom, dessen beschränktes Hirn die Erscheinungsform von dem was darin erscheint nicht trennen kann, schliesst die Augen vor der Thatsache, dass selbst noch heutzutag der Arbeitsfonds nur ausnahmsweis auf dem Erdrund in der Form von Kapital erscheint(FN 4).
Allerdings verliert das variable Kapital nur den Sinn eines aus dem eignen Fonds des Kapitalisten vorgeschossenen Werthes, sobald wir den kapitalistischen Produktionsprozess im beständigen Fluss seiner Erneuerung betrachten. Aber er muss doch irgendwo und irgendwann anfangen. Von unsrem bisherigen Standpunkt ist es daher wahrscheinlich, dass der Kapitalist irgend einmal durch irgend eine, von unbezahlter fremder Arbeit unabhängige, ursprüngliche Accumulation Geldbesitzer ward, und daher den Markt als Käufer von Arbeitskraft beschreiten konnte. Indess bewirkt die blosse Kontinuität des kapitalistischen Produktionsprozesses, oder die einfache Reproduktion, noch andre sonderbare Wechsel, die nicht nur den variablen Kapitaltheil, sondern das Gesammtkapital ergreifen.
Beträgt der mit einem Kapital von 1000 Pfd. St. periodisch, z. B. jährlich, erzeugte Mehrwerth 200 Pfd. St. und wird dieser Mehrwerth jährlich verzehrt, so ist klar, dass nach fünfjähriger Wiederholung desselben Prozesses die Summe des verzehrten Mehrwerths = 5 × 200 ist oder gleich dem ursprünglich vorgeschossenen Kapitalwerth von 1000 Pfd. St. Würde der jährliche Mehrwerth nur theilweis verzehrt, z. B. nur zur Hälfte, so ergäbe sich dasselbe Resultat nach zehnjähriger Wiederholung des Produktionsprozesses, denn 10 × 100 = 1000. Allgemein: Der vorgeschossene Kapitalwerth, dividirt durch den jährlich verzehrten Mehrwerth, ergiebt die Jahresanzahl, oder die Anzahl von Reproduktionsperioden, nach deren Ablauf der ursprünglich vorgeschossene Kapitalwerth vom Kapitalisten aufgezehrt und daher verschwunden ist. Die Vorstellung des Kapitalisten, dass er das Produkt der fremden unbezahlten Arbeit, den Mehrwerth, verzehrt und den ursprünglichen Kapitalwerth erhält, ändert absolut nichts an der Thatsache, dass nach Abfluss einer gewissen Jahreszahl der von ihm geeignete Kapitalwerth gleich der Summe des während derselben Jahreszahl ohne Aequivalent angeeigneten Mehrwerths, und die von ihm verzehrte Werthsumme gleich dem ursprünglichen Kapitalwerth ist. Kein Werthatom seines alten Kapitals existirt fort. Ganz abgesehn von aller Accumulation verwandelt also die blosse Kontinuität des Produktionsprozesses, oder die einfache Reproduktion, nach kürzerer oder längerer Periode, jedes Kapital nothwendig in accumulirtes Kapital oder
kapitalisirten Mehrwerth. War es selbst bei seinem Eintritt in den Produktionsprozess persönlich erarbeitetes Eigenthum seines Anwenders, früher oder später wird es ohne Aequivalent angeeigneter Werth oder Materiatur, ob in Geldform oder anders, unbezahlter fremder Arbeit.
Die ursprüngliche Voraussetzung für die Verwandlung von Geld in Kapital waren nicht nur Waarenproduktion und Waarencirkulation. Auf dem Waarenmarkt mussten Besitzer von Werth oder Geld und Besitzer der werthschaffenden Substanz, Besitzer von Produktionsund Lebensmitteln und Besitzer der Arbeitskraft, einander als Käufer und Verkäufer gegenübertreten. Scheidung zwischen dem Arbeitsprodukt und der Arbeit selbst, zwischen den objektiven Arbeitsbedingungen und der subjektiven Arbeitskraft, war also die thatsächlich gegebne Grundlage des kapitalistischen Produktionsprozesses. Seine blosse Kontinuität, oder die einfache Reproduktion, reproducirt und verewigt diesen seinen Ausgangspunkt als sein eignes Resultat. Der Produktionsprozess verwandelt fortwährend das Geld in Kapital, die Produktionsmittel in Verwerthungsmittel. Andrerseits kommt der Arbeiter beständig aus dem Prozess heraus, wie er in ihn eintritt. Da seine eigne Arbeit ihm selbst entfremdet, dem Kapitalisten angeeignet und dem Kapital einverleibt ist, bevor er in den Prozess eintritt, vergegenständlicht sie sich während des Prozesses beständig in fremdem Produkt. Da der Produktionsprozess zugleich der Konsumtionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten, verwandelt sich das Produkt des Arbeiters nicht nur fortwährend in Waare, sondern in Kapital, Werth, der die werthschöpfende Kraft aussaugt, Lebensmittel, die Personen kaufen, Produktionsmittel, die den Producenten anwenden(FN 5). Der Arbeiter selbst producirt daher beständig den objektiven Reichthum als Kapital, ihm fremde, ihn beherrschende und ausbeutende Macht, und der Kapitalist producirt ebenso beständig die Arbeitskraft als subjektive, von ihren eignen Vergegenständlichungsund Verwirklichungsmitteln getrennte, abstrakte, in der blossen Leiblichkeit des Arbeiters existirende Reichthumsquelle,
kurz den Arbeiter als Lohnarbeiter(FN 6). Diese beständige Reproduktion oder Verewigung des Arbeiters als Lohnarbeiter ist das sine qua der kapitalistischen Produktion.
Man weiss, die Transaktion zwischen Kapitalist und Arbeiter ist folgende: Einen Theil seines Kapitals, das variable Kapital, tauscht der Kapitalist aus gegen Arbeitskraft, die er als lebendige Verwerthungskraft seinen todten Produktionsmitteln einverleibt. Eben dadurch wird der Arbeitsprozess zugleich kapitalistischer Verwerthungsprozess. Andrerseits verausgabt der Arbeiter das für seine Arbeitskraft eingetauschte Geld in Lebensmitteln, durch die er sich erhält und reproducirt. Es ist diess seine individuelle Konsumtion. Der Arbeitsprozess, worin er die Produktionsmittel konsumirt und dadurch in Produkte verwandelt, bildet seine produktive Konsumtion und zugleich Konsumtion seiner Arbeitskraft durch den Kapitalisten. Beide Konsumtionen sind wesentlich verschieden. In der einen gehört der Arbeiter als Arbeitskraft dem Kapital an und ist dem Produktionsprozess einverleibt; in der andern gehört er sich selbst und verrichtet individuelle Lebensakte ausserhalb des Produktionsprozesses.
Bei Betrachtung des „Arbeitstags“ u. s. w. zeigte sich gelegentlich, dass der Arbeiter oft gezwungen ist, seine individuelle Konsumtion zu einem blossen Incident des Produktionsprozesses zu machen. In diesem Fall setzt er sich Lebensmittel zu, um seine Arbeitskraft im Gang zu halten, wie der Dampfmaschine Kohle und Wasser, dem Rad Oel zugesetzt wird. Seine Konsumtionsmittel sind dann bloss Konsumtionsmittel eines Produktionsmittels, seine individuelle Konsumtion direkt produktive Konsumtion. Diess erscheint jedoch als ein dem kapitalistischen Produktionsprozess unwesentlicher Missbrauch(FN 7).
Betrachtet man aber nicht den vereinzelten Produktionsprozess der Waare, sondern den kapitalistischen Produktionsprozess in seinem zusammenhängenden Fluss und in seinem gesellschaftlichen Umfang, so bleibt auch die individuelle Konsumtion des Arbeiters ein Moment der Produktion und Reproduktion des Kapitals, ob sie innerhalb oder ausserhalb der Werkstatt, Fabrik u. s. w., innerhalb oder ausserhalb des Arbeitsprozesses vorgeht, ganz wie die Reinigung der Maschine, ob sie während des Arbeitsprozesses oder bestimmter Pausen desselben geschieht. Es thut nichts zur Sache, dass der Arbeiter diese Konsumtion sich selbst und nicht dem Kapitalisten zu lieb vollzieht. So bleibt der Konsum des Lastviehs nicht minder ein nothwendiges Moment des Produktionsprozesses, weil das Vieh selbst geniesst, was es frisst. Die beständige Erhaltung und Reproduktion der Arbeiterklasse bleibt beständige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals. Der Kapitalist kann ihre Erfüllung getrost dem Selbsterhaltungsund Fortpflanzungstrieb der Arbeiter überlassen. Er sorgt nur dafür ihre individuelle Konsumtion so viel als möglich auf das Nothwendige einzuschränken und ist himmelweit entfernt von jener südamerikanischen Rohheit, die den Arbeiter zwingt substantiellere statt weniger substantieller Nahrungsmittel einzunehmen(FN 8).
Durch den Umsatz eines Kapitaltheils in Arbeitskraft schlägt der Kapitalist zwei Fliegen mit einer Klappe. Er verwandelt dadurch einen Theil seines Kapitals in variables Kapital und verwerthet so sein Gesammtkapital. Er einverleibt die Arbeitskraft seinen Produktionsmitteln. Er verzehrt die Arbeitskraft produktiv, indem er den Arbeiter die Produktionsmittel durch seine Arbeit produktiv verzehren lässt. Andrerseits verwandeln sich die Lebensmittel oder der an den Arbeiter veräusserte Theil des Kapitals in Muskel, Nerven, Knochen, Hirn u.s.w. von Arbeitern. Innerhalb ihrer nothwendigen Grenzen ist daher die individuelle Konsumtion der
Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom Kapital gegen Arbeitskraft veräusserten Lebensmittel in die vom Kapital neu exploitirbare Arbeitskraft, Produktion und Reproduktion seines nothwendigsten Produktionsmittels, des Arbeiters selbst. Die individuelle Konsumtion des Arbeiters bildet daher ein Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals im Grossen und Ganzen.
Daher betrachtet auch der Kapitalist und sein Ideolog, der politische Oekonom, nur den Theil der individuellen Konsumtion des Arbeiters als produktiv, der zur Verewigung der Arbeiterklasse erheischt ist, also in der That verzehrt werden muss, damit das Kapital die Arbeitskraft verzehre; was der Arbeiter ausserdem zu seinem Vergnügen verzehren mag, ist unproduktive Konsumtion(FN 9). Würde die Accumulation des Kapitals eine Erhöhung des Arbeitslohns und daher Vermehrung der Konsumtionsmittel des Arbeiters verursachen ohne Konsum von mehr Arbeitskraft durch das Kapital, so wäre das zuschüssige Kapital unproduktiv konsumirt(FN 10). In der That: die individuelle Konsumtion des Arbeiters ist für ihn selbst unproduktiv, denn sie reproducirt nur das bedürftige Individuum: sie ist produktiv für den Kapitalisten und den Staat, denn sie ist Produktion der den fremden Reichthum producirenden Kraft(FN 11).
Von gesellschaftlichem Standpunkt ist also die Arbeiterklasse, auch ausserhalb des unmittelbaren Arbeitsprozesses, ebenso sehr Zubehör des Kapitals als die todten Arbeitsinstrumente. Ihre individuelle Konsumtion selbst ist innerhalb gewisser Grenzen nur ein Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals. Der Prozess aber sorgt dafür, dass diese selbst-
bewussten Produktionsinstrumente nicht weglaufen, indem er beständig ihr Produkt von ihrem Pol zum Gegenpol des Kapitals entfernt. Die individuelle Konsumtion sorgt für ihre eigne Erhaltung und Reproduktion, andrerseits, durch Vernichtung der Lebensmittel, für ihr beständiges Wiedererscheinen auf dem Arbeitsmarkt. Der römische Sklave war durch Ketten, der Lohnarbeiter ist durch unsichtbare Fäden an seinen Eigenthümer gebunden. Der Schein seiner Unabhängigkeit wird durch den beständigen Wechsel der individuellen Lohnherrn und die fictio juris des Kontrakts aufrecht erhalten.
Früher machte das Kapital, wo es ihm nöthig schien, sein Eigenthumsrecht auf den freien Arbeiter durch Zwangsgesetz geltend. So war z. B. die Emigration der Maschinenarbeiter in England bis 1815 bei schwerer Strafe verboten.
Die Reproduktion der Arbeiterklasse schliesst zugleich die Ueberlieferung und Häufung des Geschicks von einer Generation zur andern ein(FN 12). Wie sehr der Kapitalist das Dasein einer solchen geschickten Arbeiterklasse unter die ihm angehörigen Produktionsbedingungen zählt, sie in der That als die reale Existenz seines variablen Kapitals ansieht, zeigt sich, sobald eine Krise deren Verlust androht. In Folge des amerikanischen Bürgerkriegs und der ihn begleitenden Baumwollnoth wurde bekanntlich die Mehrzahl der Baumwollarbeiter in Lancashire u. s. w aufs Pflaster geworfen. Aus dem Schoss der Arbeiterklasse selbst, wie andrer Gesellschaftsschichten, schrie man nach Staatsunterstützung oder freiwilliger Nationalkollekte, um die Emigration der „Ueberflüssigen“ in englische Kolonien oder die Vereinigten Staaten zu ermöglichen. Damals veröffentlichte die Times (24. März 1863) einen Brief von Edmund Potter, früher Präsident der Manchester Handelskammer. Sein Brief ward mit Recht im Unterhaus als „ das Manifest der Fabrikanten“ bezeichnet(FN 13). Wir geben hier einige charakteristische Stellen,
worin der Eigenthumstitel des Kapitals auf die Arbeitskraft unverblümt ausgesprochen wird.
„Den Baumwollarbeitern mag gesagt werden, dass ihre Zufuhr zu gross ist. . . . sie müsse vielleicht um ein Drittheil reducirt werden, und dann würde eine gesunde Nachfrage für die übrigen zwei Drittheile eintreten. . . . Die öffentliche Meinung dringt auf Emigration. . . . Der Meister (d. h. der Baumwollfabrikant) kann nicht willig seine Arbeitszufuhr entfernt sehn; er mag denken, dass das ebenso ungerecht als unrichtig ist.… Wenn die Emigration aus öffentlichen Fonds unterstützt wird, hat er ein Recht Gehör zu verlangen und vielleicht zu protestiren.“ Selbiger Potter setzt dann weiter aus einander, wie nützlich die Baumwollindustrie, wie „sie unzweifelhaft die Uebervölkerung aus Irland und den englischen Agrikulturdistrikten wegdrainirt hat“, wie ungeheuer ihr Umfang, wie sie im Jahr 1860 des ganzen englischen Exporthandels lieferte, wie sie nach wenigen Jahren sich wieder ausdehnen werde durch Erweiterung des Markts, besonders Indiens, und durch Erzwingung hinreichender „Baumwollzufuhr, zu 6 d. das Pfund“. Er fährt dann fort: „Zeit — eins, zwei, drei Jahre vielleicht — wird die nöthige Quantität produciren . . . . Ich möchte dann die Frage stellen, ist diese Industrie werth sie festzuhalten, ist es der Mühe werth die Maschinerie (nämlich die lebendigen Arbeitsmaschinen) in Ordnung zu halten, und ist es nicht die grösste Narrheit, daran zu denken, sie aufzugeben! Ich glaube so. Ich will zugeben, dass die Arbeiter nicht Eigenthum sind („I allow that the workers are not a property“), nicht das Eigenthum Lancashire’s und der Meister; aber sie sind die Stärke beider; sie sind die geistige und geschulte Kraft, die in einer Generation nicht ersetzt werden kann; die andere Maschinerie dagegen, woran sie arbeiten („the mere machinery which they work“), könnte zum grossen Theil mit Vortheil ersetzt und verbessert werden in zwölf Monaten(FN 14). Ermuntert oder erlaubt (!) die Emi
gration der Arbeitskraft und was wird aus dem Kapitalisten? („Encourage or allow the working power to emigrate, and what of the capitalist?“ Dieser Herzensstoss erinnert an Hofmarschall Kalb.) … Nimm den Rahm der Arbeiter weg, und das fixe Kapital wird in hohem Grad entwerthet und das cirkulirende Kapital wird sich nicht dem Kampf mit schmaler Zufuhr einer niedrigeren Sorte von Arbeit aussetzen. . . . Man sagt uns, die Arbeiter selbst wünschen die Emigration. Es ist sehr natürlich, dass sie das thun. . . . Reducire, komprimire das Baumwollgeschäft durch Wegnahme seiner Arbeitskraft (by taking away its working power), durch Verminderung ihrer Lohnverausgabung sage um ⅓ oder 5 Millionen, und was wird dann aus der nächsten Klasse über ihnen, den Kleinkrämern? Was aus den Grundrenten, was aus der Miethe der cottages? … was aus dem kleinen Pächter, dem besseren Hausbesitzer und dem Grundeigenthümer? Und sagt nun, ob irgend ein Plan für alle Klassen des Landes selbstmörderischer sein kann als dieser, dieN ation zu schwächen durch den Export ihrer besten Fabrikarbeiter und die Entwerthung eines Theils ihres produktivsten Kapitals und Reichthums?“ „Ich rathe zu einer Anleihe von 5 bis 6 Millionen, über 2 oder 3 Jahre vertheilt, administrirt durch Spezialkommissäre, beigeordnet den Armenverwaltungen in den Baumwolldistrikten, unter speziellen gesetzlichen Regulationen, mit gewisser Zwangsarbeit, um die moralische Valuta der Almosenempfänger aufrecht zu erhalten. . . . Kann es irgend etwas Schlimmeres geben für Grundeigenthümer oder Meister („can anything be worse for landowners or masters“) als ihre besten Arbeiter aufzugeben und die übrigbleibenden zu demoralisiren und zu verstimmen durch eine ausgedehnte entleerende Emigration und Entleerung von Werth und Kapital in einer ganzen Provinz?“
Potter, das auserwählte Organ der Baumwollfabrikanten, unterscheidet doppelte „ Maschinerie“, deren jede dem Kapitalisten gehört, und wovon die eine in seiner Fabrik steht, die andre des Nachts und Sonntags auswärtig in cottages haust. Die eine ist todt, die andre lebendig. Die todte Maschinerie verschlechtert und entwerthet sich nicht nur jeden Tag, sondern von ihrer existirenden Masse ist ein grosser Theil durch den beständigen technologischen Fortschritt beständig so sehr antiquirt, dass sie vortheilhaft und in wenigen Monaten durch neuere Maschinerie ersetzbar. Die lebendige Maschinerie verbessert sich umgekehrt, je länger sie währt, je mehr sie das Geschick von Generationen in sich aufhäuft. Die Times antwortete dem Fabrikmagnaten u. a.:
„Herr E. Potter ist so impressionirt mit der ausserordentlichen und absoluten Wichtigkeit der Baumwollmeister, dass er, um diese Klasse zu erhalten und ihr Metier zu verewigen, eine halbe Million der Arbeiterklasse wider ihren Willen in ein grosses moralisches Workhouse einsperren will. Ist diese Industrie werth sie festzuhalten? fragt Herr Potter. Sicher, durch alle ehrbaren Mittel! antworten wir. Ist es der Mühe werth die Maschinerie in Ordnung zu halten? fragt wieder Herr Potter. Hier stutzen wir. Unter der Maschinerie versteht Herr Potter die menschliche Maschinerie, denn er betheuert, dass er sie nicht als absolutes Eigenthum zu behandeln vorhat. Wir müssen gestehn, wir halten es nicht ‚der Mühe werth‘ oder selbst für möglich, die menschliche Maschinerie in Ordnung zu halten, d. h. einzusperren und einzuölen bis ihrer bedurft wird. Menschliche Maschinerie hat die Eigenschaft während der Unthätigkeit zu verrosten, ihr mögt noch soviel dran ölen oder reiben. Zudem ist menschliche Maschinerie, wie der Augenschein uns eben lehrt, im Stand von eignen Stücken den Dampf anzulassen und zu platzen oder einen Veitstanz in unsren grossen Städten zu tollen. Es mag, wie Herr Potter sagt, längere Zeit zur Reproduktion der Arbeiter erheischt sein, aber mit Maschinisten und Geld zur Hand werden wir stets betriebsame, harte, industrielle Männer finden, um daraus mehr Fabrikmeister zu fabriciren als wir je verbrauchen können. . . . Herr Potter plaudert von einer Wiederbelebung der Industrie in 1, 2, 3 Jahren und verlangt von uns die Emigration der Arbeitskraft nicht zu ermuntern oder nicht zu erlauben! Er sagt, es sei natürlich, dass die Arbeiter zu emigriren wün-
schen, aber er meint, dass die Nation diese halbe Million Arbeiter mit den 700,000, die an ihnen hängen, ihrem Verlangen zum Trotz in die Baumwolldistrikte einsperren und, eine nothwendige Konsequenz, ihr Missvergnügen durch Gewalt niederschlagen und sie selbst durch Almosen fristen muss, alles das auf die Chance hin, dass die Baumwollmeister ihrer an einem beliebigen Tag wieder bedürfen mögen. . . . Die Zeit ist gekommen, wo die grosse öffentliche Meinung dieser Eilande etwas thun muss, um ‚ diese Arbeitskraft‘ vor denen zu retten, die sie behandeln wollen, wie sie Kohle, Eisen und Baumwolle behandeln.“ („to save this ‘working power’ from those who would deal with it as they deal with iron, coal and cotton.“)(FN 15)
Der Times-Artikel war nur ein jeu d’esprit. Die „grosse öffentliche Meinung“ war in der That der Meinung des Herrn Potter, dass die Fabrikarbeiter Mobiliarzubehör der Fabriken. Ihre Emigration wurde verhindert(FN 16). Man sperrte sie in das „moralische Workhouse“ der Baumwolldistrikte, und sie bilden nach wie vor „die Stärke (the strength) der Baumwollmeister von Lancashire.“
Der kapitalistische Produktionsprozess reproducirt also durch seinen eignen Vorgang die Scheidung zwischen Arbeitskraft und Arbeitsbedingungen. Er reproducirt und verewigt damit die Exploitationsbedingungen des Arbeiters. Er zwingt beständig den Arbeiter zum Verkauf seiner Arbeitskraft, um zu leben, und befähigt beständig den Kapitalisten zu ihrem Kauf, um sich zu bereichern(FN 17). Es ist nicht mehr der Zufall, welcher Kapitalist und Arbeiter als Käufer und Verkäufer auf dem Waaren-
markt gegenüberstellt. Es ist die Zwickmühle des Prozesses selbst, die den Einen stets als Verkäufer seiner Arbeitskraft auf den Waarenmarkt zurückschleudert und sein eignes Produkt stets in das Kaufmittel des Andern verwandelt. In der That gehört der Arbeiter dem Kapital, bevor er sich dem Kapitalisten verkauft. Seine ökonomische Hörigkeit(FN 18) ist zugleich vermittelt und zugleich versteckt durch die periodische Erneurung seines Selbstverkaufs, den Wechsel seiner individuellen Lohnherrn und die Oscillation im Marktpreise der Arbeit(FN 19).
Der kapitalistische Produktionsprozess, im Zusammenhang betrachtet, oder als Reproduktionsprozess, producirt also nicht nur Waare, nicht nur Mehrwerth, er producirt und reproducirt das Kapitalverhältniss selbst, auf der einen Seite den Kapitalisten, auf der andern den Lohnarbeiter(FN 20).
Früher hatten wir zu betrachten, wie der Mehrwerth aus dem Kapital, jetzt wie das Kapital aus dem Mehrwerth entspringt. Anwendung von Mehrwerth als Kapital oder Rückverwandlung von Mehrwerth in Kapital heisst Accumulation des Kapitals(FN 21).
Ein Kapital betrage 10,000 Pfd. St., sein variabler Bestandtheil 2000 Pfd. St. Bei einer Rate des Mehrwerths von 100 % producirt es in einer gewissen Periode, jährlich z. B., einen Mehrwerth von 2000 Pfd. St. Werden diese 2000 Pfd. St. wieder als Kapital vorgeschossen, so wächst das ursprüngliche Kapital von 10,000 auf 12,000 Pfd. St. oder es hat accumulirt. Es ist zunächst gleichgiltig, ob das Zuschusskapital zum alten geschlagen oder selbstständig verwerthet wird.
Eine Werthsumme von 2000 Pfd. St. ist eine Werthsumme von 2000 Pfd. St. Man riecht und sieht diesem Geld nicht an, dass es Mehrwerth ist. Der Charakter eines Werths als Mehrwerth zeigt, wie er zu seinem Eigner kam, ändert aber nichts an der Natur des Werths oder des Geldes. Die Verwandlung der zuschüssigen 2000 Pfd. St. in Kapital geht also in derselben Weise vor, wie die Verwandlung der ursprünglichen 10,000 Pfd. St. Die Bedingungen der Metamorphose bleiben dieselben. Ein Theil der 2000 Pfd. St. muss in constantes, der andre in variables Kapital verwandelt werden, der eine in die objektiven Faktoren des Arbeitsprozesses, Arbeitsmaterial und Arbeitsmittel, der andre in seinen subjektiven Faktor, Arbeitskraft. Der Kapitalist muss also diese Elemente auf dem Waarenmarkt vorfinden. So stellt sich der Vorgang dar vom Standpunkt des individuellen Kapitalisten, der die Geldsumme von 10,000 Pfd. St. in einen Waarenwerth von 12,000 Pfd. St. verwandelt, diesen Waarenwerth in Geld zum Belauf von 12,000 Pfd. St. rückverwandelt, und nun neben dem ursprünglichen Werth von 10,000 Pfd. St.
auch den zuschüssigen Werth von 2000 Pfd. St. als sein Kapital funktioniren lässt. Betrachten wir aber die 10,000 Pfd. St. als das gesellschaftliche Kapital oder als das Gesammtkapital der Kapitalistenklasse, und die 2000 Pfd. St. als ihren während des Jahrs z. B. producirten Mehrwerth! Der Mehrwerth ist verkörpert in einem zuschüssigen Produkt oder Mehrprodukt. Ein Theil dieses Mehrprodukts geht in den Konsumtionsfonds der Kapitalisten ein oder wird von ihnen als Revenue verzehrt. Abgesehn von diesem Theil, ebenso vom internationalen Handel, der inländische durch ausländische Waarensorten ersetzt, besteht das Mehrprodukt, in seiner Naturalform, nur aus Produktionsmitteln, Rohstoffen, Hilfsstoffen, Arbeitsmitteln, und aus nothwendigen Lebensmitteln, also aus den stofflichen Elementen des constanten und variablen Kapitals. Diese finden sich also nicht zufällig auf dem Markt vor, sondern sind bereits vorhandne Existenzweisen des producirten Mehrwerths selbst. Was aber die erheischte zuschüssige Arbeit angeht, so können bis zu einem gewissen Grad die bereits funktionirenden Arbeitskräfte voller beschäftigt, extensiv oder intensiv höher angespannt werden. Andrerseits hat der kapitalistische Produktionsprozess mit den sachlichen Elementen des zuschüssigen Kapitals auch bereits zuschüssige Arbeitskräfte geliefert. Da nämlich die Arbeiterklasse aus dem Prozess herauskömmt, wie sie in ihn eintrat, müssen verschiedne Altersklassen ihrer Kinder, deren Existenz der Durchschnittslohn sichert, beständig neben sie auf den Arbeitsmarkt treten. Konkret betrachtet ist die Accumulation also kapitalistischer Reproduktionsprozess auf erweiterter Stufenleiter.
Den in Zuschusskapital verwandelten Mehrwerth von 2000 Pfd. St. wollen wir Surpluskapital Nr. I nennen. Der Vereinfachung wegen vorausgesetzt, seine Theilung in constanten und variablen Bestandtheil bleibe dieselbe wie beim ursprünglichen Kapital, ebenso die Rate des Mehrwerths von 100 %, und wir kennen die Methode, worin diess Kapital von 2000 Pfd. St. einen Mehrwerth von 400 Pfd. St. producirt. Dieser Mehrwerth werde wieder in Kapital verwandelt. So erhalten wir Surpluskapital Nr. II von 400 Pfd. St. u. s. w.
Was hat sich nun geändert? Die 10,000 Pfd. St., die sich ursprünglich in Kapital verwandelten, waren das Eigenthum ihres Besitzers. Er warf sie auf den Waarenund Arbeitsmarkt. Wo hat er sie her? Wir
wissen es nicht. Das Gesetz des Waarenaustausches, wonach sich im Durchschnitt Aequivalente austauschen und jeder nur mit Waare Waare kauft, begünstigt die Annahme, dass die 10,000 Pfd. St. nur die Geldform seiner eignen Produkte und daher seiner eignen Arbeit sind, oder der Arbeit von Personen, als deren rechtmässiger Stellvertreter er funktionirt.
Den Entstehungsprozess des Surpluskapitals Nr. I kennen wir dagegen ganz genau. Es ist nur die verwandelte Form von Mehrwerth, also von Mehrarbeit, unbezahlter fremder Arbeit. Es ist kein Werthatomdarin, wofür sein Besitzer ein Aequivalent gezahlt hätte. Allerdings kauft der Kapitalist, wie vorher mit einem Theil des ursprünglichen, so jetzt mit einem Theil des Surplus-Kapitals von neuem Arbeitskraft, woraus er von neuem Mehrarbeit pumpt und daher von neuem Mehrwerth producirt. Aber er kauft den Arbeiter jetzt mit dessen eignem, ihm vorher ohne Aequivalent weggenommenen Produkt oder Produktenwerth, ganz wie er ihn mit Produktionsmitteln beschäftigt, die in natura oder deren Werth ohne Aequivalent weggenommenes Produkt des Arbeiters sind. Es ändert durchaus nichts an der Sache, ob dieselben individuellen Arbeiter, die das Surpluskapital producirt haben, auch damit beschäftigt werden, oder ob mit der in Geld verwandelten unbezahlten Arbeit des Arbeiters A der Arbeiter B geworben wird. Diess ändert nur die Erscheinung, ohne sie zu verschönern. Da das Verhältniss des individuellen Kapitalisten und des individuellen Arbeiters das von einander unabhängiger Waarenbesitzer ist, von denen der eine Arbeitskraft kauft, der andre verkauft, ist ihr Zusammenhang zufällig. Der Kapitalist verwandelt vielleicht das Surpluskapital in eine Maschine, die den Producenten des Surpluskapitals aufs Pflaster wirft und durch ein paar Kinder ersetzt.
In dem Surpluskapital Nr. I sind alle Bestandtheile Produkt unbezahlter fremder Arbeit, kapitalisirter Mehrwerth. Es verschwindet der Schein der ersten Darstellung des Produktionsprozesses oder des ersten Akts der Kapitalbildung, als ob der Kapitalist irgend welche Werthe aus seinem eignen Fonds in die Cirkulation würfe. Erst entführt die unsichtbare Magie des Prozesses das Mehrprodukt des Arbeiters von seinem Pol zum Gegenpol des Kapitalisten. Dann verwandelt der Kapitalist diesen Reichthum, der für ihn eine Schöpfung aus Nichts ist, in Kapital, in ein Mittel
zur Anwendung, Beherrschung und Exploitation zuschüssiger Arbeitskraft(FN 22).
Im kapitalistischen Produktionsprozess wird ursprünglich nur eine dem Geldbesitzer, wir wissen nicht auf welche Titel hin, gehörige Werthsumme in Kapital und daher Quelle von Mehrwerth verwandelt. Es geht eine Veränderung mit dieser Werthsumme vor, aber sie selbst ist nicht das Resultat des Prozesses, sondern vielmehr seine von ihm unabhängige Voraussetzung. Im einfachen Reproduktionsprozess, oder dem kontinuirlichen Produktionsprozess, ist es ein Theil vom Produkt des Arbeiters, der ihm stets von neuem als variables Kapital gegenübertritt, aber sein Produkt nimmt stets von neuem diese Form an, weil er ursprünglich seine Arbeitskraft für das Geld des Kapitalisten verkaufte. Endlich verwandelt sich im Verlauf der Reproduktion aller vom Kapitalisten vorgeschossene Kapitalwerth in kapitalisirten Mehrwerth, aber diese Verwandlung selbst unterstellt, dass der Fonds ursprünglich aus seinen eignen Mitteln herstammt. Anders im Accumulationsprozess oder dem Reproduktionsprozess auf erweiterter Stufenleiter. Das Geld, oder stofflich ausgedrückt, die Produktionsund Lebensmittel, die Substanz des neuen Kapitals, ist selbst das Produkt des Prozesses, der fremde unbezahlte Arbeit auspumpt. Das Kapital hat Kapital producirt.
Eine dem Kapitalisten gehörige Werthsumme von 10,000 Pfd. St. war die Voraussetzung für Bildung des Surpluskapitals Nr. I von 2000 Pfd. St. Die Voraussetzung des Surpluskapitals Nr. II von 400 Pfd. St. ist nichts anders als die Existenz des Surpluskapitals Nr. I. Eigenthum an vergangner unbezahlter Arbeit erscheint jetzt als die einzige Bedingung für gegenwärtige Aneignung unbezahlter lebendiger Arbeit in stets wachsendem Umfang.
Insofern der Mehrwerth, woraus Surpluskapital Nr. I besteht, das Resultat des Ankaufs der Arbeitskraft durch einen Theil des Originalkapitals war, ein Kauf, der den Gesetzen des Waarenaustausches entsprach, und, juristisch betrachtet, nichts voraussetzt als freie Verfügung, auf Seiten des Arbeiters über seine eignen Fähigkeiten, auf Seiten des Geldoder Waaren-
besitzers über ihm gehörige Werthe; sofern Surpluskapital Nr. II u. s. w. bloss Resultat von Surpluskapital Nr. I, also Konsequenz jenes ersten Verhältnisses; sofern jede einzelne Transaktion fortwährend dem Gesetz des Waarenaustausches entspricht, der Kapitalist stets die Arbeitskraft kauft, der Arbeiter sie stets verkauft, und wir wollen annehmen selbst zu ihrem wirklichen Werth, schlägt offenbar das auf Waarenproduktion und Waarencirkulation beruhende Gesetz der Aneignung oder Gesetz des Privateigenthums durch seine eigne, innere, unvermeidliche Dialektik in sein direktes Gegentheil um(FN 23). Der Austausch von Aequivalenten, der als die ursprüngliche Operation erschien, hat sich so gedreht, dass nur zum Schein ausgetauscht wird, indem erstens der gegen Arbeitskraft ausgetauschte Kapitaltheil selbst nur ein Theil des ohne Aequivalent angeeigneten fremden Arbeitsproduktes ist, und zweitens von seinem Producenten, dem Arbeiter, nicht nur ersetzt, sondern mit neuem Surplus ersetzt werden muss. Das Verhältniss des Austausches zwischen Kapitalist und Arbeiter wird also nur dem Cirkulationsprozess angehöriger Schein, blosse Form, die dem Inhalt selbst fremd ist und ihn nur mystificirt. Der beständige Kauf und Verkauf der Arbeitskraft ist die Form. Der Inhalt ist, dass der Kapitalist einen Theil der bereits vergegenständlichten fremden Arbeit, die er sich unauf hörlich ohne Aequivalent aneignet, stets wieder gegen grösseres Quantum lebendiger fremder Arbeit umsetzt. Ursprünglich erschien uns das Eigenthumsrecht gegründet auf eigne Arbeit. Wenigstens musste diese Annahme gelten, da sich nur gleichberechtigte Waarenbesitzer gegenüberstehn, das Mittel zur Aneignung fremder Waare aber nur die Veräusserung der eignen Waare, und letztere nur durch Arbeit herstellbar ist. Eigenthum erscheint jetzt, auf Seite des Kapitalisten, als das Recht fremde unbezahlte
Arbeit oder ihr Produkt, auf Seite des Arbeiters, als Unmöglichkeit, sich sein eignes Produkt anzueignen. Die Scheidung zwischen Eigenthum und Arbeit wird zur nothwendigen Konsequenz eines Gesetzes, das scheinbar von ihrer Identität ausging(FN 24). Man sah, dass selbst bei einfacher Reproduktion alles vorgeschossene Kapital, wie immer ursprünglich erworben, sich in accumulirtes Kapital oder kapitalisirten Mehrwerth verwandelt. Aber im Strom der Produktion wird überhaupt alles ursprünglich vorgeschossene Kapital eine verschwindende Grösse (magnitudo evanescens im mathematischen Sinn) verglichen mit dem direkt accumulirten Kapital, d. h. in Kapital rückverwandelten Mehrwerth oder Mehrprodukt, ob nun funktionirend in der Hand, die accumulirt hat, oder in fremder Hand. Die politische Oekonomie stellt das Kapital daher überhaupt als „ accumulirten Reichthum (verwandelten Mehrwerth oder Revenue) dar, der von neuem zur Produktion von Mehrwerth verwandt wird“(FN 25), oder auch den Kapitalisten als „Besitzer des Mehrprodukts“(FN 26). Dieselbe Anschauungsweise besitzt nur andre Form in dem Ausdruck, dass alles vorhandne Kapital accumulirter oder kapitalisirter Zins sei, denn der Zins ist ein blosses Bruchstück des Mehrwerths(FN 27).
Bevor wir nun auf einige nähere Bestimmungen der Accumulation oder der Rückverwandlung von Mehrwerth in Kapital eingehn, ist
eine von der klassischen Oekonomie ausgeheckte Zweideutigkeit zu beseitigen.
So wenig die Waaren, die der Kapitalist mit einem Theil des Mehrwerths für seine eigne Konsumtion kauft, ihm als Produktionsund Verwerthungsmittel dienen, so wenig ist die Arbeit, die er zur Befriedigung seiner natürlichen und socialen Bedürfnisse kauft, produktive Arbeit. Statt durch den Kauf jener Waaren und Arbeit den Mehrwerth in Kapital zu verwandeln, verzehrt oder verausgabt er ihn umgekehrt als Revenue. Gegenüber der altadlichen Gesinnung, die, wie Hegel richtig sagt, „im Verzehren des Vorhandenen besteht“ und namentlich auch im Luxus persönlicher Dienste sich breit macht, war es entscheidend wichtig für die bürgerliche Oekonomie hervorzuheben, dass das Evangelium der neuen Gesellschaft, nämlich Accumulation von Kapital, die Auslage von Mehrwerth im Ankauf produktiver Arbeiter als conditio sine qua predigt. Andrerseits hatte man gegen das Volksvorurtheil zu polemisiren, welches die kapitalistische Produktion mit der Schatzbildung verwechselt(FN 28) und daher wähnt, accumulirter Reichthum sei dem Verbrauch, also der Zerstörung in seiner vorhandnen Naturalform, entzogner oder auch vor der Cirkulation geretteter Reichthum. Verschluss des Geldes gegen die Cirkulation wäre grade das Gegentheil seiner Verwerthung als Kapital, und Waarenaccumulation im schatzbildnerischen Sinn reine Narrheit. Accumulation von Waaren in grossen Massen ist Resultat einer Cirkulationsstockung oder der Ueberproduktion(FN 29). Allerdings läuft in der Volksvorstellung das Bild der im Konsumtionsfonds der Reichen gehäuften, langsam sich verzehrenden Güter unter. Andrerseits die Vorrathbildung, ein Phänomen, das allen Produktionsweisen angehört und wobei wir einen Augenblick in der Analyse des Cirkulationsprozesses verweilen werden.
Soweit also ist die klassische Oekonomie im Recht, wenn sie den Verzehr von Surplusprodukt durch produktive Arbeiter statt durch unproduktive als charakteristisches Phänomen des Accumulationsprozesses betont. Aber hier beginnt auch ihr Irrthum. A. Smith hat es zur Mode gemacht, die Accumulation als Konsumtion des Mehrprodukts durch produktive Arbeiter oder die Kapitalisirung des Mehrwerths als dessen blossen Umsatz in Arbeitskraft darzustellen. Hören wir z. B. Ricardo: „Man muss verstehn, dass alle Produkte eines Landes konsumirt werden; aber es macht den grössten Unterschied, den man denken kann, ob sie konsumirt werden durch solche, die einen andern Werth reproduciren oder durch solche, die ihn nicht reproduciren. Wenn wir sagen, dass Revenue erspart und zum Kapital geschlagen wird, so meinen wir, dass der Theil der Revenue, von dem es heisst, er sei zum Kapital geschlagen, durch produktive statt durch unproduktive Arbeiter verzehrt wird“(FN 30). Es giebt keinen grösseren Irrthum als der dem A. Smith von Ricardo und allen Späteren nachgeplauderte, dass „ der Theil der Revenue, von dem es heisst, er sei zum Kapital geschlagen, von produktiven Arbeitern verzehrt wird.“ Nach dieser Vorstellung würde aller Mehrwerth, der in Kapital verwandelt wird, zu variablem Kapital. Er theilt sich vielmehr, wie der ursprünglich vorgeschossene Werth, in constantes Kapital und variables Kapital, in Produktionsmittel und Arbeitskraft. Arbeitskraft ist die Form, worin das variable Kapital innerhalb des Produktionsprozesses existirt. In diesem Prozess wird sie selbst vom Kapitalisten verzehrt. Sie verzehrt durch ihre Funktion — die Arbeit — Produktionsmittel. Zugleich verwandelt sich das im Ankauf der Arbeitskraft gezahlte Geld in Lebensmittel, die nicht von der „ produktiven Arbeit“, sondern vom „ produktiven Arbeiter“ verzehrt werden. A. Smith gelangt durch eine grundverkehrte Analyse zu dem abgeschmackten Resultat, dass wenn auch jedes individuelle Kapital sich in constanten und variablen Bestandtheil theilt, das gesellschaftliche Kapital sich in nur variables Kapital auflöst oder nur in Zahlung von Arbeitslohn verausgabt wird. Z. B. ein Tuchfabrikant verwandle 2000 Pfd. St. in Kapital. Er legt
einen Theil des Geldes im Ankauf von Webern aus, den andern Theil in Wollengarn, Wollenmaschinerie u. s. w. Aber die Leute, von denen er das Garn und die Maschinerie kauft, zahlen wieder mit einem Theil davon Arbeit u. s. w., bis die ganzen 2000 Pfd. St. in Zahlung von Arbeitslohn verausgabt sind, oder das ganze durch die 2000 Pfd. St. repräsentirte Produkt durch produktive Arbeiter verzehrt ist. Man sieht: die ganze Wucht dieses Arguments liegt in dem Wort „u. s. w.“, das uns von Pontius zu Pilatus schickt. In der That, A. Smith bricht die Untersuchung grade da ab, wo ihre Schwierigkeit beginnt(FN 31). Im dritten Kapitel des zweiten Buchs werde ich die Analyse des wirklichen Zusammenhangs geben. Es wird sich dort zeigen, dass A. Smith’s auf alle seine Nachfolger vererbtes Dogma die politische Oekonomie verhindert hat auch nur den Elementarmechanismus des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu begreifen(FN 32).
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels betrachteten wir den ganzen Mehrwerth, resp. das Mehrprodukt, nur als individuellen Konsumtionsfonds des Kapitalisten, in diesem Abschnitt bisher nur als seinen Accumulationsfonds. Er ist aber weder nur das eine, noch das
andre, sondern beides zugleich. Ein Theil des Mehrwerths wird vom Kapitalisten als Revenue verzehrt(FN 33), ein andrer Theil als Kapital angewandt oder accumulirt.
Die Masse des Mehrwerths gegeben, hängt die Grösse der Accumulation offenbar ab von der Theilung des Mehrwerths in Accumulationsfonds und Konsumtionsfonds, in Kapital und Revenue. Je grösser der eine Theil, desto kleiner der andre. Die Masse des Mehrwerths oder des Mehrprodukts, daher des disponiblen Reichthums eines Landes, die in Kapital verwandelt werden kann, ist daher stets grösser als der wirklich in Kapital verwandelte Theil des Mehrwerths. Je entwickelter die kapitalistische Produktion in einem Lande, je rascher und massenhafter die Accumulation, je reicher das Land, je kolossaler daher Luxus und Verschwendung, desto grösser diese Differenz. Vom jährlichen Zuwachs des Reichthums abgesehn, besitzt der im Konsumtionsfonds der Kapitalisten befindliche, nur allmälig zerstörbare Reichthum zum Theil Naturalformen, worin er unmittelbar als Kapital funktioniren könnte. Zu den vorhandnen Elementen des Reichthums, die im Produktionsprozess funktioniren könnten, zählen alle Arbeitskräfte, die gar nicht oder zu rein konventionell persönlichen, oft infamen, Dienstleistungen verbraucht werden. Die Proportion, worin der Mehrwerth in Kapital und Revenue getheilt wird, wechselt unaufhörlich und ist durch Umstände beherrscht, die hier nicht weiter zu entwickeln sind. Das in einem Land angewandte Kapital ist daher keine fixe, sondern eine fluktuirende Grösse, ein stets variabler und elastischer Bruchtheil des vorhandnen Reichthums, der als Kapital funktioniren kann.
Da die beständige Aneignung des vom Arbeiter producirten Mehrwerths oder Mehrprodukts für den Kapitalisten als periodische Fruchttragung seines Kapitals erscheint, oder das fremde Arbeitsprodukt, welches er ohne Aequivalent irgend einer Art usurpirt, einen periodischen Zuwachs seines Privat-
vermögens bildet, ist natürlich auch die Theilung dieses Mehrwerths oder Mehrprodukts in Zuschusskapital und Konsumtionsfonds durch einen Willensakt seinerseits vermittelt.
Nur soweit der Kapitalist personificirtes Kapital ist, hat er einen historischen Werth und jenes historische Existenzrecht, das, wie der geistreiche Lichnowsky sagt, keinen Datum nicht hat. Nur soweit steckt seine eigne transitorische Nothwendigkeit in der transitorischen Nothwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Aber soweit sind auch nicht Gebrauchswerth und Genuss, sondern Tauschwerth und dessen Vermehrung sein treibendes Motiv. Als Fanatiker der Verwerthung des Werths zwingt er rücksichtslos die Menschheit zur Produktion um der Produktion willen, daher zu einer Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte und zur Schöpfung von materiellen Produktionsbedingungen, welche allein die reale Basis einer höheren Gesellschaftsform bilden können, deren Grundprincip die volle und freie Entwicklung jedes Individuums ist. Nur als Personifikation des Kapitals ist der Kapitalist respektabel. Als solche theilt er mit dem Schatzbildner den absoluten Bereicherungstrieb. Ausserdem zwingen ihn die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise, welche die Konkurrenz jedem individuellen Kapitalisten als äussere Zwangsgesetze oktroyirt, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten. Soweit daher sein Thun und Lassen nur Funktion des in ihm mit Willen und Bewusstsein begabten Kapitals, gilt ihm sein eigner Privatkonsum als ein Raub an der Accumulation seines Kapitals, wie in der italienischen Buchhaltung Privatausgaben auf der Debetseite des Kapitalisten gegen das Kapital figuriren. Die Accumulation ist Eroberung der Welt des gesellschaftlichen Reichthums. Sie dehnt mit der Masse des exploitirten Menschenmaterials zugleich die direkte und indirekte Herrschaft des Kapitalisten aus(FN 34).
Aber die Erbsünde wirkt überall. Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, der Accumulation, und des Reichthums, hört der Kapitalist auf, blosse Inkarnation des Kapitals zu sein. Er fühlt ein „menschliches Rühren“ für seinen eignen Adam und wird so gebildet, die Schwärmerei für Ascese als Vorurtheil des altmodischen Schatzbildners zu belächeln. Während der klassische Kapitalist den individuellen Konsum als Sünde gegen seine Funktion und „Enthaltung“ von der Accumulation brandmarkt, ist der modernisirte Kapitalist im Stande, die Accumulation als „Entsagung“ seines Genusstriebs aufzufassen. „Zwei Seelen wohnen Ach! in seiner Brust, die eine will sich von der andern trennen!“
In den historischen Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise — und jeder kapitalistische Parvenü macht diess historische Stadium individuell durch — herrschen Bereicherungstrieb und Geiz als absolute Leidenschaften vor. Aber der Fortschritt der kapitalistischen Produktion schafft nicht nur eine Welt von Genüssen. Er öffnet mit der Spekulation und dem Kreditwesen tausend Quellen plötzlicher Bereicherung. Auf einer gewissen Entwicklungshöhe wird ein konventioneller Grad von Verschwendung, die zugleich Schaustellung des Reichthums und daher Kreditmittel ist, sogar zu einer Geschäftsnothwendigkeit des „unglücklichen“ Kapitalisten. Der Luxus geht in die Repräsentationskosten des Kapitals ein. Ohnehin bereichert sich der Kapitalist nicht, gleich dem Schatzbildner, im Verhältniss seiner persönlichen Arbeit und seines persönlichen Nichtkonsums, sondern im Mass, worin er fremde Arbeitskraft aussaugt und dem Arbeiter Entsagung aller Lebensgenüsse aufzwingt. Obgleich daher die Verschwendung des Kapitalisten nie den bona fide. Charakter der Verschwendung des flotten Feudalherrn besitzt, in ihrem Hintergrund vielmehr stets schmutzigster Geiz und ängstlichste Berechnung lauern, wächst dennoch seine Verschwendung mit seiner Accumulation, ohne dass die eine die andre zu beabbruchen braucht. Damit entwickelt sich gleichzeitig in der Hochbrust des Kapitalindividuums ein faustischer Konflikt zwischen Accumulationsund Genusstrieb.
„Die Industrie von Manchester“, heisst es in einer Schrift, die Dr. Aikin 1795 veröffentlichte, „kann in vier Perioden getheilt werden. In der ersten waren die Fabrikanten gezwungen, hart für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten.“ Sie bereicherten sich besonders durch Bestehlung der Eltern, die ihnen Jungen als apprentices (Lehrlinge) zuwiesen und dafür schwer blechen mussten, während die Lehrlinge ausgehungert wurden. Andrerseits waren die Durchschnittsprofite niedrig und die Accumulation verlangte grosse Sparsamkeit. Sie lebten wie Schatzbildner und verzehrten bei weitem nicht einmal die Zinsen ihres Kapitals. „In der zweiten Periode hatten sie begonnen, kleine Vermögen zu erwerben, arbeiteten aber ebenso hart als zuvor,“ denn die unmittelbare Exploitation der Arbeit kostet Arbeit, wie jeder Sklaventreiber weiss, „und lebten nach wie vor in demselben frugalen Styl. … In der dritten Periode begann der Luxus und das Geschäft wurde ausgedehnt durch Aussendung von Reitern (berittenen Commis Voyageurs) für Ordres in jeder Marktstadt des König-
reichs. Es ist wahrscheinlich, dass wenige oder keine Kapitalien von 3000 bis 4000 Pfd. St., in der Industrie erworben, vor 1690 existirten. Um diese Zeit jedoch oder etwas später hatten die Industriellen schon Geld accumulirt und begannen steinerne Häuser statt der von Holz und Mörtel aufzuführen. … Noch in den ersten Decennien des 18. Jahrhunderts setzte sich ein Manchester Fabrikant, der eine Pint fremden Weins seinen Gästen vorsetzte, den Glossen und dem Kopfschütteln aller seiner Nachbarn aus.“ Vor dem Aufkommen der Maschinerie betrug der abendliche Konsum der Fabrikanten in den Kneipen, wo sie zusammenkamen, nie mehr als 6 d. für ein Glas Punsch und 1 d. für eine Rolle Taback. Erst 1758, und diess macht Epoche, sah man „ eine im Geschäft wirklich engagirte Person mit eigner Equipage!“ „Die vierte Periode“, das letzte Drittheil des 18. Jahrhunderts, „ist die von grossem Luxus und Verschwendung, unterstützt durch die Ausdehnung des Geschäfts“(FN 35). Was würde der gute Dr. Aikin sagen, wenn er heutzutag in Manchester auferstände!
Accumulirt, accumulirt! Das ist Moses und die Propheten! „Die Industrie liefert das Material, welches die Sparsamkeit accumulirt“(FN 36). Also spart, spart, d. h. rückverwandelt möglichst grossen Theil des Mehrwerths oder Mehrprodukts in Kapital! Accumulation um der Accumulation, Produktion um der Produktion willen, in dieser Formel sprach die klassische Oekonomie den historischen Beruf der Bourgeoisperiode aus. Sie täuschte sich keinen Augenblick über die Geburtswehn des Reichthums(FN 37), aber was nützt der Jammer über historische Nothwendigkeit? Wenn der klassischen Oekonomie der Proletarier nur als Maschine zur Produktion von Mehrwerth, gilt ihr aber auch der Kapitalist nur als Maschine zur Verwandlung dieses Mehrwerths in Mehrkapital. Sie nimmt seine historische Funktion in bitterm Ernst. Um seinen Busen vor dem unheilvollen Konflikt zwischen Genusstrieb und Bereicherungstrieb zu feien,
vertheidigte Malthus, im Anfang der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts, eine Theilung der Arbeit, welche dem wirklich in der Produktion begriffenen Kapitalisten das Geschäft der Accumulation, den andern Theilnehmern am Mehrwerth, der Landaristokratie, Staats-, Kirchenpfründnern u. s. w. das Geschäft der Verschwendung zuweist. Es ist von der höchsten Wichtigkeit, sagt er, „die Leidenschaft für Ausgabe und die Leidenschaft für Accumulation („the passion for expenditure and the passion for accumulation“) getrennt zu halten“(FN 38). Die Herrn Kapitalisten, seit lange in Lebeund Weltmänner verwandelt, schrieen auf. Was, rief einer ihrer Wortführer, ein Ricardianer, Herr Malthus predigt hohe Grundrenten, hohe Steuern u. s. w., um dem Industriellen einen fortwährenden Stachel durch unproduktive Konsumenten aufzudrücken! Allerdings Produktion, Produktion auf stets erweiterter Stufenleiter, lautet das Schiboleth, aber „Produktion wird durch einen solchen Prozess weit mehr gehemmt als gefördert. Auch ist es nicht ganz billig (nor is it quite fair) eine Anzahl Personen so im Müssiggang zu erhalten, nur um andre zu kneipen, aus deren Charakter man schliessen darf, („who are likely, from their characters“), dass wenn ihr sie zu funktioniren zwingen könnt, sie mit Erfolg funktioniren“(FN 39). So unbillig er es findet den industriellen Kapitalisten zur Accumulation zu stacheln, indem man ihm das Fett von der Suppe wegschöpft, so nothwendig dünkt ihm den Arbeiter möglichst auf den Minimallohn zu beschränken, „um ihn arbeitsam zu erhalten“. Auch verheimlicht er keinen Augenblick, dass Aneignung unbezahlter Arbeit das Geheimniss der Plusmacherei ist. „Vermehrte Nachfrage von Seite der Arbeiter meint durchaus nichts als ihre Geneigtheit weniger von ihrem eignen Produkt für sich selbst zu nehmen und einen grössren Theil davon ihren Anwendern zu überlassen; und wenn man sagt, dass diess, durch Verminderung der Konsumtion (auf Seiten der Arbeiter) glut (Marktüberfüllung, Ueberproduktion) erzeugt, so kann ich nur antworten, dass glut synonym mit hohem Profit ist“(FN 40).
Der gelehrte Zank, wie die dem Arbeiter ausgepumpte Beute för-
derlichst für die Accumulation zu vertheilen sei zwischen industriellem Kapitalist und müssigem Grundeigenthümer u. s. w., verstummte vor der Julirevolution. Kurz nachher läutete das städtische Proletariat die Sturmglocke zu Lyon und liess das Landproletariat den rothen Hahn in England fliegen. Diesseits des Kanals grassirte der Owenismus, jenseits St. Simonismus und Fourierismus. Die Stunde der Vulgärökonomie hatte geschlagen. Grade ein Jahr, bevor Nassau W. Senior zu Manchester ausfand, dass der Profit (incl. Zins) des Kapitals das Produkt der unbezahlten „ letzten zwölften Arbeitsstunde“ ist, hatte er der Welt eine andere Entdeckung angekündigt. „Ich“, sagte er feierlich, „ich ersetze das Wort Kapital, als Produktionsinstrument betrachtet, durch das Wort Abstinenz (Enthaltung)“(FN 41). Ein unübertroffenes Muster diess von den „Entdeckungen“ der Vulgärökonomie! Sie ersetzt eine ökonomische Kategorie durch eine sykophantische Phrase. Voilà tout. „Wenn der Wilde“, docirt Senior, „Bogen fabricirt, so übt er eine Industrie aus, aber er prakticirt nicht die Abstinenz.“ Diess erklärt uns, wie und warum in früheren Gesellschaftszuständen „ohne die Abstinenz“ des Kapitalisten Arbeitsmittel fabricirt wurden. „Je mehr die Gesellschaft fortschreitet, um so mehr Abstinenz erfordert sie“(FN 42), nämlich von denen, welche die Industrie ausüben, sich die fremde Industrie und ihr Produkt anzueignen. Alle Bedingungen des Arbeitsprozesses verwandeln sich von nun in ebenso viele Abstinenzpraktiken des Kapitalisten. Dass Korn nicht nur gegessen, sondern auch ausgesät wird, Abstinenz des Kapitalisten! Dass der Wein die Zeit erhält auszu-
gähren, Abstinenz des Kapitalisten!(FN 43) Der Kapitalist beraubt seinen eignen Adam, wenn er die „Produktionsinstrumente dem Arbeiter leiht“ (!), alias sie durch Einverleibung der Arbeitskraft als Kapital verwerthet, statt Dampfmaschinen, Baumwolle, Eisenbahnen, Dünger, Zugpferde u. s. f. aufzuessen oder, wie der Vulgärökonom sich das kindlich vorstellt, „ ihren Werth“ in Luxusund andren Konsumtionsmitteln zu verprassen(FN 44). Wie die Kapitalistenklasse das anstellen soll, ist ein von der Vulgärökonomie bisher hartnäckig bewahrtes Geheimniss. Genug, die Welt lebt nur noch von der Selbstkasteiung dieses modernen Büssers des Wischnu, des Kapitalisten. Nicht nur die Accumulation, die einfache „Erhaltung eines Kapitals erheischt beständige Kraftanstrengung, um der Versuchung zu widerstehn, es aufzuessen“(FN 45). Die einfache Humanität gebeut also offenbar den Kapitalisten von Martyrthum und Versuchung zu erlösen, in derselben Weise wie der georgische Sklavenhalter jüngst durch Abschaffung der Sklaverei von dem schmerzlichen Dilemma erlöst ward, ob das dem Negersklaven ausgepeitschte Mehrprodukt ganz in Champagner zu verjubeln oder auch theilweis in mehr Neger und mehr Land rückzuverwandeln.
In den verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen findet nicht nur einfache Reproduktion, sondern, obgleich auf verschiednem Massstab, Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter statt. Es wird progressiv mehr producirt und mehr konsumirt, also auch mehr Produkt in Produktionsmittel verwandelt. Dieser Prozess erscheint aber
nicht als Accumulation von Kapital und daher auch nicht als Funktion des Kapitalisten, so lange dem Arbeiter seine Produktionsmittel, daher auch sein Produkt und seine Lebensmittel, noch nicht in der Form von Kapital gegenüberstehn(FN 46). Der vor einigen Jahren verstorbene Richard Jones, Nachfolger von Malthus auf dem Lehrstuhl der politischen Oekonomie zu Herford, erörtert diess gut an zwei grossen Thatsachen. Da der zahlreichste Theil des indischen Volks selbstwirthschaftende Bauern, existirt ihr Produkt, ihre Arbeitsund Lebensmittel, auch nie „ in der Form („in the shape“) eines Fonds, der aus fremder Revenue erspart wird („ saved from revenue“) und daher einen vorläufigen Prozess der Accumulation („a previous process of accumulation“) durchlaufen hat“(FN 47). Andrerseits werden die nicht-agrikolen Arbeiter in den Provinzen, wo die englische Herrschaft das alte System am wenigsten aufgelöst hat, direkt von den Grossen beschäftigt, denen eine Portion des ländlichen Mehrprodukts als Tribut oder Grundrente zufliesst. Ein Theil dieses Produkts wird in Naturalform von den Grossen verzehrt, ein andrer Theil für sie von den Arbeitern in Luxusund sonstige Konsumtionsmittel verwandelt, während der Rest den Lohn der Arbeiter bildet, die Eigenthümer ihrer Arbeitsinstrumente sind. Produktion und Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter gehn hier ihren Gang ohne alle Dazwischenkunft jenes wunderlichen Heiligen, jenes Ritters von der traurigen Gestalt, des „entsagenden“ Kapitalisten.
Wir betrachteten bisher die Masse des Mehrwerths als gegebne Grösse. In diesem Fall bestimmte seine proportionelle Theilung in Revenue und Surpluskapital den Umfang der Accumulation. Aber letztere wechselt unabhängig von jener Theilung mit dem Wechsel in der Grösse des Mehrwerths selbst.
Die Umstände, welche die Grösse des Mehrwerths regeln, sind in den Kapiteln über seine Produktion ausführlich entwickelt worden. Sie reguliren, unter sonst gleichbleibenden Verhältnissen, die Bewegung der Accumulation. Wir kehren hier nur so weit zu ihnen zurück, als sie mit Bezug auf die Accumulation neue Gesichtspunkte bieten.
Man erinnert sich, welche Rolle der Exploitationsgrad der Arbeit in der Produktion des Mehrwerths spielt. Die politische Oekonomie würdigt diese Rolle so sehr, dass sie gelegentlich die Beschleunigung der Accumulation durch erhöhte Produktivkraft der Arbeit mit ihrer Beschleunigung durch erhöhte Exploitation des Arbeiters identificirt(FN 48). In den Abschnitten über die Produktion des Mehrwerths ward beständig unterstellt, dass der Arbeitslohn wenigstens gleich dem Werth der Arbeitskraft ist. Es ward ferner gezeigt, dass der Arbeitslohn, sei es seinem Werth nach, sei es nach der Masse von Lebensmitteln, die er repräsentirt, bei wachsendem Exploitationsgrad des Arbeiters wachsen kann. In der praktischen Bewegung des Kapitals jedoch wird auch Mehrwerth producirt durch gewaltsame Herabsetzung des Arbeitslohns unter den Werth der Arbeitskraft. Faktisch wird so ein Theil des nothwendigen Konsumtionsfonds des Arbeiters in einen Accumulationsfonds von Kapital verwandelt.
„Arbeitslöhne“, sagt J. St. Mill, „haben keine Produktivkraft; sie sind der Preis einer Produktivkraft. Arbeitslöhne tragen nicht, neben der Arbeit selbst, zur Waarenproduktion bei, sowenig als der Preis der Maschinerie neben der Maschinerie selbst. Könnte Arbeit ohne Kauf
gehabt werden, so wären Arbeitslöhne überflüssig“(FN 49). Wenn aber die Arbeiter von der Luft leben könnten, so wären sie auch um keinen Preis zu kaufen. Ihr Nichtskosten ist also eine Grenze im mathematischen Sinn, stets unerreichbar, obgleich stets annäherbar. Es ist die beständige Tendenz des Kapitals sie auf diesen nihilistischen Standpunkt herabzudrücken. Ein oft von mir citirter Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, der Verfasser des „ Essay on Trade and Commerce“, verräth nur das innerste Seelengeheimniss des englischen Kapitals, wenn er es für die historische Lebensaufgabe Englands erklärt, den englischen Arbeitslohn auf das französische und holländische Niveau herabzudrücken(FN 50). Er sagt u. a. naiv: „Wenn aber unsre Armen (Kunstausdruck für Arbeiter) luxuriös leben wollen … muss ihre Arbeit natürlich theuer sein. … Man betrachte nur die haarsträubende Masse von Ueberflüssigkeiten („heap of superfluities“), die unsre Manufakturarbeiter verzehren, als da sind Branntwein, Gin, Thee, Zucker, fremde Früchte, starkes Bier, gedruckte Leinwand, Schnupfund Rauchtabak u. s. w.“(FN 51). Er citirt die Schrift eines Fabrikanten von Northamptonshire, der mit himmelwärts schielendem Blick jammert: „ Arbeitist ein ganzes Drittheil wohlfeiler in Frankreich als in England: denn die französischen Armen arbeiten hart und fahren hart an Nahrung und Kleidung und ihr Hauptkonsum sind Brod, Früchte, Kräuter, Wurzeln und getrockneter Fisch; denn sie essen sehr selten Fleisch, und wenn der Weizen theuer ist, sehr wenig Brod“(FN 52). „Wozu,“ fährt der Essay man fort,
„wozu noch kömmt, dass ihr Getränk aus Wasser besteht oder ähnlichen schwachen Likören, so dass sie in der That erstaunlich wenig Geld ausgeben. . . . Ein derartiger Zustand der Dinge ist sicherlich schwer herbeizuführen, aber er ist nicht unerreichbar, wie seine Existenz sowohl in Frankreich als Holland schlagend beweist“(FN 53). Zwei Jahrzehnte später verfolgte ein amerikanischer Humbug, der baronisirte Yankee Benjamin Thomson (alias Graf Rumford), dieselbe Philanthropielinie mit grossem Wohlgefallen vor Gott und den Menschen. Seine „ Essays“ sind ein Kochbuch mit Recepten aller Art um Surrogate an die Stelle der theuren Normalspeisen des Arbeiters zu setzen. Ein besonders gelungenes Recept dieses wunderlichen „Philosophen“ ist folgendes: „Fünf Pfund Gerste, fünf Pfund Mais, für 3 d. Häringe, 1 d. Salz, 1 d. Essig, 2 d. Pfeffer und Kräuter — Summa von 20¾ d. giebt eine Suppe für 64 Menschen, ja mit den Durchschnittspreisen von Korn kann die Kost auf ¼ d. per Kopf (noch nicht 3 Pfennige) herabgedrückt werden“(FN 54). Mit dem Fortschritt der kapitalistischen Produktion hat die Waarenfälschung Thomson’s Ideale überflüssig gemacht(FN 55).
Ende des 18. und während der ersten Decennien des 19. Jahrhunderts erzwangen die englischen Pächter und Landlords das absolute Minimalsalair, indem sie den Ackerbautaglöhnern weniger als das Minimum in der Form des Arbeitslohns, den Rest aber in der Form von Pfarreiunterstützung auszahlten. Ein Beispiel der Possenreisserei, womit die englischen Dogberries in ihrer „legalen“ Festsetzung des Lohntarifs verfuhren: „Als die Squires die Arbeitslöhne für Speenhamland 1795 festsetzten, hatten sie zu Mittag gespeist, dachten aber offenbar, dass die Arbeiter nicht desgleichen nöthig hätten. … Sie entschieden, der Wochenlohn solle 3 sh. per Mann sein, wenn das Laib Brod von 8 Pfund 11 Unzen auf 1 sh. stünde, und er solle regelmässig wachsen, bis das Laib 1 sh. 5 d. koste. Sobald es über diesen Preis stiege, sollte der Lohn proportionell abnehmen, bis der Preis des Laibes 2 sh. erreicht hätte: und dann sollte die Nahrung des Mannes ⅕ weniger als vorher sein“(FN 56). Vor dem Untersuchungscomité des House of Lords, 1814, wird ein gewisser A. Bennett, grosser Pächter, Magistrat, Armenhausverwalter und Lohnregulator, gefragt: „Wird irgend eine Proportion zwischen dem Werth der Tagesarbeit und der Pfarreiunterstützung der Arbeiter beobachtet?“ Antwort: „Ja. Das wöchentliche Einkommen jeder Familie wird über ihren Nominallohn hinaus vollgemacht bis zum Gallonlaib Brod (8 Pfd. 11 Unzen) und 3 d. per Kopf. . . . Wir unterstellen das Gallonlaib hinreichend für die Erhaltung jeder Person in der Familie während der Woche; und die 3 d. sind für Kleider; und wenn es der Pfairei beliebt, die Kleider selbst zu stellen, werden die 3 d. abgezogen. Diese Praxis herrscht nicht nur im ganzen Westen von Wiltshire, sondern, wie ich glaube, im ganzen Land“(FN 57). So, ruft ein Burgeoisschriftsteller jener Zeit, „haben die Pächter Jahre lang eine respektable Klasse ihrer Landsleute degradirt, indem sie dieselben zwangen zum Workhouse ihre Zu-
flucht zu nehmen … Der Pächter hat seine eignen Gewinne vermehrt, indem er selbst die Accumulation des unentbehrlichsten Konsumtionsfonds auf Seite der Arbeiter verhinderte“(FN 58). Welche Rolle heutzutag der direkte Raub am nothwendigen Konsumtionsfonds des Arbeiters in der Bildung des Mehrwerths und daher des Accumulationsfonds des Kapitals spielt, hat beispielweis die s. g. Hausarbeit gezeigt. Weitere Thatsachen im Verlauf dieses Kapitels.
Die Elasticität der Arbeitskraft oder ihre Fähigkeit grösserer intensiver oder extensiver Spannung bildet, innerhalb gewisser Grenzen, eine vom gegebnen Umfang der bereits funktionirenden und producirten Produktionsmittel, oder der stofflichen Elemente des constanten Kapitals, unabhängige Quelle der Schöpfung zusätzlichen Reichthums und daher des Accumulationsfonds. In der extraktiven Industrie, der Minenindustrie z. B., ist der Arbeitsgegenstand von Natur vorhanden. Die nothwendigen Arbeitsmittel selbst also gegeben, — und die extraktive Industrie liefert grossentheils selbst wieder das Rohmaterial dieser Arbeitsinstrumente, Metalle, Holz u. s. w., und die Hilfsmittel, wie Kohle, — ist das Produkt keineswegs durch den Umfang dieser Arbeitsmittel beschränkt. Sie werden durch die grössere Verausgabung der Arbeitskraft nur rascher vernutzt, also nur ihre Reproduktionsperiode abgekürzt. Die Produktenmasse selbst, wie Kohle, Eisen, wächst dagegen, unter sonst gleichbleibenden Umständen, im Verhältniss zu der auf den Naturgegenstand verausgabten Arbeit. Wie am ersten Tag der Produktion gehn hier die ursprünglichen Produktbildner, daher auch die Bildner der stofflichen Elemente des Kapitals, Mensch und Natur, zusammen. In der eigentlichen Agrikultur spielen zwar Samen und Dünger dieselbe Rolle, wie das Rohmaterial in der Manufaktur, und man kann nicht mehr Land besäen, ohne vorher mehr Samen zu haben. Aber diess Rohmaterial und die Arbeitsinstrumente gegeben, ist bekannt, welche wunderthätige Wirkung selbst die rein mechanische Bearbeitung
des Bodens, deren Intensivität von der Spannung der Arbeitskraft abhängt, auf die Massenhaftigkeit des Produkts ausübt. Es ist wieder direkte Wirkung des Menschen auf den Naturgegenstand, welche zur unmittelbaren Quelle des Reichthums wird. Extraktive Industrie und Agrikultur liefern andrerseits der Manufaktur das Rohmaterial und die Hilfsstoffe, also die stofflichen Elemente, welche hier jeder grösseren Arbeitsausgabe vorausgesetzt sind, während die eigentlichen Arbeitsmittel auch in dieser Sphäre durch extensivere oder intensivere Spannung der Arbeitskraft nur ihre Reproduktionsperiode verkürzen. Indem das Kapital sich also die beiden Urbildner des Reichthums, Arbeitskraft und Erde, einverleibt, erwirbt es in ihnen von seinem eignen stofflichen Umfang unabhängige und dehnbare Faktoren der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter und daher der Accumulation.
Abgesehn vom Exploitationsgrad der Arbeit wird die Produktion des Mehrwerths, also die Accumulation des Kapitals, deren Bildungselement der Mehrwerth, wesentlich bestimmt durch die Produktivkraft der Arbeit.
Mit der Produktivkraft der Arbeit wächst die Produktenmasse, worin sich ein bestimmter Werth, also auch Mehrwerth von gegebner Grösse darstellt. Bei gleichbleibender und selbst bei fallender Rate des Mehrwerths, sofern sie nur langsamer fällt als die Produktivkraft der Arbeit steigt, wächst die Masse des Mehrprodukts. Bei gleichbleibender Theilung desselben in Revenue und Surpluskapital kann daher die Konsumtion des Kapitalisten wachsen ohne Abnahme des Accumulationsfonds. Die proportionelle Grösse des Accumulationsfonds kann selbst auf Kosten des Konsumtionsfonds wachsen, während die Verwohlfeilerung der Waaren dem Kapitalisten eben so viele oder mehr Genussmittel als vorher zur Verfügung stellt. Aber mit der wachsenden Produktivität der Arbeit geht, wie man gesehn, die Verwohlfeilerung des Arbeiters, also wachsende Rate des Mehrwerths, Hand in Hand, selbst wenn der reelle Arbeitslohn steigt. Er steigt nie verhältnissmässig mit der Produktivität der Arbeit. Derselbe variable Kapitalwerth setzt also mehr Arbeitskraft und daher mehr Arbeit in Bewegung. Derselbe constante Kapitalwerth stellt sich in mehr Produktionsmitteln, d. h. mehr Arbeitsmitteln, Arbeitsmaterial und Hilfsstoffen dar, liefert also sowohl mehr Produktbildner als Werthbildner, oder Arbeitseinsauger. Bei gleichbleibendem und selbst abnehmendem
Werth des Surpluskapitals findet daher beschleunigte Accumulation statt. Nicht nur erweitert sich die Stufenleiter der Reproduktion stofflich, sondern die Produktion des Mehrwerths wächst schneller als der Werth des Surpluskapitals.
Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit reagirt auch auf das Originalkapital oder das bereits im Produktionsprozess befindliche Kapital. Ein Theil des funktionirenden constanten Kapitals besteht aus Arbeitsmitteln, wie Maschinerie u. s. w., die nur in längeren Perioden konsumirt und daher reproducirt oder durch neue Exemplare derselben Art ersetzt werden. Aber ein Theil dieser Arbeitsmittel stirbt jedes Jahr ab, oder erreicht das Endziel seiner produktiven Funktion. Er befindet sich daher jedes Jahr im Stadium seiner periodischen Reproduktion oder seines Ersatzes durch neue Exemplare derselben Art. Hat die Produktivkraft der Arbeit sich in der Geburtsstätte dieser Arbeitsmittel erweitert, und sie entwickelt sich fortwährend mit dem ununterbrochenen Fluss der Wissenschaft und der Technologie, so tritt wirkungsvollere und, ihren Leistungsumfang betrachtet, wohlfeilere Maschine, Werkzeug, Apparat u. s. w. an die Stelle der alten. Das alte Kapital wird in einer produktiveren Form reproducirt, abgesehn von der fortwährenden Detailveränderung an den vorhandnen Arbeitsmitteln. Der andere Theil des constanten Kapitals, Rohmaterial und Hilfsstoffe, wird fortwährend innerhalb des Jahrs, der der Agrikultur entstammende meist jährlich reproducirt. Jede Einführung bessrer Methoden u. s. w. wirkt hier also fast gleichzeitig auf Zuschusskapital und bereits in Funktion begriffenes Kapital. Jeder Fortschritt der Chemie vermannigfacht nicht nur die Nutzanwendungen desselben Materials und dehnt daher mit dem Wachsthum des Kapitals seine Anlagesphären aus. Er lehrt zugleich die Excremente des Produktionsund Konsumtionsprozesses in den Kreislauf des Reproduktionsprozesses zurückschleudern, schafft also ohne vorherige Kapitalauslage neuen Kapitalstoff. Gleich vermehrter Ausbeutung des Naturreichthums durch bloss höhere Spannung der Arbeitskraft, bildet die Wissenschaft eine von der gegebnen Grösse des funktionirenden Kapitals unabhängige Potenz seiner Expansion. Sie reagirt zugleich auf den in sein Erneurungsstadium eingetretenen Theil des Originalkapitals. In seine neue Form einverleibt es gratis den hinter dem Rücken seiner alten Form vollzogenen gesellschaftlichen Fortschritt. Allerdings ist diese
Entwicklung der Produktivkraft zugleich begleitet von theilweiser Depreciation funktionirender Kapitale. Soweit diese Depreciation sich durch die Konkurrenz akut fühlbar macht, fällt die Hauptwucht auf den Arbeiter, in dessen gesteigerter Exploitation der Kapitalist Schadenersatz sucht.
Es zeigte sich bei Analyse des relativen Mehrwerths, wie die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit eine stets wachsende Masse des von derselben Arbeitskraft in Bewegung gesetzten constanten Kapitals bedingt. Mit dem Reichthum oder der Fülle und Wirksamkeit der in Maschinerie u. s. w. vergegenständlichten Arbeit, wovon der Arbeiter als bereits producirter Bedingung des Produktionsprozesses ausgeht, wächst die Masse des alten Kapitalwerths, der durch blossen Zusatz neuer Arbeit, also neue Werthproduktion, erhalten und in diesem Sinn reproducirt wird. Man vergleiche z. B. einen englischen Spinner mit einem indischen. Man unterstelle der Vereinfachung halber gleiche Extension und Intensivität des englischen und indischen Arbeitstags. Der englische Spinner verwandelt in einem Tag viel hundertmal grössere Massen von Baumwolle, Spinninstrumenten u. s. w. in Garn. Er erhält also auch vielhundertmal grösseren Kapitalwerth in seinem Produkt. Wäre selbst das Werthprodukt seiner Tagesarbeit, d. h. der durch dieselbe den Produktionsmitteln neu zugesetzte Werth, nur gleich dem des Indiers, dennoch resultirt seine Tagesarbeit nicht nur in grösserem Produktenquantum, sondern in unendlich grösserem Produktenwerth, altem Werth, den er auf das neue Produkt überträgt, und der von neuem als Kapital funktioniren kann. „1782“, belehrt uns F. Engels, „lag die ganze Wollerndte der vorhergehenden drei Jahre (in England) aus Mangel an Arbeitern noch unverarbeitet da, und hätte liegen bleiben müssen, wenn nicht die neu erfundne Maschinerie zu Hilfe gekommen wäre und sie versponnen hätte“(FN 59). Die in der Form von Maschinerie vergegenständlichte Arbeit stampfte natürlich unmittelbar keinen Menschen aus dem Boden, aber sie erlaubte einer geringen Arbeiteranzahl durch Zusatz von relativ wenig lebendiger Arbeit nicht nur die Wolle produktiv zu konsumiren, und ihr Neuwerth zuzusetzen, sondern in der Form von Garn u. s. w. ihren alten Werth zu erhalten. Sie lieferte damit zugleich Mittel und Sporn
zur erweiterten Reproduktion von Wolle. Es ist die Naturgabe der lebendigen Arbeit alten Werth zu erhalten, während sie Neuwerth schafft. Mit dem Wachsthum von Wirksamkeit, Umfang und Werth ihrer Produktionsmittel, also mit der die Entwicklung ihrer Produktivkraft begleitenden Accumulation erhält und verewigt die Arbeit daher in stets neuer Form einen stets schwellenden Kapitalwerth(FN 60). Diese Naturkraft der
Arbeit erscheint als Selbsterhaltungskraft des Kapitals, dem sie einverleibt ist, ganz wie ihre gesellschaftlichen Produktivkräfte als seine Eigenschaften und wie die beständige Aneignung der Mehrarbeit durch den Kapitalisten als beständige Selbstverwerthung des Kapitals. Alle Kräfte der Arbeit projektiren sich als Kräfte des Kapitals, wie alle Werthformen der Waare als Formen des Geldes.
Unter sonst gleichbleibenden Umständen ist die Grösse des producirten Mehrwerths und daher die Accumulation endlich bestimmt durch die Grösse des vorgeschossenen Kapitals. Mit dem Gesammtkapital wächst auch sein variabler Bestandtheil, wenn auch nicht in demselben Verhältniss. Auf je grösserer Stufenleiter der individuelle Kapitalist producirt, desto grösser die Arbeiteranzahl, die er gleichzeitig exploitirt, oder die Masse der unbezahlten Arbeit, die er aneignet(FN 61). Je mehr
also das individuelle Kapital wächst, desto grösser der Fonds, der sich in Konsumtionsfonds und Accumulationsfonds spaltet. Der Kapitalist kann daher flotter leben und zugleich mehr „entsagen“.
Mit dem Wachsthum des Kapitals wächst die Differenz zwischen angewandtem und konsumirtem Kapital. In andern Worten: Es wächst die Werthund Stoffmasse der Arbeitsmittel, wie Baulichkeiten, Maschinerie, Drainirungsröhren, Arbeitsvieh, Apparate jeder Art, die stets ihrem ganzen Umfang nach, während längerer oder kürzerer Periode, in beständig wiederholten Produktionsprozessen, funktioniren, oder zur Erzielung bestimmter Nutzeffekte dienen, während sie nur allmälig verschleissen, daher ihren Werth nur stückweis verlieren, also auch nur stückweis auf das Produkt übertragen. Im Verhältniss, worin diese Arbeitsmittel als Produktbildner dienen, ohne dem Produkt Werth zuzusetzen, also ganz angewandt, aber nur theilweis konsumirt werden, leisten sie, wie früher erwähnt, denselben Gratisdienst wie Naturkräfte, Wasser, Dampf, Luft, Elektricität u. s. w. Dieser Gratisdienst der vergangnen Arbeit, wenn ergriffen und beseelt von der lebendigen Arbeit, accumulirt mit der wachsenden Stufenleiter der Accumulation.
Da die vergangne Arbeit sich stets in Kapital verkleidet, d. h. das Passivum der Arbeit von A, B, C u. s. w. im Aktivum des Nichtarbeiters X figurirt, sind Bürger und politische Oekonomen voll des Lobes für die Verdienste der vergangnen Arbeit, welche nach dem schottischen Genie Mac Culloch sogar einen eignen Sold beziehn muss(FN 62). Das stets wachsende Gewicht der unter der Form von Produktionsmitteln im lebendigen Arbeitsprozess mitwirkenden vergangnen Arbeit wird also ihrer dem Arbeiter selbst, dessen vergangne und unbezahlte Arbeit sie ist, entfremdeten Gestalt, ihrer Kapitalgestalt vindicirt. Die praktischen Agenten der kapitalistischen Produktion und ihre ideologischen Zungendrescher sind ebenso unfähig das Produktionsmittel von seiner antagonistischen gesellschaftlichen Charaktermaske, die ihm heutzutag an-
klebt, getrennt zu denken, als ein Sklavenhalter den Arbeiter selbst von seinem Charakter als Sklave.
Man hat im Verlauf dieses Abschnitts gesehn, dass das Kapital keine fixe Grösse ist, sondern ein elastischer und mit der Theilung des Mehrwerths in Revenue und Surpluskapital beständig fluktuirender Theil des gesellschaftlichen Reichthums. Man hat ferner gesehn, dass selbst die Grösse des funktionirenden Kapitals gegeben, die ihm einverleibte Arbeitskraft, Wissenschaft und Erde (worunter ökonomisch alle ohne Zuthat des Menschen von Natur vorhandnen Arbeitsgegenstände zu verstehn sind) elastische Potenzen desselben bilden, die ihm innerhalb gewisser Grenzen einen von seiner eignen Grösse unabhängigen Spielraum gestatten. Es wurde dabei von allen Verhältnissen des Cirkulationsprozesses abgesehn, die sehr verschiedne Wirkungsgrade derselben Kapitalmasse verursachen. Es wurde, da wir die Schranken der kapitalistischen Produktion voraussetzen, also eine rein naturwüchsige Gestalt des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, abgesehn von jeder mit den vorhandnen Produktionsmitteln und Arbeitskräften unmittelbar und planmässig bewirkbaren rationelleren Kombination. Die klassische Oekonomie liebte es von jeher das gesellschaftliche Kapital als eine fixe Grösse von fixem Wirkungsgrad aufzufassen. Aber das Vorurtheil ward erst zum Dogma befestigt durch den Urphilister Jeremias Bentham, diess nüchtern pedantische, schwatzlederne Orakel des gemeinen Bürgerverstandes des 19. Jahrhunderts(FN 63). Bentham ist unter den Philosophen, was Martin Tupper unter den Dichtern. Beide waren nur in England fabricirbar(FN 64).
Mit seinem Dogma werden die gewöhnlichsten Erscheinungen des Produktionsprozesses, wie z. B. dessen plötzliche Expansionen und Kontraktionen, ja die Accumulation, völlig unbegreifbar(FN 65). Das Dogma wurde sowohl von Bentham selbst als von Malthus, James Mill, MacCulloch u. s. w. zu apologetischen Zwecken vernutzt, namentlich um einen Theil des Kapitals, das variable oder in Arbeitskraft umsetzbare Kapital als eine fixe Grösse darzustellen. Die stoffliche Existenz des variablen Kapitals, d. h. die Masse der Lebensmittel, die es für den Arbeiter repräsentirt, oder der s. g. Arbeitsfonds, wurde in einen durch Naturketten abgeringten und unüberschreitbaren Sondertheil des gesellschaftlichen Reichthums verfabelt. Um den Theil des gesellschaftlichen Reichthums, der als constantes Kapital oder, stofflich ausgedrückt, als Produktionsmittel funktioniren soll, in Bewegung zu setzen, ist eine bestimmte Masse lebendiger Arbeit erheischt. Diese ist
technologisch gegeben. Aber weder ist die Anzahl der Arbeiter gegeben, erheischt um diese Arbeitsmasse flüssig zu machen, denn das wechselt mit dem Exploitationsgrad der individuellen Arbeitskraft, noch der Preis dieser Arbeitskraft, sondern nur seine zudem sehr elastische Minimalschranke. Die Thatsachen, die dem Dogma zu Grund liegen, sind die. Einerseits hat der Arbeiter nicht mitzusprechen bei der Theilung des gesellschaftlichen Reichthums in Genussmittel der Nichtarbeiter und in Produktionsmittel. Andrerseits kann er nur in günstigen Ausnahmsfällen den s. g. „ Arbeitsfonds“ auf Kosten der „ Revenue“ des Reichen erweitern(FN 66). Zu welch abgeschmackter Tautologie es führt, die kapitalistische Schranke des Arbeitsfonds in seine gesellschaftliche Naturschranke umzudichten, zeige u. a. Professor Fawcett: „Das cirkulirende Kapital(FN 67) eines Landes,“ sagt er, „ist sein Arbeitsfonds. Um daher den durchschnittlichen Geldlohn, den jeder Arbeiter erhält, zu berechnen, haben wir nur einfach diess Kapital durch die Anzahl der Arbeiterbevölkerung zu dividiren“(FN 68). D. h. also, erst rechnen wir die wirklich gezahlten individuellen Arbeitslöhne in eine Summe zusammen, dann behaupten wir, dass diese Addition die Werthsumme des von Gott und Natur oktroyirten „Arbeitsfonds“ bildet. End-
lich dividiren wir die so erhaltne Summe durch die Kopfzahl der Arbeiter, um hinwiederum zu entdecken, wie viel jedem Arbeiter individuell im Durchschnitt zufallen kann. Eine ungemein pfiffige Procedur diess. Sie verhindert Herrn Fawcett nicht im selben Athemzug zu sagen: „Der in England jährlich accumulirte Gesammtreichthum wird in zwei Theile getheilt. Ein Theil wird in England zur Erhaltung unsrer eignen Industrie verwandt. Ein andrer Theil wird in andere Länder exportirt … Der in unsrer Industrie angewandte Theil bildet keine bedeutende Portion des jährlich in diesem Land accumulirten Reichthums“(FN 69). Der grössere Theil des jährlich zuwachsenden Mehrprodukts, dem englischen Arbeiter ohne Aequivalent entwandt, wird also nicht in England, sondern in fremden Ländern verkapitalisirt. Aber mit dem so exportirten Surpluskapital wird ja auch ein Theil des von Gott und Bentham erfundnen „Arbeitsfonds“ exportirt(FN 70).
Wachsthum des Kapitals schliesst Wachsthum seines variablen oder in Arbeitskraft umgesetzten Bestandtheils ein. Ein Theil des in Surpluskapital verwandelten Mehrwerths muss stets rückverwandelt werden in variables Kapital oder zuschüssigen Arbeitsfonds. Unterstellen wir, dass, nebst sonst gleichbleibenden Umständen, die technologische Zusammensetzung des Kapitals unverändert bleibt, d. h. eine bestimmte Masse von Produktionsmitteln oder constantem Kapital stets von gleich viel lebendiger Arbeit in Bewegung gesetzt wird, so wächst die Nachfrage nach Arbeit und der Subsistenzfonds der Arbeiter verhältnissmässig mit dem Kapital und um so rascher, je rascher das Kapital wächst. Da der Mehrwerth ein jährliches Produkt des Kapitals ist, da er dem Originalkapital jährlich ein Increment zusetzt, da diess Increment selbst jährlich wächst mit dem jährlich zuneh-
menden Umfang des bereits in Funktion begriffenen Kapitals, und da endlich, unter besonderem Sporn des Bereicherungstriebs, wie z. B. Oeffnung neuer Märkte, neuer Sphären der Kapitalanlage in Folge neu entwickelter gesellschaftlicher Bedürfnisse u. s. w., die Stufenleiter der Accumulation plötzlich ausdehnbar ist durch bloss veränderte Theilung des Mehrwerths oder Mehrprodukts in Kapital und Revenue, so treten hier Knotenpunkte ein, wo das Wachsthum der Arbeitskraft oder der Arbeiteranzahl überflügelt wird von den Accumulationsbedürfnissen des Kapitals, und daher der Preis der Arbeit steigt. Klage hierüber ertönt in England während der ganzen ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. Die mehr oder minder günstigen Umstände, worunter sich die Lohnarbeiter reproduciren und vermehren, ändern jedoch nichts an dem Verhältniss selbst. Wie die einfache Reproduktion fortwährend das Kapitalverhältniss selbst reproducirt, Kapitalisten auf der einen Seite, Lohnarbeiter auf der andern, so reproducirt die Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter oder die Accumulation das Kapitalverhältniss auf erweiterter Stufenleiter, mehr Kapitalisten oder grössere Kapitalisten auf diesem Pol, mehr Lohnarbeiter auf jenem. Man sah früher bereits: Die Reproduktion der Arbeitskraft, die sich dem Kapital unaufhörlich als Verwerthungsmittel einverleiben muss, nicht von ihm loskommen kann, und deren Hörigkeit zum Kapital nur versteckt wird durch den Wechsel der individuellen Kapitalisten, woran sie sich verkauft, bildet in der That ein Moment der Reproduktion des Kapitals selbst. Accumulation des Kapitals ist also Vermehrung des Proletariats(FN 71).
Die klassische Oekonomie begriff diesen Satz so wohl, dass A. Smith, Ricardo u. s. w., wie früher erwähnt, die Accumulation sogar fälschlich identificiren mit Konsum des ganzen kapitalisirten Theils des Mehrprodukts durch produktive Arbeiter, oder mit seiner Verwandlung in zuschüssige Lohnarbeiter. Schon 1696 sagt John Bellers: „Wenn Jemand 100,000 Acres hätte und eben so viele Pfunde Geld und eben so viel Vieh, was wäre der reiche Mann ohne den Arbeiter ausser selbst ein Arbeiter? Und wie die Arbeiter Leute reich machen, so desto mehr Arbeiter, desto mehr Reiche … Die Arbeit des Armen ist die Mine des Reichen“(FN 72). So Bertrand de Mandeville im Anfang des 18. Jahrhunderts: „Wo das Eigenthum hinreichend geschützt ist, wäre es leichter ohne Geld zu leben als ohne Arme, denn wer würde die Arbeit thun? … Wie die Arbeiter vor Aushungerung zu bewahren sind, so sollten sie nichts erhalten, was der Ersparung werth ist. Wenn hier und da Einer aus der untersten Klasse durch ungewöhnlichen Fleiss und Bauchkneipen sich über die Lage erhebt, worin er aufgebracht war, so muss ihn keiner daran hindern: ja es ist unläugbar der weiseste Plan für jede Privatperson, für jede Privatfamilie in der Gesellschaft frugal zu sein, aber es ist das Interesse aller reichen Nationen, dass der grösste Theil der Armen nie unthätig sei und sie dennoch stets verausgaben, was sie einnehmen … Diejenigen, die ihr Leben durch ihre tägliche Arbeit gewinnen, haben nichts, was sie anstachelt dienstlich zu sein ausser ihren Bedürfnissen, welche es Klugheit ist zu lindern, aber Narrheit wäre zu kuriren. Das einzige Ding, das den arbeitenden Mann fleissig machen kann, ist ein mässiger Arbeitslohn. Ein zu geringer macht ihn je nach seinem Temperament kleinmüthig oder verzweifelt, ein zu grosser insolent und faul … Aus dem bisher Entwickelten folgt, dass in einer freien Nation, wo Sklaven nicht erlaubt sind, der sicherste Reichthum aus einer Menge arbeitsamer Armen besteht. Aus-
serdem dass sie die nie versagende Zufuhrquelle für Flotte und Armee, gäbe es ohne sie keinen Genuss und wäre das Produkt keines Landes verwerthbar. Um die Gesellschaft (die natürlich aus den Nichtarbeitern besteht) glücklich und das Volk selbst in kümmerlichen Zuständen zufrieden zu machen, ist es nöthig, dass die grosse Majorität sowohl unwissend als arm bleibt. Kenntniss erweitert und vervielfacht unsere Wünsche, und je weniger ein Mann wünscht, desto leichter können seine Nothwendigkeiten befriedigt werden“(FN 73). Was Mandeville, ein ehrlicher Mann und heller Kopf, noch nicht begreift, ist, dass der Mechanismus des Accumulationsprozesses selbst mit dem Kapital die Masse der „ arbeitsamen Armen“ vermehrt, d. h. der Lohnarbeiter, die ihre Arbeitskraft in wachsende Verwerthungskraft des wachsenden Kapitals verwandeln und eben dadurch ihr Abhängigkeitsverhältniss von ihrem eignen, im Kapitalisten personificirten Produkt verewigen müssen. Mit Bezug auf diess Abhängigkeitsverhältniss bemerkt Sir F. M. Eden in seiner „Lage der Armen, oder Geschichte der arbeitenden Klasse Englands“: „Unsere Zone erfordert Arbeit zur Befriedigung der Bedärfnisse, und desshalb muss wenigstens ein Theil der Gesellschaft unermüdet arbeiten … Einige, die nicht arbeiten, haben dennoch die Produkte des Fleisses zu ihrer Verfügung. Das verdanken diese Eigenthümer aber nur der Civilisation und Ordnung, sie sind reine Kreatur der Civilinstitutionen(FN 74). Denn diese haben es anerkannt, dass man die Früchte der Arbeit auch anders als durch Arbeit sich aneignen kann. Die Leute von
unabhängigem Vermögen verdanken ihr Vermögen fast ganz der Arbeit Andrer, nicht ihrer eignen Fähigkeit, die durchaus nicht besser ist als die der Andern; es ist nicht der Besitz von Land und Geld, sondern das Kommando über Arbeit („the command of labour“), das die Reichen von den Armen unterscheidet … Was dem Armen zusagt, ist nicht eine verworfene oder servile Lage, sondern ein bequemes und liberales Abhängigkeitsverhältniss („a state of easy and liberal dependance“), und für die Leute von Eigenthum hinreichender Einfluss und Autorität über die, die für sie arbeiten … Ein solches Abhängigkeitsverhältniss ist, wie jeder Kenner der menschlichen Natur weiss, nothwendig für den Komfort der Arbeiter selbst“(FN 75). Sir F. M. Eden, beiläufig bemerkt, ist der einzige Schüler Adam Smith’s, der während des achtzehnten Jahrhunderts etwas Bedeutendes geleistet hat(FN 76).
Unter den bisher unterstellten, den Arbeitern günstigsten Accumulationsbedingungen kleidet sich ihr Abhängigkeitsverhältniss vom
Kapital in erträgliche oder, wie Eden sagt, „bequeme und liberale Formen“. Statt intensiver zu werden mit dem Wachsthum des Kapitals, wird es nur extensiver, d. h. die Exploitationsund Herrschaftssphäre des Kapitals dehnt sich nur aus mit seiner eignen Dimension und der Anzahl seiner Lohnarbeiter. Von ihrem eignen anschwellenden und schwellend in Surpluskapital verwandelten Mehrprodukt strömt ihnen ein reichlicherer Theil in der Form von Zahlungsmitteln zurück, so dass sie den Kreis ihrer Genüsse erweitern, ihren Konsumtionsfonds von Kleidern, Möbeln u. s. w. besser ausstatten und kleine Reservefonds von Geld bilden können. So wenig aber bessere Kleidung, Nahrung, Behandlung und ein grösseres Peculium das Abhängigkeitsverhältniss und die Exploitation des Sklaven aufheben, so wenig die des Lohnarbeiters. Steigender Preis der Arbeit in Folge der Accumulation des Kapitals besagt in der That nur, dass der Umfang und die Wucht der goldnen Kette, die der Lohnarbeiter sich selbst bereits geschmiedet hat, ihre losere Spannung erlauben. In den Kontroversen über diesen Gegenstand hat man meist die Hauptsache übersehn, nämlich die differentia
specifica der kapitalistischen Produktion. Arbeitskraft wird hier gekauft, nicht um durch ihren Dienst oder ihr Produkt die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zu befriedigen. Sein Zweck ist Verwerthung seines Kapitals, Produktion von Waaren, die mehr Arbeit enthalten als er zahlt, also einen Werththeil enthalten, der ihm nichts kostet und dennoch durch den Waarenverkauf realisirt wird. Produktion von Mehrwerth oder Plusmacherei ist das absolute Gesetz dieser Produktionsweise. Nur soweit sie die Produktionsmittel als Kapital erhält, ihren eignen Werth als Kapital reproducirt und in unbezahlter Arbeit eine Quelle von Surpluskapital liefert, ist die Arbeitskraft verkaufbar. Die Bedingungen ihres Verkaufs, ob mehr oder minder günstig für den Arbeiter, schliessen also die Nothwendigkeit ihres steten Wiederverkaufs und die stets erweiterte Reproduktion des Reichthums als Kapital ein. Der Arbeitslohn, wie man gesehn, bedingt seiner Natur nach, stets Lieferung eines bestimmten Quantums unbezahlter Arbeit auf Seiten des Arbeiters. Ganz abgesehn vom Steigen des Arbeitslohns mit sinkendem Preis der Arbeit u. s. w., besagt seine Zunahme im besten Fall nur quantitative Abnahme der unbezahlten Arbeit, die der Arbeiter leisten muss. Diese Abnahme kann nie bis zu einem Punkt fortgehn, wo sie den kapitalistischen Charakter des Produktionsprozesses ernsthaft gefährden würde und die Reproduktion seiner eignen Bedingungen, auf der einen Seite der Produktionsund Lebensmittel als Kapital, auf der andern der Arbeitskraft als Waare, auf dem einen Pol des Kapitalisten, auf dem andern des Lohnarbeiters. Abgesehn von gewaltsamen Konflikten über die Rate des Arbeitslohns, und Adam Smith hat bereits gezeigt, dass im Grossen und Ganzen in solchem Konflikt der Meister stets Meister bleibt, unterstellt ein aus Accumulation des Kapitals entspringendes Steigen des Arbeitspreises folgende Alternative. Entweder der steigende oder gestiegne Preis der Arbeit ist begleitet von gleich grossem oder grösserem absoluten Wachsthum der Accumulation. Man weiss, dass selbst unter sonst gleichbleibenden Umständen, wie Produktivgrad der Arbeit u. s. w., mit der wachsenden Grösse des vorgeschossenen Kapitals sein absoluter Zuwachs gleichförmig bleiben oder selbst beschleunigt werden kann, obgleich die Rate der Accumulation abnimmt, wie man Kapitel III, Abschnitt 5 sah, dass die Masse des Mehrwerths trotz dessen abnehmender Rate mit Vermehrung der gleichzeitig exploitirten Arbeiterzahl gleichbleiben und
selbst wachsen kann. In diesem Fall ist es blosse Tautologie zu sagen, dass der verminderte Exploitationsgrad der Arbeitskraft die Ausdehnung der Kapitalherrschaft nicht beeinträchtigt. Oder, das ist die andre Seite der Alternative, die Accumulation erschlafft in Folge des steigenden Arbeitspreises, weil der Stachel grossen Gewinns abstumpft. Die Accumulation nimmt ab. Aber mit ihrer Abnahme verschwindet die Ursache ihrer Abnahme, nämlich die Disproportion zwischen Kapital und exploitabler Arbeitskraft. Der Arbeitspreis sinkt also wieder zu einem den Verwerthungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Niveau. Es folgt daher keineswegs, dass der Arbeitslohn auf sein Minimalniveau fällt, oder auch nur auf das Niveau, worauf er vor der Preiserhöhung der Arbeit stand. Der Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses beseitigt selbst die Hindernisse, die er vorübergehend schafft. Man sieht: Im ersten Fall ist es keine Abnahme im absoluten oder proportionellen Wachsthum der Arbeitskraft oder Arbeitsbevölkerung, welche das Kapital überschüssig, sondern umgekehrt die Zunahme des Kapitals, welche die exploitable Arbeitskraft unzureichend macht. Im zweiten Fall ist es keine Zunahme im absoluten oder proportionellen Wachsthum der Arbeitskraft oder der Arbeiterbevölkerung, welche das Kapital unzureichend, sondern umgekehrt die Abnahme des Kapitals, welche die exploitable Arbeitskraft, oder vielmehr ihren Preis, überschüssig macht. Es sind diese absoluten Bewegungen in der Accumulation des Kapitals, welche sich als relative Bewegungen in der Masse der exploitablen Arbeitskraft wiederspiegeln und daher der eignen Bewegung der letztern geschuldet scheinen. So drückt sich in der Krisenphase des industriellen Cyklus der allgemeine Fall der Waarenpreise als Steigen des relativen Geldwerths, und in der Prosperitätsphase das allgemeine Steigen der Waarenpreise als Fall des relativen Geldwerths aus. Die s. g. Currency-Schule schliesst daher, dass das einemal zu wenig, das andremal zu viel Geld cirkulirt. Ihre Ignoranz und völlige Verkennung der Thatsachen(FN 77) finden würdige Parallele in den Oekonomen, welche jene Phänomene der Accumulation dahin deuten, dass das einemal zu wenig und das andremal zu viel Lohn-
arbeiter existiren. Das so in ein Naturgesetz mystificirte Gesetz der kapitalistischen Accumulation drückt in der That nur aus, dass ihre Natur jede solche Abnahme im Exploitationsgrad der Arbeit oder jede solche Steigerung des Arbeitspreises ausschliesst, welche die stetige Reproduktion des Kapitalverhältnisses und seine Reproduktion auf stets erweiterter Stufenleiter ernsthaft gefährden könnte. Es kann nicht anders sein in einer Produktionsweise, worin der Arbeiter für die Verwerthungsbedürfnisse vorhandner Werthe, statt umgekehrt der gegenständliche Reichthum für die Entwicklungsbedürfnisse des Arbeiters da ist. Wie der Mensch in der Religion vom Machwerk seines eignen Kopfes, so wird er in der kapitalistischen Produktion vom Machwerk seiner eignen Hand beherrscht.
Das bisher Entwickelte gilt unter der Voraussetzung, dass im Fortgang der Accumulation das Verhältniss zwischen der Masse der Produktionsmittel und der Masse der sie bewegenden Arbeitskraft gleichbleibt, also die Nachfrage nach Arbeit mit dem Wachsthum des Kapitals verhältnissmässig wächst. Diese Voraussetzung figurirt in Adam Smith’s Analyse der Accumulation als selbstverständliches Axiom. In gewissem Grad bleibt sie immer richtig, denn wie auch die technologischen Bedingungen des Produktionsprozesses umgewälzt werden mögen, während kürzerer oder längerer Zeitfrist findet bald in dieser, bald in jener Produktionssphäre Accumulation des Kapitals oder Erweiterung der Produktionsleiter auf der einmal gegebnen technologischen Basis statt. Innerhalb dieser Schranken wächst also die Nachfrage nach Arbeit mit der Accumulation. Aber die vorhandne Basis wird selbst fortwährend umgewälzt. Im Fortgang der Accumulation geht eine grosse Revolution vor im Verhältniss von Masse der Produktionsmittel und Masse der sie bewegenden Arbeitskraft. Diese Revolution spiegelt sich wieder in der wechselnden Zusammensetzung des Kapitalwerths aus constantem und variablem Bestandtheil, oder im wechselnden Verhältniss seiner in Produktionsmittel und Arbeitskraft umgesetzten Werththeile. Ich nenne diese Zusammensetzung die organische Zusammensetzung des Kapitals.
Abgesehn vom Produktivgrad der Arbeit, soweit er ausschliesslich durch den Naturreichthum, wie Fruchtbarkeit des Bodens u. s. w., bedingt
ist, oder durch das Geschick unabhängiger und isolirt arbeitender Producenten, das sich jedoch mehr qualitativ in der Güte des Machwerks als quantitativ in seiner Masse bewährt, drückt sich der gesellschaftliche Produktivgrad der Arbeit aus im relativen Grössenumfang der Produktionsmittel, welche ein Arbeiter, während gegebner Zeit, mit derselben Anspannung von Arbeitskraft, in Produkt verwandelt. Die Masse der Produktionsmittel, womit er funktionirt, wächst mit der Produktivität seiner Arbeit. Diese Produktionsmittel spielen dabei eine doppelte Rolle. Das Wachsthum der einen ist Folge, das der andern Bedingung der wachsenden Produktivität der Arbeit. Z. B. mit der manufakturmässigen Theilung der Arbeit und der Anwendung von Maschinerie wird in derselben Zeit mehr Rohmaterial verarbeitet, tritt also grössere Masse von Rohmaterial und Hilfsstoffen in den Arbeitsprozess ein. Das ist Folge der wachsenden Produktivität der Arbeit. Andrerseits ist die Masse der angewandten Maschinerie, Arbeitsviehs, mineralischen Düngers, Drainirungsröhren u. s. w. Bedingung der wachsenden Produktivität der Arbeit. Ebenso die Masse der in Baulichkeiten, Riesenöfen, Transportmitteln u. s. w. koncentrirten Produktionsmittel, welche trotz erweitertem Umfang in Folge ihres gemeinsamen Verbrauchs weniger Werth an jeden aliquoten Theil des Gesammtprodukts abgeben oder ökonomischere Verwendung erláuben als die in Diminutivformat zersplitterten Arbeitsmittel derselben Art. Ob aber Bedingung oder Folge, der wachsende Grössenumfang der Produktionsmittel im Vergleich zu der ihnen einverleibten Arbeitskraft drückt die wachsende Produktivität der Arbeit aus. Die Zunahme der letzteren erscheint also in der Abnahme der Arbeitsmasse verhältnissmässig zu der von ihr bewegten Masse von Produktionsmitteln, oder in der Grössenabnahme des subjektiven Faktors des Arbeitsprozesses verglichen mit seinen objektiven Faktoren.
Das Wachsthum in der Masse der Produktionsmittel, verglichen mit der Masse der sie belebenden Arbeitskraft, spiegelt sich wieder in der Zunahme des constanten Bestandtheils des Kapital werths auf Kosten seines variablen Bestandtheils. Es werden z. B. von einem Kapital, prozentweis berechnet ursprünglich je 50 Pfd. St. in Produktionsmitteln und je 50 Pfd. St. in Arbeitskraft, später, mit der Entwicklung des Produktivgrads der Arbeit, je 80 Pfd. St. in Produktionsmitteln und je 20 Pfd. St. in Arbeitskraft ausgelegt u. s. w. Wir
sagen „spiegelt sich wieder“, weil die Abnahme des variablen Kapitaltheils gegenüber dem constanten, oder die veränderte Zusammensetzung des Kapitalwerths, nur annähernd den Wechsel in der Zusammensetzung seiner stofflichen Bestandtheile anzeigt. Wenn z. B. heute der in der Spinnerei angelegte Kapitalwerth zu ⅞ constant und ⅛ variabel ist, während er Anfang des 18. Jahrhunderts ½ constant und ½ variabel war, so ist dagegen die Masse von Rohstoff, Arbeitsmitteln u. s. w., die ein bestimmtes Quantum Spinnarbeit heute produktiv konsumirt, viel hundertmal grösser als im Anfang des 18. Jahrhunderts. Der Grund ist einfach der, dass mit der wachsenden Produktivität der Arbeit nicht nur der Umfang der von ihr vernutzten Produktionsmittel steigt, sondern deren Werth, verglichen mit ihrem Umfang, fällt. Ihr Werth steigt also absolut, aber nicht proportionell mit ihrem Umfang. Das Wachsthum der Differenz zwischen constantem und variablem Kapitaltheil ist daher viel kleiner als das der Differenz zwischen der Masse der Produktionsmittel, worin das constante, und der Masse Arbeitskraft, worin das variable Kapital umgesetzt wird. Die erstere Differenz nimmt zu mit der letzteren, aber in viel geringerem Grad. Es giebt andre Umstände, welche das Verhältniss zwischen Werth der Produktionsmittel und Werth der sie bewegenden Arbeitskraft von dem technologischen Verhältniss ihrer Massen abweichen machen. Diese modificirenden Umstände können wir erst im Dritten Buch betrachten. Die Rücksichtnahme darauf ist hier aber auch überflüssig, da die Abnahme des variablen Kapitaltheils gegen den constanten im Grossen und Ganzen, wenn auch nur andeutungsweise, die Zunahme der von derselben Masse Arbeitskraft in Bewegung gesetzten oder produktiv konsumirten Masse von Produktionsmitteln ausdrückt.
Im vierten Kapitel wurde gezeigt, wie die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit Cooperation auf grosser Stufenleiter voraussetzt, wie nur unter dieser Voraussetzung Theilung und Kombination der Arbeit organisirt, Produktionsmittel durch massenhafte Koncentration ökonomisirt, schon stofflich nur gemeinsam anwendbare Arbeitsmittel, z. B. System der Maschinerie u. s. w., ins Leben gerufen, ungeheure Naturkräfte in den Dienst der Produktion gepresst und die Verwandlung des Produktionsprozesses in technologische Anwendung der Wissenschaft vollzogen werden können. Auf Grundlage der Waarenproduktion, wo die Produktionsmittel Eigenthum von Privatpersonen
sind, wo der Handarbeiter daher entweder isolirt und selbstständig Waaren producirt oder seine Arbeitskraft als Waare verkauft, weil ihm die Mittel zum Selbstbetrieb fehlen, realisirt sich jene Voraussetzung nur durch das Wachsthum der individuellen Kapitale, oder im Masse, worin die gesellschaftlichen Produktionsund Lebensmittel in das Privateigenthum individueller Kapitalisten verwandelt werden. Der Boden der Waarenproduktion kann die Produktion auf grosser Stufenleiter nur in kapitalistischer Form tragen. Eine gewisse Accumulation von Kapital in den Händen individueller Waarenproducenten bildet die Voraussetzung der specifisch kapitalistischen Produktionsweise. Wir mussten sie daher unterstellen bei dem Uebergang aus dem Handwerk in den kapitalistischen Betrieb. Sie mag die ursprüngliche Accumulation heissen, weil sie statt historisches Resultat historische Grundlage der specifisch kapitalistischen Produktion. Wie sie selbst entspringt, brauchen wir hier nicht zu untersuchen. Genug, sie bildet den Ausgangspunkt. Aber alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit, die auf dieser Grundlage erwachsen, sind zugleich Methoden zur Produktion des Mehrwerths oder Mehrprodukts, welches seinerseits das Bildungselement der Accumulation. Sie sind also zugleich Methoden der Produktion von Kapital durch Kapital oder Methoden seiner beschleunigten Accumulation ist. Die kontinuirliche Rückverwandlung von Mehrwerth in Kapital stellt sich dar als wachsende Grösse des in den Produktionsprozess eingehenden Kapitals. Diese wird ihrerseits Grundlage einer erweiterten Stufenleiter der Produktion, der sie begleitenden Methoden zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, und beschleunigter Produktion von Mehrwerth. Wenn also ein gewisser Grad der Kapitalaccumulation als Bedingung der specifisch kapitalistischen Produktionsweise erscheint, verursacht die letztere rückschlagend eine beschleunigte Accumulation des Kapitals. Mit der Accumulation des Kapitals entwickelt sich daher die specifisch kapitalistische Produktionsweise und mit der specifisch kapitalistischen Produktionsweise die Accumulation des Kapitals.
Jedes individuelle Kapital ist eine grössere oder kleinere Koncentration von Produktionsmitteln mit entsprechendem Kommando über eine grössere oder kleinere Arbeiterarmee. Jede Accumulation wird das
Mittel neuer Accumulation. Sie erweitert mit der vermehrten Masse des als Kapital funktionirenden Reichthums seine Koncentration in den Händen individueller Kapitalisten, daher die Grundlage der Produktion auf grosser Stufenleiter und der specifisch kapitalistischen Produktionsmethoden. Das Wachsthum des gesellschaftlichen Kapitals vollzieht sich im Wachsthum vieler individuellen Kapitale. Alle andern Umstände als gleichbleibend vorausgesetzt, wächst jedes dieser individuellen Kapitale, und die in ihm gegebne Koncentration der Produktionsmittel, im Verhältniss worin es einen aliquoten Theil des gesellschaftlichen Gesammtkapitals bildet. Zugleich reissen sich Ableger von den Originalkapitalen los und funktioniren als neue selbstständige Kapitale. Eine grosse Rolle spielt dabei nothwendig die Theilung des Vermögens in Kapitalistenfamilien. Mit der Accumulation des Kapitals wächst daher auch mehr oder minder die Anzahl der Kapitalisten. Zwei Punkte charakterisiren diese Art Koncentration, welche unmittelbar auf der Accumulation beruht oder vielmehr mit ihr identisch ist. Erstens: Die wachsende Koncentration der gesellschaftlichen Produktionsmittel in den Händen individueller Kapitalisten ist, unter sonst gleichbleibenden Umständen, beschränkt durch den Wachsthumgrad des gesellschaftlichen Reichthums. Zweitens: Der in jeder besondern Produktionssphäre ansässige Theil des gesellschaftlichen Kapitals ist vertheilt unter viele Kapitalisten, welche einander als unabhängige und mit einander konkurrirende Waarenproducenten gegenüberstehn. Die Accumulation und die sie begleitende Koncentration sind also nicht nur auf viele Punkte zersplittert, sondern das Wachsthum der funktionirenden Kapitale ist durchkreuzt durch die Bildung neuer und die Spaltung alter Kapitale, Stellt sich die Accumulation daher einerseits dar als wachsende Koncentration der Produktionsmittel und des Kommando’s über Arbeit, so andrerseits als Repulsion vieler individueller Kapitale von einander.
Dieser Zersplitterung des gesellschaftlichen Gesammtkapitals in viele individuelle Kapitale oder der Repulsion seiner Bruchtheile von einander wirkt entgegen ihre Attraktion. Es ist diess nicht mehr einfache, mit der Accumulation identische Koncentration von Produktionsmitteln und Kommando über Arbeit. Es ist Koncentration bereits gebildeter Kapitale, Aufhebung ihrer individuellen Selbstständigkeit, Expropriation von Kapitalist durch Kapitalist, Verwandlung vieler kleinerer
in weniger grössere Kapitale. Dieser Prozess unterscheidet sich von dem ersten dadurch, dass er nur veränderte Vertheilung der bereits vorhandnen und funktionirenden Kapitale voraussetzt, sein Spielraum also durch dasabsolute Wachsthum des gesellschaftlichen Reichthums oder die absoluten Grenzen der Accumulation nicht beschränktist. Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu grossen Massen, weil es dort in vielen Händen verloren geht. Es ist die eigentliche Koncentration im Unterschied zur Accumulation.
Die Gesetze dieser Koncentration der Kapitale oder der Attraktion von Kapital durch Kapital können hier nicht entwickelt werden. Kurze thatsächliche Andeutung genügt. Der Konkurrenzkampf wird durch Verwohlfeilerung der Waaren geführt. Die Wohlfeilheit der Waaren hängt, caeteris paribus, von der Produktivität der Arbeit, diese aber von der Stufenleiter der Produktion ab. Die grösseren Kapitale schlagen daher die kleineren. Man erinnert sich ferner, dass mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Minimalumfang des individuellen Kapitals wächst, der erheischt ist, um ein Geschäft unter seinen normalen Bedingungen zu betreiben. Die kleineren Kapitale drängen sich daher in Produktionssphären, deren sich die grosse Industrie nur noch sporadisch oder unvollkommen bemächtigt hat. Die Konkurrenz rast hier im direkten Verhältniss zur Anzahl und im umgekehrten Verhältniss zur Grösse der rivalisirenden Kapitale. Sie endet stets mit Untergang vieler kleiner Kapitalisten und Uebergang ihrer Kapitale in die Hand des Siegers. Abgesehn hiervon bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue Macht, das Kreditwesen. Es wird nicht nur selbst zu einer neuen gewaltigen Waffe im Konkurrenzkampfe. Durch unsichtbare Fäden zieht es die über die Oberfläche der Gesellschaft in grösseren oder kleineren Massen zersplitterten Geldmittel in die Hände individueller Kapitalisten. Es ist die specifische Maschine zur Koncentration der Kapitale.
Die Koncentration der Kapitale, oder der Prozess ihrer Attraktion, wird intensiver im Verhältniss, worin sich mit der Accumulation die specifisch kapitalistische Produktionsweise entwickelt. Ihrerseits wird die Koncentration einer der grossen Hebel jener Entwicklung. Sie verkürzt und beschleunigt die Verwandlung zersplitterter Produktionsprozesse in gesellschaftlich kombinirte und auf grosser Stufenleiter ausgeführte.
Der wachsende Umfang der individuellen Kapitalmassen wird zur materiellen Basis einer beständigen Umwälzung der Produktionsweise selbst. Fortwährend erobert die kapitalistische Produktionsweise ihr noch gar nicht, oder nur sporadisch, oder nur formell unterworfene Arbeitszweige. Daneben erwachsen auf ihrem Boden neue, ihr von vorn herein angehörige Arbeitszweige. Endlich wird in den bereits kapitalistisch betriebenen Arbeitszweigen die Produktivkraft der Arbeit treibhausmässig gereift. In allen diesen Fällen sinkt die Arbeiterzahl verhältnissmässig zur Masse der von ihr verarbeiteten Produktionsmittel. Ein stets grösserer Theil des Kapitals wird in Produktionsmittel umgesetzt, ein stets kleinerer in Arbeitskraft. Mit dem Umfang, der Koncentration und der technischen Wirksamkeit der Produktionsmittel vermindert sich progressiv der Grad, worin sie Beschäftigungs mittel der Arbeiter sind. Ein Dampfpflug ist ein ungleich wirksameres Produktionsmittel als der gewöhnliche Pflug, aber der in ihm ausgelegte Kapitalwerth ist ein ungleich geringeres Beschäftigungsmittel, als wenn er in gewöhnlichen Pflügen realisirt wäre. Zunächst ist es grade die Zufügung von neuem Kapital zum alten, welche die gegenständlichen Bedingungen des Produktionsprozesses auszuweiten und technologisch umzuwälzen erlaubt. Bald aber ergreift die veränderte Zusammensetzung und technologische Umgestaltung mehr oder minder alles alte Kapital, das seinen Reproduktionstermin erreicht hat und daher neu ersetzt wird. Diese Metamorphose des alten Kapitals ist vom absoluten Wachsthum des gesellschaftlichen Kapitals zu gewissem Grad unabhängig, wie es die Koncentration ist. Letztre aber, welche vorhandnes gesellschaftliches Kapital nur anders vertheilt und viele alte Kapitale in eins verschmilzt, wirkt wieder als mächtiges Agens in dieser Metamorphose des alten Kapitals.
Einerseits attrahirt also das im Fortgang der Accumulation gebildete Zuschusskapital, verhältnissmässig zu seiner Grösse, weniger und weniger Arbeiter. Andrerseits repellirt das in neuer Zusammensetzung reproducirte alte Kapital mehr und mehr früher von ihm beschäftigte Arbeiter.
Die Accumulation des Kapitals, welche ursprünglich nur als seine quantitative Erweiterung erscheint, vollzieht sich also in fortwährendem qualitativen Wechsel seiner Zusammensetzung, in beständiger Zunahme seines constanten auf Kosten seines variablen Bestandtheils.
Die specifisch kapitalistische Produktionsweise, die ihr entsprechende
Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, der dadurch verursachte Wechsel in der organischen Zusammensetzung des Kapitals halten nicht nur Schritt mit dem Fortschritt der Accumulation oder dem Wachsthum des gesellschaftlichen Reichthums. Sie schreiten ungleich schneller, weil die einfache Accumulation oder die absolute Ausdehnung des Gesammtkapitals von der Koncentration seiner individuellen Elemente, und die technologische Umwälzung des Surpluskapitals von technologischer Umwälzung des Originalkapitals begleitet sind. Mit dem Fortgang der Accumulation wandelt sich also das Verhältniss von constantem zu variablem Kapitaltheil, wenn ursprünglich 1 : 1, in 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1, 7 : 1 u. s. w., so dass, wie das Kapital wächst, statt ½ seines Gesammtwerths progressiv nur ⅓, ¼, ⅕, ⅙, ⅛ u. s. w. in Arbeitskraft, dagegen ⅔, ¾, ⅘, ⅚, ⅞ u. s. w. in Produktionsmittel umgesetzt wird. Da die Nachfrage nach Arbeit nicht durch den Umfang des Gesammtkapitals, sondern durch den seines variablen Bestandtheils bestimmt ist, fällt sie also progressiv mit dem Wachsthum des Gesammtkapitals, statt, wie vorhin unterstellt, verhältnissmässig mit ihm zu wachsen. Sie fällt relativ zur Grösse des Gesammtkapitals und in beschleunigter Progression mit dem Wachsthum dieser Grösse. Mit dem Wachsthum des Gesammtkapitals wächst zwar auch sein variabler Bestandtheil, oder die ihm einverleibte Arbeitskraft, aber in beständig abnehmender Proportion. Die Zwischenpausen, worin die Accumulation als blosse Erweiterung der Produktion auf gegebner technologischer Grundlage wirkt, verkürzen sich. Nicht nur wird eine in wachsender Progression beschleunigte Accumulation des Gesammtkapitals erheischt, um eine additionelle Arbeiterzahl von gegebner Grösse zu absorbiren oder selbst, wegen der beständigen Metamorphose des alten Kapitals, die bereits funktionirende zu beschäftigen. Ihrerseits schlägt diese wachsende Accumulation und Koncentration selbst wieder um in eine Quelle neuer Wechsel der Zusammensetzung des Kapitals oder abermalig beschleunigter Abnahme seines variablen gegen seinen constanten Bestandtheil. Diese mit dem Wachsthum des Gesammtkapitals beschleunigte und rascher denn sein eignes Wachsthum beschleunigte relative Abnahme seines variablen Bestandtheils scheint auf der andern Seite umgekehrt stets rascheres absolutes Wachsthum der Arbeiterbevölkerung als das des variablen Kapitals oder ihrer Beschäftigungsmittel. Die kapitalistische Accu
mulation producirt vielmehr, und zwar im Verhältniss zu ihrer Energie und ihrem Umfang, beständig eine relative, d. h. für die mittleren Verwerthungsbedürfnisse des Kapitals überschüssige, daher überflüssige oder Surplus-Arbeiterbevölkerung.
Das gesellschaftliche Gesammtkapital betrachtet, ruft die Be wegung seiner Accumulation bald periodischen Wechsel hervor, bald vertheilen sich ihre Momente gleichzeitig über die verschiednen Produktionssphären. In einigen Sphären findet Wechsel in der Zusammensetzung des Kapitals statt ohne Wachsthum seiner absoluten Grösse, in Folge blosser Koncentration; in andern ist das absolute Wachsthum des Kapitals mit absoluter Abnahme seines variablen Bestandtheils oder der von ihm absorbirten Arbeitskraft verbunden; in andern wächst das Kapital bald auf seiner gegebnen technischen Grundlage fort, und attrahirt zuschüssige Arbeitskraft im Verhältniss seines Wachsthums, bald tritt organischer Wechsel ein und kontrahirt sich sein variabler Bestandtheil; in allen Sphären ist das Wachsthum des variablen Kapitaltheils und daher der beschäftigten Arbeiterzahl stets verbunden mit heftigen Fluktuationen und vorübergehender Produktion von Surpluspopulation, ob diese nun die auffallendere Form von Repulsion bereits beschäftigter Arbeiter annimmt oder die mehr unscheinbare, aber nicht minder wirksame, erschwerter Absorption der zuschüssigen Arbeiterbevölkerung in ihre gewohnten Abzugskanäle(FN 78). Mit
der Grösse des bereits funktionirenden Gesellschaftskapitals und dem Grad seines Wachsthums, mit der Ausdehnung der Produktionsleiter und der Masse der in Bewegung gesetzten Arbeiter, mit der Entwicklung der Produktivkraft ihrer Arbeit, mit dem breiteren und volleren Strom aller Springquellen des Reichthums dehnt sich auch die Stufenleiter, worin grössere Attraktion der Arbeiter durch das Kapital mit grösserer Repulsion derselben verbunden ist, nimmt die Raschheit der Wechsel in der organischen Zusammensetzung des Kapitals und seiner technischen Form zu, und schwillt der Umkreis der Produktionssphären, die bald gleichzeitig, bald abwechselnd davon ergriffen werden. Mit der von ihnen producirten Accumulation des Kapitals producirt die Arbeiterbevölkerung also in wachsendem Umfang die Mittel ihrer eignen relativen Ueberzähligmachung(FN 79). Es ist diess ein der kapitalistischen Produktionsweise eigenthümliches Populationsgesetz, wie in der That
jede besondre historische Produktionsweise ihre besondern, historisch gültigen Populationsgesetze hat. Ein abstraktes Populationsgesetz existirt nur für Pflanze und Thier.
Wenn aber eine Surplusarbeiterpopulation nothwendiges Produkt der Accumulation oder der Entwicklung des Reichthums auf kapitalistischer Grundlage ist, wird diese Surpluspopulation umgekehrt zum Hebel der kapitalistischen Accumulation, ja zu einer Existenzbedingung der kapitalistischen Produktionsweise. Sie bildet eine disponible industrielle Reservearmee, die dem Kapital ganz so absolut gehört, als ob es sie auf seine eignen Kosten grossgezüchtet hätte. Sie schafft für seine wechselnden Verwerthungsbedürfnisse das stets bereite exploitable Menschenmaterial, unabhängig von den Schranken der wirklichen Bevölkerungszunahme. Mit der Accumulation und der sie begleitenden Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wächst die plötzliche Expansionskraft des Kapitals, nicht nur, weil die Elasticität des funktionirenden Kapitals wächst, und der absolute Reichthum, wovon das Kapital nur einen elastischen Theil bildet, nicht nur, weil der Kredit, unter jedem besondern Reiz, im Umsehn ungewöhnlichen Theil dieses Reichthums der Produktion als Surpluskapital zur Verfügung stellt. Der technologische Charakter des Produktionsprozesses selbst, Maschinerie, Transportmittel u. s. w. ermöglichen die rascheste Verwandlung von Surplusprodukt auf grösster Stufenleiter in zuschüssige Produktionsmittel. Die mit dem Fortschritt der Accumulation überschwellende und in Surpluskapital verwandelbare Masse des gesellschaftlichen Reichthums drängt sich mit Frenesie in alte Produktionszweige, deren Markt sich plötzlich erweitert, oder in neu eröffnete, wie Eisenbahnen u. s. w., deren Bedürfniss aus der Entwicklung der alten entspringt. In allen solchen Fällen müssen grosse Menschenmassen plötzlich und ohne Abbruch der Produktionsleiter in andern Sphären auf die entscheidenden Punkte werfbar sein. Die Surpluspopulation liefert sie. Der charakteristische Lebenslauf der
modernen Industrie, die Form eines durch kleinere Schwankungen unterbrochnen zehnjährigen Cyklus von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Produktion unter Hochdruck, Krise und Stagnation, beruht auf der beständigen Bildung, grösseren oder geringeren Absorption, und Wiederbildung der industriellen Reservearmee oder Surpluspopulation. Ihrerseits rekrutiren die Wechselfälle des industriellen Cyklus die Surpluspopulation und werden zu einem ihrer energischsten Reproduktionsagentien. Dieser eigenthümliche Lebenslauf der modernen Industrie, der uns in keinem früheren Zeitalter der Menschheit begegnet, war auch in der Kindheitsperiode der kapitalistischen Produktion unmöglich. Die Zusammensetzung des Kapitals veränderte sich nur sehr allmälig. Seiner Accumulation entsprach also im Ganzen verhältnissmässiges Wachsthum der Arbeitsnachfrage. Langsam wie der Fortschritt seiner Accumulation, verglichen mit der modernen Epoche, stiess er auf Naturschranken der exploitablen Arbeiterbevölkerung, welche nur durch später zu erwähnende Gewaltmittel wegräumbar war. Die plötzliche und ruckweise Expansion der Produktionsleiter ist die Voraussetzung ihrer plötzlichen Kontraktion; letztere ruft wieder die erstere hervor, aber die erstere ist unmöglich ohne disponibles Menschenmaterial, ohne eine vom absoluten Wachsthum der Bevölkerung unabhängige Vermehrung von Arbeitern. Sie wird geschaffen durch den einfachen Prozess, der einen Theil der Arbeiter beständig „freisetzt“, durch Methoden, welche die Anzahl der beschäftigten Arbeiter im Verhältniss zur vermehrten Produktion vermindern. Die ganze Bewegungsform der modernen Industrie erwächst also aus der beständigen Verwandlung eines Theils der Arbeiterbevölkerung in unbeschäftigte oder halbbeschäftigte Hände. Die Oberflächlichkeit der politischen Oekonomie zeigt sich u. a. darin, dass sie die Expansion und Kontraktion des Kredits, das blosse Symptom der Wechselperioden des industriellen Cyklus, zu deren Ursache macht. Ganz wie die Himmelskörper, sobald sie durch ersten Stoss in eine bestimmte Bewegung geschleudert sind, dieselbe Bewegung stets reproduciren, so die gesellschaftliche Produktion, sobald sie einmal in jene Bewegung wechselnder Expansion und Kontraktion geworfen ist. Wirkungen werden ihrerseits zu Ursachen und die Wechselfälle des ganzen Prozesses, der seine eignen Bedingungen stets reproducirt, nehmen die Form der Periodicität an. Ist letztere einmal konsolidirt, so begreift selbst die politische Oekonomie die Produktion einer relativen, d. h. für
das mittlere Verwerthungsbedürfniss des Kapitals relativen Surpluspopulation, als Lebensbedingung der modernen Industrie.
„Gesetzt“, sagt H. Merivale, früher Professor der politischen Oekonomie zu Oxford, später Beamter des englischen Kolonialministeriums, „gesetzt, bei Gelegenheit einer Krise raffe die Nation sich zu einer Kraftanstrengung auf, um durch Emigration einiger 100,000 überflüssiger Arme los zu werden, was würde die Folge sein? Dass bei der ersten Wiederkehr der Arbeitsnachfrage ein Mangel vorhanden wäre. Wie rasch immer die Reproduktion von Menschen sein mag, sie braucht jedenfalls den Zwischenraum einer Generation zum Ersatz erwachsner Arbeiter. Nun hängen die Profite unsrer Fabrikanten hauptsächlich von der Macht ab, den günstigen Moment lebhafter Nachfrage zu exploitiren und sich so für die Periode der Erlahmung schadlos zu halten. Diese Macht ist ihnen nur gesichert durch Kommando über Maschinerie und Handarbeit. Sie müssen disponible Hände vorfinden; sie müssen fähig sein die Aktivität ihrer Operationen, wenn nöthig, höher zu spannen oder abzuspannen, je nach dem Stand des Markts, oder sie können platterdings nicht in der Hetzjagd der Konkurrenz das Uebergewicht behaupten, worauf der Reichthum dieses Landes gegründet ist“(FN 80). Selbst Malthus erkennt in der Surpluspopulation, die er, nach seiner bornirten Weise, aus absolutem Ueberwachs der Arbeiterbevölkerung, nicht aus ihrer relativen Ueberzähligmachung deutet, eine Nothwendigkeit der modernen Industrie. Er sagt: „Weise Gewohnheiten in Bezug auf die Ehe, wenn zu einer gewissen Höhe getrieben unter der Arbeiterklasse eines Landes, das hauptsächlich von Manufaktur und Handel abhängt, würden ihm schädlich sein … Der Natur der Bevölkerung gemäss, kann ein Zuwachs von Arbeitern nicht zu Markt geliefert werden, in Folge besondrer Nachfrage, bis nach Verlauf von 16 oder 18 Jahren, und die Verwandlung von Revenue in Kapital durch Ersparung kann sehr viel rascher platzgreifen; ein Land ist stets dem ausgesetzt, dass sein Arbeitsfonds rascher wächst als die Bevölkerung“(FN 81). Nachdem die politische
Oekonomie so die beständige Produktion einer relativen Surpluspopulation von Arbeitern für eine Nothwendigkeit der kapitalistischen Accumulation erklärt hat, legt sie, und zwar adäquat in der Figur einer alten Jungfer, dem „beau ideal“ ihres Kapitalisten folgende Worte an die durch ihre eigne Schöpfung von Surpluskapital aufs Pflaster geworfenen „Ueberzähligen“ in den Mund: „Wir Fabrikanten thun was wir können für euch, indem wir das Kapital vermehren, von dem ihr subsistiren müsst; und ihr müsst das übrige thun, indem ihr eure Zahlen den Subsistenzmitteln proportionirt“(FN 82).
Die kapitalistische Produktion schliesst die Schranken disponibler Arbeitskraft durch bloss natürlichen Zuwachs der Bevölkerung aus. Sie bedarf zu ihrem freien Spiel einer von dieser Schranke unabhängigen industriellen Reservearmee.
Bisher wurde unterstellt, dass der Zuoder Abnahme des variablen Kapitals genau die Zuoder Abnahme der beschäftigten Arbeiterzahl entspricht. Die Abweichungen des Grössenwechsels des variablen Kapitals vom Grössenwechsel der Arbeiterzahl, worin es sich umsetzt, werden im Dritten Buch weiter erörtert. Hier interessiren sie uns nur, soweit sie das allgemeine Gesetz der Accumulation betreffen.
Bei gleichbleibender oder selbst verminderter Zahl der von ihm kommandirten Arbeiter wächst das variable Kapital, wenn der individuelle Arbeiter mehr Arbeit liefert und daher sein Arbeitslohn wächst, obgleich der Arbeitspreis gleich bleibt, oder selbst sinkt, nur langsamer als die Arbeitsmasse steigt. Der Zuwachs des variablen Kapitals wird dann Index von mehr Arbeit, aber nicht von mehr beschäftigten Arbeitern. Jeder
Kapitalist hat das absolute Interesse, ein bestimmtes Arbeitsquantum aus kleinerer, statt eben so wohlfeil oder selbst wohlfeiler aus grösserer Arbeiterzahl auszupressen. In dem letzten Fall wächst die Auslage von constantem Kapital verhältnissmässig zur Masse der in Fluss gesetzten Arbeit, im ersten Fall viel langsamer. Je grösser die Stufenleiter der Produktion, desto entscheidender diess Motiv. Seine Wucht wächst mit der Accumulation des Kapitals.
Man hat gesehn, dass die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise und Produktivkraft der Arbeit — zugleich Ursache und Wirkung der Accumulation — den Kapitalisten befähigt, mit derselben Auslage von variablem Kapital mehr Arbeit durch grössere extensive oder intensive Exploitation der individuellen Arbeitskräfte flüssig zu machen. Man hat ferner gesehn, dass er mit demselben Kapitalwerth mehr Arbeitskräfte kauft, indem er progressiv geschicktere Arbeiter durch ungeschicktere, reife durch unreife, männliche durch weibliche, erwachsne Arbeitskraft durch jugendliche oder kindliche verdrängt.
Einerseits macht also, im Fortgang der Accumulation, grösseres variables Kapital mehr Arbeit flüssig, ohne mehr Arbeiter zu werben, andrerseits macht variables Kapital von derselben Grösse mehr Arbeit mit derselben Masse Arbeitskraft flüssig und endlich mehr niedere Arbeitskräfte durch Verdrängung höherer.
Die Produktion einer relativen Surpluspopulation oder die Freisetzung von Arbeitern geht daher noch rascher voran als die ohnehin mit dem Fortschritt der Accumulation beschleunigte technologische Umwälzung des Produktionsprozesses und die entsprechende proportionelle Abnahme des variablen Kapitaltheils gegen den constanten. Wenn die Produktionsmittel, wie sie an Umfang und Wirkungskraft zunehmen, in geringerem Grad Beschäftigungsmittel der Arbeiter werden, wird diess Verhältniss selbst wieder dadurch modificirt, dass im Mass wie die Produktivkraft der Arbeit wächst, das Kapital seine Zufuhr von Arbeit rascher steigert als seine Nachfrage nach Arbeitern. Die Ueberarbeit des beschäftigten Theils der Arbeiterklasse schwellt die Reihen ihrer Reserve, während umgekehrt der vermehrte Druck, den die letztere durch ihre Konkurrenz auf die erstere ausübt, diese zur Ueberarbeit und Unterwerfung unter die Diktate des Kapitals zwingt. Die Verdammung eines Theils der Arbeiterklasse zu erzwungnem Müssiggang durch Ueberarbeit des andern
Theils, und vice versa, wird Bereicherungsmittel des einzelnen Kapitalisten(FN 83) und beschleunigt zugleich die Produktion der industriellen Reservearmee auf einem dem Fortschritt der gesellschaftlichen Accumulation entsprechenden Massstab. Wie wichtig diess Moment in der Bildung der relativen Surpluspopulation, beweist z. B. England. Seine technischen Mittel zur „Ersparung“ von Arbeit sind kolossal. Dennoch, würde morgen allgemein die Arbeit auf ein rationelles Mass beschränkt, und für die verschiednen Schichten der Arbeiterklasse wieder entsprechend nach Alter und Geschlecht abgestuft, so wäre die vorhandne Arbeiterpopulation absolut unzureichend zur Fortführung der nationalen Produktion auf ihrer jetzigen Stufenleiter. Die grosse Mehrheit der jetzt „unproduktiven“ Arbeiter müsste in „produktive“ verwandelt werden.
Im Grossen und Ganzen sind die allgemeinen Bewegungen des Arbeitslohns ausschliesslich regulirt durch die Expansion und Kontraktion der industriellen Reservearmee, welche dem Periodenwechsel des industriellen Cyklus entsprechen. Sie sind also nicht bestimmt durch die Bewegung der absoluten Anzahl der Arbeiterbevölkerung, sondern durch das wechselnde Verhältniss, worin die Arbeiterklasse in aktive Armee und Reservearmee zerfällt, durch die Zunahme und Abnahme des relativen Umfangs der Surpluspopulation, durch den Grad, worin sie bald absorbirt, bald wieder freigesetzt wird. Für die moderne Industrie mit ihrem zehnjährigen Cyklus und seinem regelmässigen Periodenwechsel, der ausserdem im Fortgang der Accumulation durch stets rascher auf einander folgende unregelmässige Oscillationen durchkreuzt wird, wäre es in der That ein schönes Gesetz, welches die Nachfrage und Zufuhr von Arbeit nicht durch die Expansion und Kontraktion des Kapitals, also nach seinen jedesmaligen Verwerthungsbedürfnissen regelte, so dass der Arbeitsmarkt bald relativ untervoll erscheint, weil das Kapital sich expandirt, bald wieder übervoll, weil es sich kontrahirt, sondern umgekehrt die Bewegung des Kapitals von der absoluten Bewegung der Populationsmenge abhängig machte. Diess jedoch ist das ökonomische Dogma. Nach demselben steigt in Folge der Kapitalaccumulation der Arbeitslohn. Der erhöhte Arbeitslohn spornt zur rascheren Vermehrung der Arbeiterbevölkerung und diese dauert fort, bis der Arbeitsmarkt überfüllt, also das Kapital relativ zur Arbeiterzufuhr unzureichend geworden ist. Der Arbeitslohn sinkt, und nun die Kehrseite der Medaille. Durch den fallenden Arbeitslohn wird die Arbeiterbevölkerung nach und nach decimirt, so dass ihr gegenüber das Kapital wieder überschüssig wird, oder auch, wie Andre es erklären, der fallende Arbeitslohn und die entsprechende erhöhte Exploitation des Arbeiters beschleunigt wieder die Accumulation, während gleichzeitig der niedere Lohn das Wachsthum der Arbeiterklasse in Schach hält. So tritt wieder das Verhältniss ein, worin die Arbeitszufuhr niedriger als die Arbeitsnachfrage, der Lohn steigt u. s. w. Eine schöne Bewegungsmethode diess für die entwickelte kapitalistische Produktion! Bevor in Folge der Lohnerhöhung irgend ein positives Wachsthum der wirklich arbeitsfähigen Bevölkerung eintreten könnte, wäre die Frist aber und abermal abgelaufen, worin der industrielle Feldzug geführt, die Schlacht geschlagen und entschieden sein muss.
Zwischen 1849 und 1859 trat, zugleich mit fallenden Getreidepreisen, eine praktisch betrachtet nur nominelle Lohnerhöhung in den englischen Agrikulturdistrikten ein, z. B. in Wiltshire stieg der Wochenlohn von 7 auf 8 sh., in Dorsetshire von 7 oder 8 auf 9 sh. u. s. w. Es war diess Folge des übergewöhnlichen Abflusses der agrikolen Surpluspopulation, verursacht durch Kriegsnachfrage, massenhafte Ausdehnung der Eisenbahnbauten, Fabriken, Bergwerke u. s. w. Je niedriger der Arbeitslohn, desto höher drückt sich jedes noch so unbedeutende Steigen desselben in Procentzahlen aus. Ist der Wochenlohn z. B. 20 sh. und steigt er auf 22, so um 10 %; ist er dagegen nur 7 sh. und steigt auf 9, so um 28 %, was sehr erklecklich klingt. Jedenfalls heulten die Pächter und schwatzte sogar der „ London Economist“ ganz ernsthaft von „a general and substantial advance“(FN 84) mit Bezug auf diese Hungerlöhne. Was thaten nun die Pächter? Warteten sie, bis die Landarbeiter sich in Folge dieser brillanten Zahlung so vermehrt hatten, dass ihr Lohn wieder fallen musste, wie die Sache sich im dogmatisch ökonomischen Hirn zuträgt? Sie führten mehr Maschinerie ein, und im Umsehn waren die Arbeiter wieder „überzählig“ in einem selbst den Pächtern genügenden Verhältniss. Es war jetzt „mehr Kapital“ in der Agrikultur angelegt als vorher und in einer produktiveren Form. Damit fiel die Nachfrage nach Arbeit nicht nur relativ, sondern absolut.
Jene ökonomische Fiktion verwechselt die Gesetze, welche die allgemeine Bewegung des Arbeitslohns oder das Verhältniss zwischen Arbeiterklasse und gesellschaftlichem Gesammtkapital regeln, mit den Gesetzen, welche die Arbeiterbevölkerung unter die besondern Produktionssphären vertheilen. Wenn z. B. in Folge günstiger Konjunktur die Accumulation in einer bestimmten Produktionssphäre besonders lebhaft, die Profite hier grösser als die Durchschnittsprofite, Zuschusskapital dahin drängt, so steigt natürlich Arbeitsnachfrage und Arbeitslohn. Der höhere Arbeitslohn zieht einen grösseren Theil der Arbeiterbevölkerung in die begünstigte Sphäre, bis sie mit Arbeitskraft gesättigt ist, und der Lohn auf die Dauer wieder auf sein früheres Durchschnittsniveau oder unter dasselbe fällt, falls der Zudrang zu gross war. Hier sieht der politische Oekonom „wo und wie“, mit Zunahme des Lohns eine absolute Zunahme
von Arbeitern, und mit der absoluten Zunahme der Arbeiter eine Abnahme des Lohns, aber er sieht in der That nur die lokale Oscillation des Arbeitsmarkts einer besondern Produktionssphäre, er sieht nur Phänomene der Vertheilung der Arbeiterbevöl kerung in die verschiednen Anlagesphären des Kapitals, je nach seinen wechselnden Bedürfnissen.
Die industrielle Reservearmee oder relative Surpluspopulation drückt während der Perioden der Stagnation und mittleren Prosperität auf die aktive Arbeiterarmee und hält ihre Ansprüche während der Periode der Ueberproduktion und des Paroxysmus im Zaum. Die relative Surpluspopulation ist also der Hintergrund, worauf das Gesetz der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit sich bewegt. Sie zwängt den Spielraum dieses Gesetzes in die der Exploitationsgier und Herrschsucht des Kapitals abso lut zusagenden Schranken ein. Es ist hier der Ort auf eine der Grossthaten der ökonomischen Apologetik zurückzukommen. Man erinnert sich, dass wenn durch Einführung neuer oder Ausdehnung alter Maschinerie ein Stück variables Kapital in constantes verwandelt wird, der ökonomische Apologet diese Operation, welche Kapital „bindet“ und eben dadurch Arbeiter „freisetzt“, umgekehrt so deutet, das sie Kapital für den Arbeiter freisetzt. Erst jetzt kann man die Unverschämtheit des Apologeten vollständig würdigen. Was freigesetzt wird, sind nicht nur die unmittelbar durch die Maschine verdrängten Arbeiter, sondern ebenso ihre Ersatzmannschaft und das, bei gewohnter Ausdehnung des Geschäfts auf seiner alten Basis, regelmässig absorbirte Zuschusskontingent. Es ist nicht altes Kapital für Arbeiter freigesetzt, aber es sind Arbeiter für etwa „ zuschüssiges“ Kapital freigesetzt. D. h. also, der Mechanismus der kapitalistischen Produktion sorgt dafür, dass der absolute Zuwachs von Kapital von keiner entsprechenden Steigerung der allgemeinen Arbeitsnachfrage begleitet ist. Und diess nennt der Apologet eine Kompensation für das Elend, die Leiden und den möglichen Untergang der deplacirten Arbeiter während der Uebergangsperiode, welche sie in die industrielle Reservearmee bannt! Die Nachfrage nach Arbeit ist nicht identisch mit Wachsthum des Kapitals, die Zufuhr der Arbeiter nicht mit dem Wachsthum der Arbeiterklasse, so dass zwei von einander unabhängige Potenzen auf einander einwirkten. Les dés sont pipés. Das Kapital agirt auf beiden Seiten zugleich. Wenn seine Accumulation einerseits die Nachfrage nach Arbeit
vermehrt, vermehrt sie andrerseits die Zufuhr von Arbeitern durch deren „Freisetzung“, während zugleich der Druck der Unbeschäftigten die Beschäftigten zur Flüssigmachung von mehr Arbeit zwingt, also in gewissem Grad die Arbeitszufuhr von der Zufuhr von Arbeitern unabhängig macht. Die Bewegung des Gesetzes der Nachfrage und Zufuhr von Arbeit auf dieser Basis vollendet die Despotie des Kapitals. Sobald daher die Arbeiter hinter das Geheimniss kommen, wie es zugeht, dass im selben Mass, wie sie mehr arbeiten, mehr fremden Reichthum produciren, und die Produktivkraft ihrer Arbeit wächst, sogar ihre Funktion als Verwerthungsmittel des Kapitals immer prekärer für sie wird; sobald sie entdecken, dass der Intensivitätsgrad der Konkurrenz unter ihnen selbst ganz und gar von dem Druck der relativen Surpluspopulation abhängt; sobald sie daher durch Trade’s Unions u. s. w. eine planmässige Zusammenwirkung zwischen den Beschäftigten und Unbeschäftigten zu organisiren suchen, um die ruinirenden Folgen jenes Naturgesetzes der kapitalistischen Produktion auf ihre Klasse zu brechen oder zu schwächen, zetert das Kapital, und sein Sykophant, der politische Oekonom, über Verletzung des „ewigen“ und so zu sagen „heiligen“ Gesetzes der Nachfrage und Zufuhr. Jeder Zusammenhalt zwischen den Beschäftigten und Unbeschäftigten stört nämlich das „reine“ Spiel jenes Gesetzes. Sobald andrerseits, in den Kolonieen z. B., widrige Umstände die Schöpfung der industriellen Reservearmee, und mit ihr die absolute Abhängigkeit der Arbeiterklasse von der Kapitalistenklasse, verhindern, rebellirt das Kapital, sammt seinem gemeinplätzlichen Sancho Pansa, gegen das „heilige“ Gesetz der Nachfrage und Zufuhr, und sucht ihm durch Zwangsmittel unter die Arme zu greifen.
Die relative Surpluspopulation existirt in allen möglichen Schattirungen. Jeder Arbeiter gehört dazu während der Zeit, wo er halb oder gar nicht beschäftigt ist. Ohne hier auf Details einzugehn, genügen einige allgemeine Andeutungen. Abgesehn von den periodischen Formverschiedenheiten der Surpluspopulation in dem Phasenwechsel des industriellen Cyklus, wo sie bald akut in den Krisen erscheint, bald chronisch in der Periode der Stagnation, besitzt sie fortwährend drei Formen, die flüssige, die latente und die stagnante.
Man hat gesehn, wie die Fabrikarbeiter bald repellirt, bald in grösserem Umfang wieder attrahirt werden, so dass im Grossen und Ganzen die Zahl der beschäftigten Arbeiter zunimmt, wenn auch in stets abnehmendem
Verhältniss zur Produktionsleiter. Die Surpluspopulation existirt hier in fliessender Form. Wir machen nur auf zwei Umstände aufmerksam. Sowohl in den eigentlichen Fabriken, wie in allen grossen Werkstätten, worin die Maschinerie als Faktor eingeht oder auch nur die moderne Theilung der Arbeit durchgeführt ist, werden männliche Arbeiter bis zur Zurücklegung des Jugendalters in Massen verbraucht, wovon später nur sehr geringe Proportion in demselben Zweig verwendbar bleibt, daher beständig grosse Anzahl herausgeworfen wird. Sie bilden ein Element der fliessenden Surpluspopulation, das mit dem Umfang der Industrie wächst. Ein Theil davon emigrirt und reist in der That nur dem emigrirenden Kapital nach. Eine der Folgen ist, dass die weibliche Bevölkerung rascher wächst als die männliche, teste England. Der Widerspruch, dass der natürliche Zuwachs der Arbeiterbevölkerung den Accumulationsbedürfnissen des Kapitals nicht genügt, und andrerseits zu gross für seine Absorption ist, ist ein Widerspruch seiner Bewegung selbst. Es braucht grössere Massen davon im früheren Alter, weniger im männlichen. Der Widerspruch ist nicht grösser als der andre, dass während Arbeiter zu vielen Tausenden auf dem Pflaster liegen, weil die Theilung der Arbeit sie an einen bestimmten Geschäftszweig kettet, gleichzeitig über Mangel an Händen geklagt wird(FN 85). Bei dem raschen Konsum der Arbeitskraft durch das Kapital ist der Arbeiter von mittlerem Alter meist schon überlebt. Er fällt in die Reihen der Surpluspopulation oder rückt von einer höhern Staffel auf eine niedrigere, während das Kapital seinen Platz durch frischere Arbeitskraft ersetzt. Das absolute Wachsthum der Arbeiterklasse erheischt so eine Form, welche ihre Zahl schwellt, obgleich ihre Elemente sich rasch abnutzen. Es ist daher rasche Ablösung der Arbeitergenerationen nöthig. (Dasselbe Gesetz gilt nicht für die übrigen Klassen der Bevölkerung.) Diess wird erreicht durch frühe Ehen, nothwendige Folge der Verhältnisse, worin die Arbeiter der grossen Industrie leben, und durch die Prämie, welche die Exploitation der Arbeiterkinder auf ihre Produktion setzt.
Sobald sich die kapitalistische Produktion der Agrikultur oder im Grad, worin sie sich derselben bemächtigt hat, nimmt mit der Accumulation des hier funktionirenden Kapitals die Nachfrage für die ländliche Arbeiterbevölkerung absolut ab, ohne dass ihre Repulsion, wie in der nicht agrikolen Industrie, durch grössere Attraktion ergänzt wäre. Ein Theil der Landbevölkerung befindet sich daher fortwährend im Uebergang zur Metamorphose in städtische oder Manufakturbevölkerung. (Manufaktur hier im Sinn aller nicht-agrikolen Industrie(FN 86).) Diese Quelle der relativen Surpluspopulation fliesst also beständig. Aber ihr beständiger Fluss setzt auf dem Lande selbst eine fortwährend latente Surpluspopulation voraus, deren Umfang nur sichtbar wird, sobald sich die Abzugskanäle ausnahmsweise weit öffnen. Der Landarbeiter wird daher auf das Minimum des Salairs herabgedrückt und steht mit einem Fuss stets im Sumpf des Pauperismus.
Die stagnante Surpluspopulation bildet einen Theil der aktiven Arbeiterarmee, aber mit durchaus unregelmässiger Beschäftigung, so dass das Kapital hier stets eine ausserordentliche Masse latenter Arbeitskraft zur Verfügung hat. Ihre Lebenslage sinkt unter das durchschnittliche Normalniveau der arbeitenden Klasse und grade diess macht sie zur breiten Grundlage eigner Exploitationszweige des Kapitals. Maximum der Arbeitszeit und Minimum des Salairs charakterisiren sie. Wir haben unter der Rubrik der Hausarbeit ihre Hauptgestalt bereits kennen gelernt. Sie rekrutirt sich fortwährend aus den Ueberzähligen der grossen Industrie und Agrikultur, und namentlich auch in untergehenden Industriezweigen, wo der Handwerksbetrieb dem Manufakturbetrieb, letztrer dem Maschinenbetrieb erliegt. Ihr Umfang dehnt sich, wie mit Umfang und Energie der Accu-
mulation die „Ueberzähligmachung“ fortschreitet. Aber sie bildet zugleich ein sich selbst reproducirendes und verewigendes Element der Arbeiterklasse, das verhältnissmässig grösseren Antheil am Gesammtwachsthum derselben nimmt als die übrigen Elemente. In der That steht nicht nur die Masse der Geburten und Todesfälle, sondern die absolute Grösse der Familien in umgekehrtem Verhältniss zur Höhe des Arbeitslohns, also zur Masse der Lebensmittel, worüber die verschiednen Arbeiterkategorieen verfügen. Diess Gesetz der kapitalistischen Gesellschaft klänge unsinnig unter Wilden, oder selbst civilisirten Kolonisten. Es erinnert an die massenhafte Reproduktion individuell schwacher und vielgehetzter Thierarten(FN 87).
Der tiefste Niederschlag der relativen Surpluspopulation endlich bildet die Sphäre des Pauperismus. Sie besteht — wir sehn hier ab von Vagabunden, Verbrechern, Prostituirten, kurz dem eigentlichen Lumpenproletariat — aus drei Kategorieen: erstens, Arbeitsfähige. Man braucht die Statistik des englischen Pauperismus nur oberflächlich anzusehn und man findet, dass seine Masse mit jeder Krise schwillt und mit jeder Wiederbelebung des Geschäfts abnimmt. Zweitens: Waisenund Pauperkinder. Sie sind Kandidaten der industriellen Reservearmee und werden in Zeiten grosser Prosperität, wie 1860 z. B., rasch und massenhaft in die aktive Arbeiterarmee einrollirt. Drittens: Verkommene, Verlumpte, Arbeitsunfähige. Es sind namentlich Arbeiter, die an ihrer durch die Theilung der Arbeit verursachten Unbeweglichkeit untergehn, solche, die über das Normalalter eines Arbeiters hinausleben, endlich die Opfer der Industrie, deren Zahl mit gefährlicher Maschinerie, Bergwerksbau, chemischen Fabriken u. s. w. wächst, Verstümmelte, Verkrankte, Wittwen u. s. w. Der Pauperismus bildet das Invalidenhaus der aktiven
Arbeiterarmee und das todte Gewicht der industriellen Reservearmee. Seine Produktion ist eingeschlossen in der Produktion der Surpluspopulation, seine Nothwendigkeit in ihrer Nothwendigkeit, mit ihr bildet er eine Existenzbedingung der kapitalistischen Produktion und Entwicklung des Reichthums. Er gehört zu den faux frais der kapitalistischen Produktion, die das Kapital jedoch grossentheils von sich selbst ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und der kleinen Mittelklasse zu wälzen weiss.
Je grösser der gesellschaftliche Reichthum, das funktionirende Kapital, Umfang und Energie seines Wachsthums, also auch die absolute Grösse der Arbeiterbevölkerung und die Produktivkraft ihrer Arbeit, desto grösser die relative Surpluspopulation oder industrielle Reservearmee. Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben Ursachen entwickelt, wie die Expansivkraft des Kapitals. Die verhältnissmässige Grösse der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichthums. Je grösser aber diese Reservearmee im Verhältniss zur aktiven Arbeiterarmee, desto massenhafter die konsolidirte Surpluspopulation oder die Arbeiterschichten, deren Elend im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Arbeitsqual steht. Je grösser endlich die Lazarusschichte der Arbeiterklasse und die industrielle Reservearmee, desto grösser der officielle Pauperismus. Diess ist das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Accumulation. Es wird gleich allen allgemeinen Gesetzen in seiner Verwirklichung durch mannigfache Umstände modificirt, deren Analyse nicht hierher gehört.
Man begreift die Narrheit der ökonomischen Weisheit, die den Arbeitern predigt, ihre Zahl den Verwerthungsbedürfnissen des Kapitals anzupassen. Der Mechanismus der kapitalistischen Produktion und Accumulation passt sie beständig diesen Verwerthungsbedürfnissen an. Erstes Wort dieser Anpassung ist die Schöpfung einer relativen Surpluspopulation oder industriellen Reservearmee, letztes Wort das Elend stets wachsender Schichten der aktiven Arbeiterarmee und das todte Gewicht des Pauperismus.
Das Gesetz, dass die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit die Masse der zu verausgabenden Arbeitskraft im Verhältniss zur Wirkung und Masse ihrer Produktionsmittel progressiv senkt, drückt sich auf kapitalistischer Grundlage, wo nicht der Arbeiter die Arbeitsmittel, sondern die Arbeitsmittel den Arbeiter anwenden, darin aus, dass je höher die Produktivkraft der Arbeit, desto grös
ser der Druck der Arbeiter auf ihre Beschäftigungsmittel und desto prekärer die Existenzbedingung des Lohnarbeiters, Verkauf seiner Arbeitskraft zur Vermehrung des fremden Reichthums oder Selbstverwerthung des Kapitals. Rascheres Wachsthum der Produktionsmittel und der Produktivkraft der Arbeit als der produktiven Bevölkerung drücktsich kapitalistisch umgekehrt darin aus, dass die Arbeiterbevölkerung stets rascher wächst als das Verwerthungsbedürfniss des Kapitals.
Es zeigte sich im vierten Kapitel bei Analyse der Produktion des relativen Mehrwerths, dass alle Methoden zur Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit in der kapitalistischen Form sich auf Kosten des individuellen Arbeiters entwickeln, dass alle Mittel zur Bereicherung der Produktion in Beherrschungsund Exploitationsmittel des Producenten umschlagen, dass sie den Arbeiter in einen Theilmenschen verstümmeln, ihn zum Anhängsel der Maschine entwürdigen, mit der Qual der Arbeit ihren Inhalt vernichten, ihm die geistigen Potenzen des Arbeitsprozesses entfremden, im selben Masse, worin derselbe sich die Wissenschaft als selbstständige Potenz einverleibt, die Bedingungen, innerhalb deren er arbeitet, beständig anormaler machen, ihn während des Arbeitsprozesses der kleinlichst gehässigen Despotie unterwerfen, seine Lebenszeit in Arbeitszeit verwandeln, sein Weib und Kind unter das Juggernautrad des Kapitals schleudern. Aber alle Methoden zur Produktion des Mehrwerths sind zugleich Methoden der Accumulation und jede Ausdehnung der Accumulation wird umgekehrt Mittel zur Entwicklung jener Methoden. Es folgt daher, dass im Masse wie Kapital accumulirt, die Lage des Arbeiters, welches immer seine Zahlung, sich verschlechtert. Das Gesetz endlich, welches die relativeSurpluspopulation oder industrielle Reservearmee stets mit Umfang und Energie der Accumulation in Gleichgewicht hält, schmiedet den Arbeiter fester an das Kapital als den Prometheus die Keile des Hephästos an den Felsen. Es bedingt eine der Accumulation von Kapital entsprechende Accumulation von Elend. Die Accumulation von Reichthum auf dem einen Pol ist also zugleich Accumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisirung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapital producirt.
Dieser antagonistische Charakter der kapitalistischen Accumulation(FN 88) ist in verschiedenen Formen von politischen Oekonomen ausgesprochen, obgleich sie zum Theil zwar analoge, aber dennoch wesentlich verschiedene Erscheinungen vorkapitalistischer Produktionsweisen damit zusammenwerfen.
Der venetianische Mönch Ortes, einer der grossen ökonomischen Schriftsteller des 18. Jahrhunderts, fasst den Antagonismus der kapitalistischen Produktion als allgemeines Naturgesetz des gesellschaftlichen Reichthums. „Das Ökonomisch Gute und ökonomisch Böse halten sich in einer Nation stets das Gleichgewicht („il bene ed il male economico in una nazione sempre all’ istessa misura“), die Fülle der Güter für Einige ist immer gleich dem Mangel derselben für Andre („la copia dei beni in alcuni sempre equale alla mancanza di esse in altri“). Grosser Reichthum in Einigen ist stets begleitet von absoluter Beraubung des Nothwendigen in viel mehr andern“(FN 89). Der Reichthum einer Nation entspricht ihrer Bevölkerung und ihr Elend entspricht ihrem Reichthum. Die Arbeitsamkeit in Einigen erzwingt den Müssiggang in Andern. Die Armen und Müssigen sind eine nothwendige Frucht der Reichen und Thätigen u. s. w. In ganz grober Weise verherrlichte ungefähr 10 Jahre nach Ortes der hochkirchliche protestantische Pfaffe Townsend die Armuth als nothwendige Bedingung des Reichthums. „ Gesetzlicher Zwang zur Arbeit ist verbunden mit zu viel Mühe, Gewaltsamkeit und Geräusch, während der Hunger nicht nur ein friedlicher, schweigsamer, unaufhörlicher Druck, sondern als natürlich-
stes Motiv zur Industrie und Arbeit die machtvollste Anstrengung hervorruft.“ Alles kömmt also darauf an, den Hunger unter der Arbeiterklasse permanent zu machen, und dafür sorgt, nach Townsend, das Bevölkerungsprincip, das besonders unter den Armen thätig ist. „Es scheint ein Naturgesetz, dass die Armen zu einem gewissen Grad leichtsinnig (improvident) sind (nämlich so leichtsinnig auf die Welt zu kommen ohne goldne Löffel im Mund), so dass stets welche da sind („that there always may be some“) zur Erfüllung der servilsten, schmutzigsten und gemeinsten Funktionen des Gemeinwesens. Der Fonds von menschlichem Glück („the fonds of human happiness“) wird dadurch sehr vermehrt, die Delikateren („the more delicate“) sind von der Plackerei befreit und können höherem Beruf u. s. w. ungestört nachgehn … Das Armengesetz hat die Tendenz, die Harmonie und Schönheit, die Symmetrie und Ordnung dieses Systems, welches Gott und die Natur in der Welt errichtet haben, zu zerstören“(FN 90). „ Der Fortschritt des gesellschaftlichen Reichthums“, sagt Storch, „erzeugt jene nützliche Klasse der Gesellschaft … welche die langweiligsten, gemeinsten und ekelhaftesten Beschäftigungen ausübt, in einem Wort alles, was das Leben unangenehmes und knechtendes hat, auf ihre Schultern nimmt und eben dadurch den andern Klassen die Zeit, die Heiterkeit des Geistes und die konventionelle (c’est bon!) Charakterwürde verschafft etc.“(FN 91). Storch fragt sich, welches denn eigentlich der Vorzug
dieser kapitalistischen Civilisation mit ihrem Elend und ihrer Degradation der Massen vor der Barbarei? Er findet nur eine Antwort — die Sicherheit! „Durch den Fortschritt der Industrie und Wissenschaft,“ sagt Sismondi, „kann jeder Arbeiter jeden Tag viel mehr produciren als er zu seinem Konsum braucht. Aber zu gleicher Zeit, während seine Arbeit den Reichthum producirt, würde der Reichthum, wäre er berufen ihn selbst zu konsumiren, ihn wenig geeignet zur Arbeit machen“(FN 92). „Die armen Nationen,“ sagt Destutt de Tracy, „sind die, wo das Volk gut dran ist, und die reichen Nationen sind die, wo es gewöhnlich arm ist“(FN 93).
Keine Periode der modernen Gesellschaft ist so günstig für das Studium der kapitalistischen Accumulation als die Periode der letztverflossenen 20 Jahre. Es ist als ob sie den Fortunatussäckel gefunden hätte. Von allen Ländern aber bietet England wieder das klassische Beispiel, weil es den ersten Rang auf dem Weltmarkt behauptet, die kapitalistische Produktionsweise hier allein völlig entwickelt ist, und endlich die Einführung des tausendjährigen Reichs des Freihandels seit 1846 der Vulgärökonomie den letzten Schlupfwinkel abgeschnitten hat. Der titanische Fortschritt der Produktion, so dass die letzte Hälfte der zwanzigjährigen Periode die erste wieder weit überflügelt, ward bereits im vierten Kapitel hinreichend angedeutet.
Obgleich das absolute Wachsthum der englischen Bevölkerung im letzten halben Jahrhundert sehr gross war, fiel das verhältnissmässige Wachsthum oder die Rate des Zuwachses fortwährend, wie folgende dem officiellen Census entlehnte Tabelle zeigt: Jährlicher procentmässiger Zuwachs der Bevölkerung von England und Wales in Decimalzahlen.
Betrachten wir nun andrerseits das Wachsthum des Reichthums. Den sichersten Anhaltspunkt bietet hier die Bewegung der der Einkommensteuer unterworfenen Profite, Grundrenten u. s. w. Der Zuwachs der steuerpflichtigen Profite (Pächter und einige andre Rubriken nicht eingeschlossen) betrug für Grossbritanien von 1853—1864 50.47 % (oder 4.58 % im jährlichen Durchschnitt)(FN 94), der der Bevölkerung während derselben Periode ungefähr 12 %. Die Zunahme der besteuerbaren Renten von Land (Häuser, Eisenbahnen, Minen, Fischereien u. s. w. eingeschlossen) betrug von 1853—1864 38 %, oder 3 % jährlich, woran folgende Rubriken den stärksten Antheil nahmen:
Vergleicht man je vier Jahre der Periode von 1853—1864, so wächst der Zunahmegrad der Einkommen fortwährend. Er ist z. B. für die aus Profit stammenden von 1853—1857 jährlich 1.73 %, 1857—1861 jährlich 2.74 %, und 9.30 % jährlich für 1861—1864. Die Gesammtsumme der der Einkommensteuer unterworfenen Einkommen des Vereinigten Königreichs betrug 1856: 307,068,898 Pfd. St., 1859: 328,127,416 Pfd. St., 1862: 351,745,241 Pfd. St., 1863: 359,142,897 Pfd. St., 1864: 362,462,279 Pfd. St., 1865: 385,530,020 Pfd. St.(FN 96).
Die Accumulation des Kapitals war zugleich von seiner Koncentration begleitet. Obgleich keine officielle Agrikulturstatistik für England (wohl aber für Irland) existirt, wurde sie von 10 Grafschaften freiwillig geliefert. Sie ergab hier das Resultat, dass von 1851 bis 1861 die Pachten unter 100 Acres von 31,583 auf 26,567 vermindert, also 5,016 mit grösseren Pachten zusammengeschlagen waren(FN 97). Von 1815 bis 1825 fiel kein Mobiliarvermögen über 1 Million Pfd. St. unter die Erbschaftssteuer, von 1825 bis 1855 dagegen 8, von 1856 bis Juni 1859, d. h. in 4½ Jahren, 4(FN 98). Die Koncentration wird man jedoch am besten ersehn aus einer kurzen Analyse der Einkommensteuer für Rubrik D ( Profite mit Ausschluss von Pächtern u. s. w.) in den Jahren 1864 und 1865. Ich bemerke vorher, dass Einkommen aus dieser Quelle bis zu 60 Pfd. St. hinab Income Taxe zahlen. Diese steuerpflichtigen Einkommen betrugen in England, Wales und Schottland 1864: 95,844,222 Pfd. St. und 1865: 105,435,579 Pfd. St.(FN 99), die Zahl der Besteuerten 1864 : 308,416 Personen auf eine Gesammtbevölkerung von 23,891,009, 1865 : 332,431 Personen auf Gesammtbevölkerung von 24,127,003. Ueber die Vertheilung dieser Einkommen in beiden Jahren folgende Tabelle:
Es wurden im Vereinigten Königreich 1855 producirt 61,453,079 Tonnen Kohlen zum Werth von 16,113,267 Pfd. St., 1864 : 92,787,873 Tonnen zum Werth von 23,197,968 Pfd. St., 1855 : 3,218,154 Tonnen Roheisen zum Werth von 8,045,385 Pfd. St., 1864: 4,767,951 Tonnen zum Werth von 11,919,877 Pfd. St. 1854 betrug die Länge der im Vereinigten Königreich eröffneten Eisenbahnen 8054 Meilen, mit aufgezahltem Kapital von 286,068,794 Pfd. St., 1864 die Meilenlänge 12,789 mit aufgezahltem Kapital von 425,719,613 Pfd. St. 1854 betrug Gesammtexport und Import des Vereinigten Königreichs 268,210,145 Pfd. St., 1865: 489,923,285. Folgende Tabelle zeigt die Bewegung des Exports:
Man begreift, nach diesen wenigen Angaben, den Triumphschrei des Generalregistrators des brit. Volks: „ Rasch wie die Bevölkerung anwuchs, hat sie nicht Schritt gehalten mit dem Fortschritt der Industrie und des Reichthums“(FN 101). Wenden wir uns jetzt zu den unmittelbaren Agenten dieser Industrie oder den Producenten dieses Reichthums, zur Arbeiterklasse. „Es ist einer der melancholischsten Charakterzüge im socialen Zustand des Landes“, sagt Gladstone, „dass mit einer Abnahme in der Konsumtionsmacht des Volks und einer Zunahme in den Entbehrungen und dem Elend der arbeitenden Klasse, gleichzeitig eine beständige Accumulation von Reichthum in den höheren Klassen und ein beständiger Anwachs von Kapital stattfinden“(FN 102). Der berühmte Mini-
ster erklärte diess dem Hause der Gemeinen am 14. Februar 1843. Am 16. April 1863, zwanzig Jahre später, in der Rede, worin er sein Budget vorlegt: „Von 1842 bis 1852 wuchs das besteuerbare Einkommen dieses Landes um 6 % … In den 8 Jahren von 1853 bis 1861 wuchs es, wenn wir von der Basis von 1853 ausgehn, um 20 %. Die Thatsache ist so erstaunlich, dass sie beinahe unglaublich ist … Diese berauschende Vermehrung von Reichthum und Macht ist ganz und gar auf die Klassen des Eigenthums beschränkt, aber … aber, sie muss von indirektem Vortheil für die Arbeiterbevölkerung sein, weil sie die Artikel der allgemeinen Konsumtion verwohlfeilert — während die Reichen reicher, sind die Armen jedenfalls weniger arm geworden. Dass die Extreme der Armuth sich verändert haben, wage ich nicht zu sagen“(FN 103). Welch lahmer Antiklimax! Wenn die Arbeiterklasse „arm“ geblieben ist, nur „weniger arm“ im Verhaltniss, worin sie eine „berauschende Vermehrung von Reichthum und Macht“ für die Klasse des Eigenthums producirte, so ist sie relativ gleich arm geblieben. Wenn die Extreme der Armuth sich nicht vermindert haben, haben sie sich vermehrt, weil die Extreme des Reichthums. Was die Verwohlfeilerung der Lebensmittel betrifft, so zeigt die officielle Statistik, z. B. die Angaben des London Orphan Asylum, eine Vertheurung von 20 % für den Durchschnitt der drei Jahre von 1860—1862, verglichen mit 1851—1853. In den folgenden 3 Jahren 1863—1865 progressive Vertheurung von Fleisch, Butter, Milch, Zucker,
Salz, Kohlen und einer Masse andrer nothwendiger Lebensmittel(FN 104). Gladstone’s folgende Budgetrede, vom 7. April 1864, ist ein pindarischer Dithyrambus auf den Fortschritt der Plusmacherei und das durch „Armuth“ gemässigte Glück des Volks. Er spricht von Massen „am Rand des Pauperismus“, von den Geschäftszweigen, „worin der Lohn nicht gestiegen“, und fasst schliesslich das Glück der Arbeiterklasse zusammen in den Worten: „das menschliche Leben ist in neun Fällen von 10 ein blosser Kampf um die Existenz“(FN 105). Professor Fawcett, nicht wie Gladstone durch officielle Rücksicht gebunden, erklärt rund heraus: „Ich läugne natürlich nicht, dass der Geldlohn mit dieser Vermehrung des Kapitals (in den letzten Decennien) gestiegen ist, aber dieser scheinbare Vortheil geht in grossem Umfang wieder verloren, weil viele Lebensnothwendigkeiten beständig theurer werden (er glaubt, wegen Werthfall der edlen Metalle) … Die Reichen werden rasch reicher („the rich grow rapidly richer“), während keine Zunahme im Komfort der arbeitenden Klassen wahrnehmbar ist … Die Arbeiter werden fast Sklaven der Krämer, deren Schuldner sie sind“(FN 106).
Der Leser hat in den Abschnitten über den „Arbeitstag“ und die „Maschinerie“ die Bedingungen kennen gelernt, unter welchen die britische Arbeiterklasse während der letzten Decennien die „berauschende Vermehrung von Reichthum und Macht“ für die Klassen des Eigenthums pro-
ducirt hat. Jedoch beschäftigte uns damals vorzugsweise der Arbeiter innerhalb des Produktionsprozesses selbst. Zur gründlichen Einsicht in das Gesetz der kapitalistischen Accumulation ist es nöthig einen Augenblick bei der Lage des Arbeiters ausserhalb jenes Prozesses, bei seinen Nahrungsund Wohnungszuständen zu verweilen. Die Grenze dieses Buchs gebietet mir hier namentlich den schlechtbezahlten Theil der industriellen Arbeiter und den Agrikulturarbeiter ins Auge zu fassen, welche zusammen die Majorität der Arbeiterklasse bilden(FN 107).
Vorher noch ein Wort über den officiellen Pauperismus, d. h. den Theil der Arbeiterklasse, der seine Existenzbedingung, Verkauf der Arbeitskraft, eingebüsst hat und von öffentlichem Almosen vegetirt. Die officielle Pauperliste zählte in England(FN 108) 1855: 851,369 Personen, 1856: 877,767, 1865: 971,433. In Folge der Baumwollnoth schwoll sie in den Jahren 1863 und 1864 zu 1,079,382 und 1,014,978. Die Krise von 1866, die London am schwersten traf, schuf in diesem Sitz des Weltmarkts, einwohnerreicher als das Königreich Schottland, für 1866 einen Pauperzuwachs um 19.5 %, verglichen mit 1865, und um 24.4 %, verglichen mit 1864, einen noch grössern Zuwachs für die ersten Monate von 1867, verglichen mit 1866. Bei Analyse der Pauperstatistik sind zwei Punkte hervorzuheben. Einerseits spiegelt die Bewegung im Ab und Zu der Paupermasse die Periodenwechsel des industriellen Cyklus wieder. Andrerseits wird die officielle Pauperstatistik ein mehr und mehr trüglicher Index des wirklichen Pauperismus im Grad, worin mit der Accumulation des Kapitals der Klassenkampf und daher das Selbstgefühl der Arbeiter sich entwickeln. Z. B. die Barbarei in der Behandlung der Paupers, worüber die englische Presse ( Times, Pall Mall Gazette u. s. w.) während der letzten zwei Jahre so laut schrie, ist alten Datums. F. Engels konstatirt 1844 ganz dieselben Greuel und ganz dasselbe vorübergehende, zur „Sen-
sationliteratur“ gehörige Geschrei. Aber die furchtbare Zunahme des Hungertods („deaths of starvation“) in London, während des letzten Decenniums, beweist unbedingt den zunehmenden Abscheu der Arbeiter vor der Sklaverei des Workhouse, dieser Strafanstalt des Elends.
Wenden wir uns jetzt zu den schlechtbezahlten Schichten der industriellen Arbeiterklasse. Während der Baumwollnoth, 1862, wurde Dr. Smith vom Privy Council mit einer Untersuchung über den Nahrungsstand der verkümmernden Baumwollarbeiter in Lancashire und Cheshire beauftragt. Langjährige frühere Beobachtung hatte ihn zum Resultat geführt, dass „um Hungerkrankheiten („starvation diseases“) zu vermeiden“, die tägliche Nahrung eines DurchschnittsFrauenzimmers mindestens 3,900 Gran Kohlenstoff mit 180 Gran Stickstoff enthalten müsse, die tägliche Nahrung eines Durchschnitts-Mannes mindestens 4,300 Gran Kohlenstoff mit 200 Gran Stickstoff, für die Frauenzimmer ungefähr so viel Nahrungsstoff als in zwei Pfund gutem Weizenbrod enthalten ist, für Männer ⅑ mehr, für den Wochendurchschnitt von weiblichen und männlichen Erwachsnen, mindestens 28,600 Gran Kohlenstoff und 1330 Gran Stickstoff. Seine Berechnung ward in überraschender Weise praktisch dadurch bestätigt, dass sie im Ganzen übereinstimmte mit der kümmerlichen Nahrungsmenge, worauf der Nothstand die Konsumtion der Baumwollarbeiter herabgedrückt hatte. Sie erhielten im December 1862: 29,211 Gran Kohlenstoff und 1295 Gran Stickstoff wöchentlich.
Im Jahre 1863 verordnete der Privy Council eine Untersuchung über den Nothstand des schlechtgenährtesten Theils der englischen Arbeiterklasse. Dr. Simon, der ärztliche Beamte des Privy Council, erkieste zu dieser Arbeit den obenerwähnten Dr. Smith. Seine Untersuchung erstreckt sich auf die Agrikulturarbeiter einerseits, andrerseits auf Seidenweber, Nätherinnen, Lederhandschuhmacher, Strumpfwirker, Handschuhweber und Schuster. Die letzteren Kategorieen sind, mit Ausnahme der Strumpfwirker, ausschliesslich städtisch. Es wurde zur Regel der Untersuchung gemacht, die gesundesten und relativ bestgestellten Familien in jeder Kategorie auszuwählen.
Als allgemeines Resultat ergab sich, dass „nur in einer der untersuchten Klassen der städtischen Arbeiter die Zufuhr von Stickstoff das absolute Minimalmass, unter welchem Hungerkrankheiten eintreten,
ein wenig überschritt, dass in zwei Klassen Mangel, und zwar in der einen sehr grosser Mangel, sowohl an der Zufuhr von stickstoffals kohlenstoffhaltiger Nahrung stattfand, dass von den untersuchten Ackerbaufamilien mehr als ein Fünftheil weniger als die unentbehrliche Zufuhr von kohlenstoffhaltiger Nahrung erhielt, mehr als ⅓ weniger als die unentbehrliche Zufuhr stickstoffhaltiger Nahrung, und dass in drei Grafschaften (Berkshire, Oxfordshire und Somersetshire) Mangel an dem Minimum der stickstoffhaltigen Nahrung durchschnittlich herrschte“(FN 109). Unter den Agrikulturarbeitern waren die von England, dem reichsten Theile des Vereinigten Königreichs, die schlechtest genährten(FN 110). Die Unternahrung fiel unter den Landarbeitern überhaupt hauptsächlich auf Frau und Kinder, denn „der Mann muss essen, um sein Werk zu verrichten“. Noch grösserer Mangel wüthete unter den untersuchten städtischen Arbeiterkategorieen. „Sie sind so schlecht genährt, dass viele Fälle grausamer und gesundheitsruinirender Entbehrung („ Entsagung“ des Kapitalisten alles diess! nämlich Entsagung auf Zahlung der zur blossen Vegetation seiner Hände unentbehrlichen Lebensmittel!) vorkommen müssen“(FN 111).
Folgende Tabelle zeigt das Verhältniss des Nahrungsstandes der oben erwähnten rein städtischen Arbeiterkategorieen zu dem von Dr. Smith angenommenen Minimalmass und zum Nahrungsmass der Baumwollarbeiter während der Zeit ihrer grössten Noth:
Eine Hälfte, , der untersuchten industriellen Arbeiterkategorieen
erhielt absolut kein Bier, 28 % keine Milch. Der Wochendurchschnitt der flüssigen Nahrungsmittel in den Familien schwankte von 7 Unzen bei den Nätherinnen auf 24¾ Unzen bei den Strumpfwirkern. Die Mehrzahl derer, die keine Milch erhielten, bestand aus den Nätherinnen von London. Die Quantität der wöchentlich konsumirten Brodstoffe wechselte von 7¾ Pfund bei den Nätherinnen zu 11¼ Pfund bei den Schustern und ergab einen Totaldurchschnitt von 9.9 Pfund wöchentlich auf den Erwachsenen. Zucker (Syrup u. s. w.) wechselte von 4 Unzen wöchentlich für die Lederhandschuhmacher auf 11 Unzen für Strumpfwirker; der Totaldurchschnitt per Woche für alle Kategorieen, per Erwachsenen, 8 Unzen. Gesammter Wochendurchschnitt von Butter (Fett u. s. w.) 5 Unzen per Erwachsenen. Der Wochendurchschnitt von Fleisch (Speck u. s. w.) schwankte, per Erwachsenen, von 7¼ Unzen bei den Seidenwebern auf 18¼ Unzen bei den Lederhandschuhmachern; Gesammtdurchschnitt für die verschiedenen Kategorieen 13.6 Unzen. Die wöchentliche Kost für Nahrung per Erwachsenen ergab folgende allgemeine Durchschnittszahlen: Seidenweber 2 sh. 2½ d., Nätherinnen 2 sh. 7 d., Lederhandschuhmacher 2 sh. 9½ d., Schuster 2 sh. 7¾ d., Strumpfwirker 2 sh. 6¼ d. Für die Seidenweber von Macclesfield betrug der Wochendurchschnitt nur 1 sh. 8½ d. Die schlecht genährtesten Kategorieen waren die Nätherinnen, die Seidenweber und die Lederhandschuhmacher(FN 113).
Dr. Simon sagt in seinem allgemeinen Gesundheitsbericht über diesen Nahrungszustand: „Dass die Fälle zahllos sind, worin Nahrungsmangel Krankheiten erzeugt oder erschwert, wird Jeder bestätigen, der mit medizinischer Armenpraxis oder mit den Patienten der Spitäler, seien sie Insassen oder ausserhalb wohnend, vertraut ist … Jedoch kommen hier vom sanitären Standpunkt noch andre, sehr entscheidende Umstände hinzu … Man muss sich erinnern, dass Beraubung an Nahrungsmitteln nur sehr widerstrebsam ertragen wird, und dass in der Regel grosse Dürftigkeit der Diät nur im Gefolge andrer, vorhergegangner Entbehrungen nachhinkt. Lange bevor der Nahrungsmangel hygienisch ins Gewicht fällt, lange bevor der Physiolog daran denkt, die Grane Stickstoff und Kohlenstoff zu zählen, zwischen denen Leben und Hungertod
schwebt, wird der Haushalt von allem materiellen Komfort ganz und gar entblösst sein. Kleidung und Heizung werden noch dürftiger gewesen sein als die Speise. Kein hinreichender Schutz wider die Härte des Wetters; Abknappung des Wohnraums zu einem Grad, der Krankheiten erzeugt oder erschwert; kaum eine Spur von Hausgeräth oder Möbeln; die Reinlichkeit selbst wird kostspielig oder schwierig geworden sein. Werden noch aus Selbstachtung Versuche gemacht, sie aufrecht zu erhalten, so repräsentirt jeder solcher Versuch zuschüssige Hungerpein. Die Häuslichkeit wird dort sein, wo Obdach am wohlfeilsten kaufbar; in Quartieren, wo die Gesundheitspolizei die geringste Frucht trägt, das jämmerlichste Gerinne, wenigster Verkehr, der meiste öffentliche Unrath, kümmerlichste oder schlechteste Wasserzufuhr, und, in Städten, grösster Mangel an Licht und Luft. Diess sind die Gesundheitsgefahren, denen die Armuth unvermeidlich ausgesetzt ist, wenn diese Armuth Nahrungsmangel einschliesst. Wenn die Summe dieser Uebel von furchtbarer Grösse für das Leben ist, so ist der blosse Nahrungsmangel an sich selbst entsetzlich … Diess sind qualvolle Gedanken, namentlich wenn man sich erinnert, dass die Armuth, wovon es sich handelt, nicht die selbstverschuldete Armuth des Müssiggangs ist. Es ist die Armuth von Arbeitern. Ja, mit Bezug auf die städtischen Arbeiter, ist die Arbeit, wodurch der knappe Bissen Nahrung erkauft wird, meist über alles Mass verlängert. Und dennoch kann man nur in sehr bedingtem Sinn sagen, dass diese Arbeit selbsterhaltend ist. … Auf sehr grossem Massstab kann der nominelle Selbsterhalt nur ein kürzerer oder längerer Umweg zum Pauperismus sein“(FN 114).
Das innere Band zwischen Hungerpein der fleissigsten Arbeiterschichten und kapitalistischer Accumulation, nebst dem sie begleitenden groben oder raffinirten Ueberkonsum der Reichen, diess Band, sage ich, sieht nur der Kenner der ökonomischen Gesetze. Anders mit dem Wohnungszustand. Jeder unbefangne Beobachter sieht, dass je massenhafter die Koncentration der Produktionsmittel, desto grösser die entsprechende Agglomeration von Arbeitern auf geringem Raum, dass daher je rascher die kapitalistische Accumulation, desto elender der Wohnungszustand der Arbeiter. Jeder sieht, dass die das Wachsthum des Reichthums begleitenden Verbesserungen der Städte (improve-
ments) durch Niederreissung der schlechtgebauten Viertel, Errichtung von Palästen für Banken, Waarenhäuser u. s. w., Dehnung der Strassen für Geschäftsverkehr und Luxuskarossen, Einführung städtischer Eisenbahnen u. s. w. mit Verjagung der Armen in stets schlechtere und dichter gefüllte Schlupfwinkel verknüpft sind. Andrerseits weiss jeder, dass die Theuerkeit der Wohnungen im umgekehrten Verhältniss zu ihrer Güte steht und dass die Minen des Elends von Spekulanten mit mehr Profit und weniger Kosten ausgebeutet werden als jemals die Minen von Potosi. Der antagonistische Charakter der kapitalistischen Accumulation und daher der kapitalistischen Eigenthumsverhältnisse überhaupt(FN 115) wird hier so handgreifbar, dass selbst die officiellen englischen Berichte über diesen Gegenstand voll heterodoxer Ausfälle auf das „Eigenthum und seine Rechte sind“. Das Uebel hielt solchen Schritt mit der Entwicklung der Industrie, der Accumulation des Kapitals, dem Wachsthum und der „Verschönerung“ der Städte, dass die blosse Furcht vor ansteckenden Krankheiten, welche auch der „Ehrbarkeit“ nicht schonen, von 1847 bis 1864 nicht weniger als 10 gesundheitspolizeiliche Parlamentsakte ins Leben rief, und dass die erschreckte Bürgerschaft in einigen Städten wie Liverpool, Glasgow u. s. w. durch ihre Municipalitäten eingriff. Dennoch, ruft Dr. Simon in seinem Bericht von 1865: „Allgemein zu sprechen, sind die Uebelstände in England unkontrolirt.“ Auf Befehl des Privy Council fand 1864 Untersuchung über die Wohnungsverhältnisse der Landarbeiter, 1865 über die der ärmeren Klassen in den Städten statt. Die meisterhaften Arbeiten des Dr. Julian Hunter findet man im siebenten (1865) und achten (1866) Bericht über „Public Health“. Auf die Landarbeiter komme ich später. Ueber den städtischen Wohnungszustand schicke ich eine allgemeine Bemerkung des Dr. Simon voraus: „Obgleich mein officieller Gesichtspunkt“, sagt er, „ausschliesslich physisch ist, erlaubt die gewöhnlichste Humanität nicht die andre Seite dieses Uebels zu ignoriren. In seinem höheren Grad bedingt es fast noth-
wendig eine solche Negation aller Delikatesse, so schmutzige Konfusion von Körpern und körperlichen Verrichtungen, solche Blossstellung geschlechtlicher Nacktheit, die bestial, nicht menschlich sind. Diesen Einflüssen unterworfen zu sein ist eine Degradation, die sich vertieft, je länger sie fortwirkt. Für die Kinder, die unter diesem Fluch geboren sind, ist er Taufe in Infamie („ baptism into infamy“). Und über alles Mass hoffnungslos ist der Wunsch, dass unter solche Umstände gestellte Personen in andern Rücksichten nach jener Atmosphäre der Civilisation aufstreben sollten, die ihr Wesen in physischer und moralischer Reinheit besitzt“(FN 116).
Den ersten Rang in überfüllten oder auch für menschliche Behausung absolut unmöglichen Wohnlichkeiten nimmt London ein. „Zwei Punkte“, sagt Dr. Hunter, „sind sicher; erstens, dass es ungefähr 20 grosse Kolonieen in London giebt, jede ungefähr 10,000 Personen stark, deren elende Lage alles übersteigt, was jemals anderswo in England gesehn worden ist, und sie ist fast ganz das Resultat ihrer schlechten Hausaccommodation; und zweitens, dass der überfüllte und verfallene Zustand der Häuser dieser Kolonieen viel schlechter ist als 20 Jahre zuvor“(FN 117). „Es ist nicht zu viel zu sagen, dass das Leben in vielen Theilen von London und Newcastle infernal ist“(FN 118).
Auch der besser gestellte Theil der Arbeiterklasse, zusammt Kleinkrämern und andern Elementen der kleinen Mittelklasse, fällt in London mehr und mehr unter den Fluch dieser nichtswürdigen Behausungsverhältnisse, im Masse, wie die „Verbesserungen“ und mit ihnen die Niederreissung alter Strassen und Häuser fortschreiten, wie Fabriken und Menschenzustrom in der Metropole wachsen, endlich die Hausmiethen mit der städtischen Grundrente steigen. „Die Hausmiethen sind so übermässig geworden, dass
wenige Arbeiter mehr als ein Zimmer zahlen können“(FN 119). Es giebt fast kein Londoner Hauseigenthum, das nicht mit einer Unzahl von „middlemen“ belastet wäre. Der Preis des Bodens in London steht nämlich stets sehr hoch im Vergleich zu seinen jährlichen Einkünften, indem jeder Käufer darauf spekulirt früher oder später zu einem Jury Price (durch Geschworne festgesetzte Taxe bei Expropriationen) wieder loszuschlagen oder durch Nähe irgend eines grossen Unternehmens ausserordentliche Wertherhöhung zu erschwindeln. Folge davon ist ein regelmässiger Handel im Ankauf von Miethkontrakten, die ihrem Verfall nahen. „Von den Gentlemen in diesem Geschäft kann man erwarten, dass sie handeln, wie sie handeln, so viel wie möglich aus den Hausbewohnern herausschlagen, und das Haus selbst in so schlechtem Zustand wie möglich ihren Nachfolgern überlassen“(FN 120). Die Miethen sind wöchentlich und die Herren laufen kein Risico. In Folge der Eisenbahnbauten innerhalb der Stadt „sah man kürzlich im Osten Londons eine Anzahl aus ihren alten Wohnungen verjagter Familien umherwandern eines Samstags Abends mit ihren wenigen weltlichen Habseligkeiten auf dem Rücken, ohne irgend einen Haltplatz ausser dem Workhouse“(FN 121). Die Workhouses sind bereits überfüllt und die vom Parlament bereits bewilligten „improvements“ sind erst im Beginn ihrer Ausführung. Werden die Arbeiter verjagt durch Zerstörung ihrer alten Häuser, so verlassen sie nicht ihr Kirchspiel, oder siedeln sich höchstens an seiner Grenze, im nächsten fest. „Sie suchen natürlich möglichst in der Nähe ihrer Arbeitslokale zu hausen. Folge, dass an die Stelle von zwei Zimmern, eins die Familie aufnehmen muss. Selbst zu erhöhter Miethe wird die Wohnlichkeit schlechter als die schlechte, woraus man sie verjagt. Die Hälfte der Arbeiter im Strand braucht bereits zwei Meilen Reise zum Arbeitslokal.“ Dieser Strand, dessen Hauptstrasse auf den Fremden einen imposanten Eindruck vom Reichthum Londons macht, kann als Beispiel der Londoner Menschenverpackung dienen. In einer Pfarrei desselben zählte der Gesundheitsbeamte 581 Personen auf den Acre, obgleich die Hälfte der Themse mit eingemessen war. Es versteht sich von selbst,
dass jede gesundheitspolizeiliche Massregel, die, wie das bisher in London der Fall, durch Niederschleifen untauglicher Häuser die Arbeiter aus einem Viertel verjagt, nur dazu dient sie in ein andres desto dichter zusammen zu drängen. „Entweder“, sagt Dr. Hunter, „muss die ganze Procedur als eine Abgeschmacktheit nothwendig zum Stillstand kommen, oder die öffentliche Sympathie(!) muss erwachen für das, was man jetzt ohne Uebertreibung eine nationale Pflicht nennen kann, nämlich Obdach für Leute zu verschaffen, welche aus Mangel an Kapital sich selbst keins verschaffen können, obgleich sie durch periodische Zahlung die Vermiether belohnen können“(FN 122). Man bewundre die kapitalistische Justiz! Der Grundeigenthümer, Hauseigner, Geschäftsmann, wenn expropriirt durch „improvements“, wie Eisenbahnen, Neubau der Strassen u. s. w., erhält nicht nur volle Entschädigung. Er muss für seine erzwungne „Entsagung“ von Gott und Rechtswegen obendrein noch durch einen erklecklichen Profit getröstet werden. Der Arbeiter wird mit Frau und Kind und Habe aufs Pflaster geworfen und — wenn er zu massenhaft nach Stadtvierteln drängt, wo die Municipalität auf Anstand hält, gesundheitspolizeilich verfolgt!
Ausser London gab es Anfang des 19. Jahrhunderts keine einzige Stadt in England, die 100,000 Einwohner zählte. Nur 5 zählten mehr als 50,000. Jetzt existiren 28 Städte mit mehr als 50,000 Einwohnern. „Das Resultat dieses Wechsels war nicht nur enormer Zuwachs der städtischen Bevölkerung, sondern die alten dichtgepackten kleinen Städte sind nun Centra, die von allen Seiten umbaut sind, nirgendwo mit freiem Luftzutritt. Da sie für die Reichen nicht länger angenehm sind, werden sie von ihnen für die amüsanteren Vorstädte verlassen. Die Nachfolger dieser Reichen beziehn die grösseren Häuser, eine Familie, oft noch mit Untermiethern, für jedes Zimmer. So ward eine Bevölkerung gedrängt in Häuser, nicht für sie bestimmt, und wofür sie durchaus unpassend, mit einer Umgebung, die wahrhaft erniedrigend für die Erwachsnen und ruinirend für die Kinder ist“(FN 123). Je rascher das Kapital in einer industriellen oder commerciellen Stadt accumulirt, um so rascher der Zustrom des exploitablen Menschenmaterials, um so elender die improvisirten Wohnlichkeiten der
Arbeiter. Newcastle-upon-Tyne, als Centrum eines fortwährend ergiebigeren Kohlenund Bergwerksbaudistrikts, behauptet daher nach London die zweite Stelle in dem Wohnung sinferno. Nicht minder als 34,000 Menschen hausen dort in Einzelkammern. In Folge absoluter Gemeinschädlichkeit sind kürzlich in Newcastle und Gateshead Häuser in bedeutender Anzahl von Polizei wegen zerstört worden. Der Bau der neuen Häuser geht sehr langsam voran, das Geschäft sehr rasch. Die Stadt war daher 1865 überfüllter als je zuvor. Kaum eine einzelne Kammer war zu vermiethen. Dr. Embleton vom Newcastle Fieberhospital sagt: „Ohne allen Zweifel liegt die Ursache der Fortdauer und Verbreitung des Typhus in der Ueberhäufung menschlicher Wesen und der Unreinlichkeit ihrer Wohnungen. Die Häuser, worin die Arbeiter häufig leben, liegen in abgeschlossnen Winkelgassen und-Höfen. Sie sind mit Bezug auf Licht, Luft, Raum und Reinlichkeit wahre Muster von Mangelhaftigkeit und Ungesundheit, eine Schmach für jedes civilisirte Land. Dort liegen Männer, Weiber und Kinder des Nachts zusammengehudelt. Was die Männer angeht, folgt die Nachtreihe der Tagesreihe in ununterbrochenem Strom, so dass die Betten kaum Zeit zur Abkühlung finden. Die Häuser sind schlecht mit Wasser versehn und schlechter mit Abtritten, unfläthig, unventilirt, pestilenzialisch“(FN 124). Der Wochenpreis solcher Löcher steigt von 8 d. zu 3 sh. „Newcastle-upon-Tyne“, sagt Dr. Hunter, „bietet das Beispiel eines der schönsten Stämme unsrer Landsleute, der durch die äussern Umstände von Behausung und Strasse oft in eine beinah wilde Degradation versunken ist“(FN 125).
In Folge des Hinund Herwogens von Kapital und Arbeit mag der Wohnungszustand einer industriellen Stadt heute erträglich sein, morgen ist er abominabel. Oder die städtische Aedilität mag endlich sich aufgerafft haben zur Beseitigung der ärgsten Missstände. Morgen wandert ein Heuschreckenschwarm von verlumpten Irländern oder verkommenen englischen Agrikulturarbeitern ein. Man steckt sie weg in Keller und Speicher oder verwandelt das früher respektable Arbeiterhaus in ein Logis, worin das Personal so rasch wechselt wie die Einquartirung während des dreissigjährigen Kriegs. Beispiel: Bradford. Dort war der Municipal-
philister eben mit Stadtreform beschäftigt. Zudem gab es daselbst 1861 noch 1751 unbewohnte Häuser. Aber nun das gute Geschäft, worüber der sanft liberale Herr Forster, der Negerfreund, jüngst so artig gekräht hat. Mit dem guten Geschäft natürlich Ueberfluthung von den Wellen der stets wogenden „Reservearmee“ oder „relativen Surpluspopulation“. Die scheusslichen Kellerwohnungen und Kammern, in der Note beschrieben(FN 126) durch eine dem Dr. Hunter vom Agenten einer Assekuranzgesellschaft ausgefertigte Liste, waren meist von gutbezahlten Arbeitern bewohnt. Sie erklärten, sie würden gern bessere Wohnungen zahlen, wenn sie zu haben wären. Unterdess verlumpen und verkranken sie mit Mann und Maus, während der sanftliberale Forster, M P., Thränen vergiesst über die Segnungen des Freihandels und die Profite der eminenten Bradforder Köpfe, die in Worsted machen. Im Bericht vom 5. September 1865 erklärt Dr. Bell, einer der Armenärzte von Bradford, die furchtbare
Sterblichkeit der Fieberkranken seines Bezirks aus ihren Wohnungsverhältnissen: „In einem Keller von 1500 Kubikfuss wohnen 10 Personen … Die Vincentstrasse, Green Air Place und the Leys bergen 223 Häuser mit 1450 Einwohnern, 435 Betten und 36 Abtritten … Die Betten, und darunter verstehe ich jede Rolle von schmutzigen Lumpen oder Handvoll von Hobelspänen, halten jedes per Durchschnitt 3.3 Personen, manches 4 und 6 Personen. Viele schlafen ohne Bett auf nacktem Boden in ihren Kleidern, junge Männer und Weiber, verheirathet und unverheirathet, alles kunterbunt durch einander. Ist es nöthig hinzuzufügen, dass diese Hausungen meist dunkle, feuchte, schmutzige Stinkhöhlen sind, ganz und gar unpassend für menschliche Wohnung? Es sind die Centra, wovon Krankheit und Tod ausgehn und ihre Opfer auch unter den Gutgestellten („of good circumstances“) packen, welche diesen Pestbeulen erlaubt haben in unsrer Mitte zu eitern“(FN 127).
Bristol behauptet den dritten Rang nach London im Wohnungselend. „Hier, in einer der reichsten Städte Europa’s, grösster Ueberfluss an baarster Armuth („blank poverty“) und häuslicher Misère“(FN 128).
Wir wenden uns nun zu einer Wandervölkerung, deren Quelle ländlich, deren Beschäftigung grossentheils industriell ist. Es ist die leichte Infanterie des Kapitals, je nach seinem Bedürfniss bald auf diesen Punkt geworfen, bald auf jenen. Wenn nicht auf dem Marsch, „campirt“ sie. Die Wanderarbeit wird verbraucht für verschiedne Bauund Drainirungsoperationen, Backsteinmachen, Kalkbrennen, Eisenbahnen u. s. w. Eine wandelnde Säule der Pestilenz importirt sie in die Orte, in deren Nachbarschaft sie ihr Lager aufschlägt, Pocken, Typhus, Cholera, Scharlachfieber u. s. w.(FN 129). In Unternehmen von bedeutender Kapitalauslage, wie Eisenbahnbau u. s. w., liefert meist der Unternehmer selbst seiner Armee Holzhütten oder dgl., improvisirte Dörfer ohne alle Gesundheitsvorkehrung, jenseits der Kontrole der Lokalbehörden, sehr profitlich für den Herrn Contractor, der die Arbeiter doppelt ausbeutet, als Industriesoldaten und als Miether. Je nachdem die Holzhütte 1, 2 oder 3 Löcher enthält, hat ihr Insasse, Erdarbeiter u. s. w., 1, 3, 4 sh. wöchentlich zu
zahlen(FN 130). Ein Beispiel genüge. Im September 1864, berichtet Dr. Simon, ging dem Minister des Innern, Sir George Grey, folgende Denunciation Seitens des Vorstehers des Nuisance Removal Committee der Pfarrei von Sevenoaks zu: „Pocken waren dieser Pfarrei fast ganz unbekannt bis etwa vor 12 Monaten. Kurz vor dieser Zeit wurden Arbeiten für eine Eisenbahn von Lewisham nach Tunbridge eröffnet. Ausserdem dass die Hauptarbeiten in der unmittelbaren Nachbarschaft dieser Stadt ausgeführt wurden, ward hier auch das Hauptdepot des ganzen Werks errichtet. Grosse Personenzahl daher hier beschäftigt. Da es unmöglich war sie alle in Cottages unterzubringen, liess der Contractor, Herr Jay, längst der Linie der Bahn auf verschiednen Punkten Hütten aufschlagen zur Behausung der Arbeiter. Diese Hütten besassen weder Ventilation noch Abzugsgerinne und waren ausserdem nothwendig überfüllt, weil jeder Miether andre Logirer aufnehmen musste, wie zahlreich immer seine eigne Familie, und obgleich jede Hütte nur zweizimmerig. Nach dem ärztlichen Bericht, den wir erhielten, war die Folge, dass diese armen Leute zur Nachtzeit alle Qualen der Erstickung zu erdulden hatten, zur Vermeidung der pestilenzialischen Dünste von dem schmutzigen stehenden Wasser und den Abtritten dicht unter den Fenstern. Endlich wurden unsrem Comité Klagen eingehändigt von einem Arzte, der Gelegenheit hatte diese Hütten zu besuchen. Er sprach über den Zustand dieser s. g. Wohnlichkeiten in den bittersten Ausdrücken und befürchtete sehr ernsthafte Folgen, falls nicht einige Gesundheitsvorkehrungen getroffen würden. Ungefähr vor einem Jahr verpflichtete sich p. p. Jay ein Haus einzurichten, wohin die von ihm beschäftigten Personen, beim Ausbruch ansteckender Krankheiten, sofort entfernt werden sollten. Er wiederholte diess Versprechen Ende letzten Juli’s, that aber nie den geringsten Schritt zur Ausführung, obgleich seit diesem Datum verschiedne Fälle von Pocken und in Folge davon zwei Todesfälle vorkamen. Am 9. September berichtete mir Surgeon Kelson weitere Pockenfälle in denselben Hütten und beschrieb ihren Zustand als entsetzlich. Zu Ihrer (des Ministers) Information muss ich hinzufügen, dass unsre Pfarrei ein isolirtes Haus besitzt, das s. g. Pesthaus, wo die Pfarreigenossen, die von ansteckenden Krankheiten leiden, verpflegt werden. Diess Haus ist jetzt seit Monaten fort-
während mit Patienten überfüllt. In einer Familie starben fünf Kinder an Pocken und Fieber. Vom 1. April bis 1. September dieses Jahres kamen nicht weniger als 10 Todesfälle an Pocken vor, 4 in den besagten Hütten, den Pestquellen. Es ist unmöglich die Zahl der Krankheitsfälle anzugeben, da die heimgesuchten Familien sie so geheim als möglich halten“(FN 131).
Kohlenund andre Bergwerksarbeiter gehören zu den bestbezahlten Kategorieen der britischen Arbeiterklasse. Zu welchem Preis sie ihren Lohn erkaufen, wurde an einer früheren Stelle gezeigt(FN 132). Ich werfe hier einen raschen Blick auf ihre Wohnlichkeitsverhältnisse. In der Regel errichtet der Exploiteur des Bergwerks, ob Eigenthümer oder Miether desselben, eine Anzahl Cottages für seine Hände. Sie erhalten Cottages und Kohlen zur Feurung „umsonst“, d. h. letztre bilden einen in natura gelieferten Theil des Lohns. Die nicht in dieser Art Unterbringbaren erhalten zum Ersatz 4 Pfd. St. per Jahr. Die Bergwerksdistrikte ziehn rasch eine grosse Bevölkerung an, zusammengesetzt aus der Minenbevölkerung selbst und den Handwerkern, Krämern u. s. w., die sich um sie gruppiren. Wie überall, wo die Bevölkerung dicht, ist die Bodenrente hier hoch. Der Bergbauunternehmer sucht daher auf möglichst engem Bauplatz am Mund der Minen so viel Cottages aufzuwerfen als grade nöthig sind um seine Hände und ihre Familien zusammenzupacken. Werden neue Minen in der Nähe eröffnet oder alte wieder in Angriff genommen, so wächst das Gedränge. Bei der Konstruktion der Cottages waltet nur ein Gesichtspunkt, „ Entsagung“ des Kapitalisten auf alle nicht absolut unvermeidliche Ausgaben von Baarem. „Die Wohnungen der Grubenund andrer Arbeiter, die mit den Bergwerken von Northumberland und
Durham verknüpft sind,“ sagt Dr. Julian Hunter, „sind vielleicht im Durchschnitt das Schlechteste und Theuerste, was England auf grosser Stufenleiter in dieser Art bietet, mit Ausnahme jedoch ähnlicher Distrikte in Monmouthshire. Die extreme Schlechtigkeit liegt in der hohen Menschenzahl, die ein Zimmer füllen, in der Enge des Bauplatzes, worauf eine grosse Häusermasse geworfen wird, im Wassermangel und Abwesenheit von Abtritten, in der häufig angewandten Methode ein Haus über ein andres zu stellen oder sie in flats (so dass die verschiednen Cottages horizontal über einander liegende Stockwerke bilden) zu vertheilen … Der Unternehmer behandelt die ganze Kolonie, als ob sie nur campire, nicht residire“(FN 133). „In Ausführung meiner Instruktionen,“ sagt Dr. Stevens, „habe ich die meisten grossen Bergwerksdörfer der Durham Union besucht … Mit sehr wenigen Ausnahmen gilt von allen, dass jedes Mittel zur Sicherung der Gesundheit der Einwohner vernachlässigt wird … Alle Grubenarbeiter sind an den Pächter („lessee“) oder Eigenthümer des Bergwerks für 12 Monate gebunden („bound“, Ausdruck, der wie bondage aus der Zeit der Leibeigenschaft stammt). Wenn sie ihrer Unzufriedenheit Luft machen oder in irgend einer Art den Aufseher („viewer“) belästigen, so setzt er eine Marke oder ein Memorandum hinter ihre Namen in seinem Aufsichtsbuch, und entlässt sie bei der jährlichen Neu-Bindung … Es scheint mir, dass kein Theil des Trucksystems schlechter sein kann als das in diesen dichtbevölkerten Distrikten herrschende. Der Arbeiter ist gezwungen als Theil seines Lohns ein mit pestilenzialischen Einflüssen umgebnes Haus zu empfangen. Er kann sich nicht selbst helfen. Erist in jeder Rücksicht ein Leibeigner („ he is to all intents and purposesaserf“). Es scheint fraglich, ob jemand sonst ihm helfen kann ausser seinem Eigenthümer und dieser Eigenthümer zieht vor allem sein Bilanzkonto zu Rath, und das Resultat ist ziemlich unfehlbar. Der Arbeiter erhält von dem Eigenthümer auch seine Zufuhr an Wasser. Es sei gut oder schlecht, es werde geliefert oder zurückgehalten, er muss dafür zahlen oder sich vielmehr einen Lohnabzug gefallen lassen“(FN 134).
Im Konflikt mit der „öffentlichen Meinung“ oder auch der Gesundheitspolizei genirt sich das Kapital durchaus nicht, die theils gefährlichen,
theils entwürdigenden Bedingungen, worin es Funktion und Häuslichkeit des Arbeiters bannt, damit zu „rechtfertigen“, das sei nöthig, um ihn profitlicher auszubeuten. So, wenn es entsagt auf Vorrichtungen zum Schutz gegen gefährliche Maschinerie in der Fabrik, auf Ventilationsund Sicherheitsmittel in den Minen u. s. w. So hier mit der Behausung der Minenarbeiter. „Als Entschuldigung“, sagt Dr. Simon, der ärztliche Beamte des Privy Council, in seinem officiellen Bericht, „als Entschuldigung für die nichtswürdige Hauseinrichtung wird angeführt, dass Minen gewöhnlich pachtweise exploitirt werden, dass die Dauer des Pachtkontrakts (in Kohlenwerken meist 21 Jahre) zu kurz ist, damit der Minenpächter es der Mühe werth halte, gute Hausaccommodation für das Arbeitsvolk und die Gewerbsleute u. s. w. zu liefern, welche die Unternehmung anzieht; hätte er selbst die Absicht, nach dieser Seite hin liberal zu verfahren, so würde sie vereitelt werden durch den Grundeigenthümer. Der habe nämlich die Tendenz, sofort exorbitante Zuschussrente zu verlangen für das Privilegium, ein anständiges und komfortables Dorf auf der Grundoberfläche zu errichten zur Behausung der Bearbeiter des unterirdischen Eigenthums. Dieser prohibitorische Preis, wenn nicht direkte Prohibition, schrecke ebenfalls andre ab, welche sonst wohl bauen möchten … Ich will den Werth dieser Apologie nicht weiter untersuchen, auch nicht, auf wen denn in letzter Hand die zuschüssige Ausgabe für anständige Wohnlichkeit fallen würde, auf den Grundherrn, den Minenpächter, die Arbeiter oder das Publikum … Aber Angesichts solcher schmählichen Thatsachen, wie die beigefügten Berichte (des Dr. Hunter, Stevens u. s. w.) sie enthüllen, muss ein Heilmittel angewandt werden … Grundeigenthumstitel werden so gebraucht um ein grosses öffentliches Unrecht zu begehn. In seiner Eigenschaft als Mineneigner ladet der Grundherr eine industrielle Kolonie zur Arbeit auf seiner Domaine ein, und macht dann, in seiner Eigenschaft als Eigenthümer der Grundoberfläche, den von ihm versammelten Arbeitern unmöglich die zu ihrem Leben unentbehrliche, geeignete Wohnlichkeit zu finden. Der Minenpächter (der kapitalistische Exploiteur) hat kein Geldinteresse dieser Theilung des Handels zu widerstehn, da er wohl weiss, dass wenn die letztern Ansprüche exorbitant sind, die Folgen nicht auf ihn fallen, und dass die Arbeiter, auf die sie fallen, zu unerzogen sind, um ihre Gesundheits
rechte zu kennen, dass weder obscönste Wohnlichkeit noch faulstes Trinkwasser besondre Anlässe zu einem Strike liefern“(FN 135).
Bevor ich zu den eigentlichen Agrikulturarbeitern übergehe, soll an einem Beispiel noch gezeigt werden, wie die Krisen selbst auf den bestbezahlten Theil der Arbeiterklasse, auf ihre Aristokratie, wirken. Man erinnert sich: das Jahr 1857 brachte eine der grossen Krisen, womit der industrielle Cyklus jedesmal abschliesst. Der nächste Termin wurde 1866 fällig. Bereits diskontirt in den eigentlichen Fabrikdistrikten durch die Baumwollnoth, welche viel Kapital aus der gewohnten Anlagesphäre zu den grossen Centralsitzen des Geldmarkts jagte, nahm die Krise diessmal einen vorwiegend finanziellen Charakter an. Ihr Ausbruch im Mai 1866 wurde signalisirt durch den Fall einer Londoner Riesenbank, dem der Zusammensturz zahlloser finanzieller Schwindelgesellschaften auf dem Fuss nachfolgte. Einer der grossen Londoner Geschäftszweige, welche die Katastrophe traf, war der eiserne Schiffsbau. Die Magnaten dieses Fachs hatten während der Schwindelzeit nicht nur masslos überprodueirt, sondern zudem enorme Lieferungskontrakte übernommen, auf die Spekulation hin, dass die Kreditquelle gleich reichlich fort fliessen werde. Jetzt trat eine furchtbare Reaktion ein, die auch in andern Londoner Industrien(FN 136) bis zur Stunde, Ende März 1867, fortdauert. Zur Charakteristik der Lage der Arbeiter folgende Stelle aus dem ausführlichen Bericht eines
Korrespondenten des Morning Star, welcher Anfang Januar 1867 die Hauptsitze des Leidens besuchte. „Im Osten von London, den Distrikten von Poplar, Millwall, Greenwich, Deptford, Limehouse und Canning Town befinden sich mindestens 15,000 Arbeiter sammt Familien in einem Zustand äusserster Noth, darunter über 3000 geschickte Mechaniker. Ihre Reservefonds sind erschöpft in Folge sechsoder achtmonatlicher Arbeitslosigkeit … Ich hatte grosse Mühe zum Thor des Workhouse (von Poplar) vorzudringen, denn es war belagert von einem ausgehungerten Haufen. Er wartete auf Brodbillets, aber die Zeit zur Vertheilung war noch nicht gekommen. Der Hof bildet ein grosses Quadrat mit einem Pultdach, das rings um seine Mauern läuft. Dichte Schneehaufen bedeckten die Pflastersteine in der Mitte des Hofes. Hier waren gewisse kleine Plätze mit Weidengeflecht abgeschlossen, gleich Schafhürden, worin die Männer bei besserem Wetter arbeiten. Am Tage meines Besuchs waren die Hürden so verschneit, dass Niemand in ihnen sitzen konnte. Die Männer waren jedoch unter dem Schutz der Dachvorsprünge mit Macadamisirung von Pflastersteinen beschäftigt. Jeder hatte einen dicken Pflasterstein zum Sitz und klopfte mit schwerem Hammer auf den frostbedeckten Granit, bis er 5 Bushel davon abgehauen hatte. Dann war sein Tagewerk verrichtet und erhielt er 3 d. (1 Silbergroschen, 8 Pfennige) und ein Billet für Brod. In einem andern Theil des Hofes stand ein rhachitisches kleines Holzhaus. Beim Oeffnen der Thüre fanden wir es gefüllt mit Männern, Schulter an Schulter gedrängt, um einander warm zu halten. Sie zupften Schiffstau und stritten mit einander, wer von ihnen mit einem Minimum von Nahrung am längsten arbeiten könne, denn Ausdauer war der point d’honneur. In diesem einen Workhouse allein erhielten 7000 Unterstützung, darunter viele Hunderte, die 6 oder 8 Monate zuvor die höchsten Löhne geschickter Arbeit in diesem Land verdienten. Ihre Zahl wäre doppelt so gross gewesen, gäbe es nicht so viele, welche nach Erschöpfung ihrer ganzen Geldreserve dennoch vor Zuflucht zur Pfarrei zurückbeben, so lange sie noch irgend etwas zu versetzen haben … Das Workhouse verlassend, machte ich einen Gang durch die Strassen von meist einstöckigen Häusern, die in Poplar so zahlreich. Mein Führer war Mitglied des Comités für die Arbeitslosen. Das erste Haus, worin wir eintraten, war das eines Eisenarbeiters, seit 27 Wochen ausser Beschäftigung. Ich fand den Mann mit
seiner ganzen Familie in einem Hinterzimmer sitzend. Das Zimmer war noch nicht ganz von Möbeln entblösst und es war Feuer darin. Diess war nöthig, um die nackten Füsse der jungen Kinder vor Frost zu schützen, denn es war ein grimmig kalter Tag. Auf einem Teller gegenüber dem Feuer lag ein Quantum Werg, welches Frau und Kinder zupften in Erstattung des Brods vom Workhouse. Der Mann arbeitete in einem der oben beschriebenen Höfe für ein Brodbillet und 3 d. per Tag. Er kam jetzt nach Haus zum Mittagsessen, sehr hungrig, wie er uns mit einem bittern Lächeln sagte, und sein Mittagsessen bestand aus einigen Brodschnitten mit Schmalz und einer Tasse milchlosen Thees … Die nächste Thüre, an der wir anklopften, wurde geöffnet durch ein Frauenzimmer mittleren Alters, die, ohne ein Wort zu sagen, uns in ein kleines Hinterzimmer führte, wo ihre ganze Familie sass, schweigend, die Augen auf ein rasch ersterbendes Feuer geheftet. Solche Verödung, solche Hoffnungslosigkeit hing um diese Leute und ihr kleines Zimmer, dass ich nicht wünsche je eine ähnliche Scene wieder zu sehn. „Nichts haben sie verdient, mein Herr“, sagte die Frau, auf ihre Jungen zeigend, „nichts für 26 Wochen, und all unser Geld ist hingegangen, alles Geld, das ich und der Vater in den bessern Zeiten zurücklegten, in dem Wahn eine Reserve während schlechten Geschäfts zu sichern. Sehn Sie es“, schrie sie fast wild, indem sie ein Bankbuch hervorholte mit allen seinen regelmässigen Nachweisen über eingezahltes und rückerhaltnes Geld, so dass wir sehn konnten, wie das kleine Vermögen begonnen hatte mit dem ersten Deposit von 5 Shilling, wie es nach und nach zu 20 Pfd. St. aufwuchs, und dann wieder zusammenschmolz, von Pfunden zu Shillingen, bis der letzte Eintrag das Buch so werthlos machte, wie ein blankes Stück Papier. Diese Familie erhielt ein nothdürftiges Mahl täglich vom Workhouse … Unsre folgende Visite war zur Frau eines Irländers, der an den Schiffswerften gearbeitet hatte. Wir fanden sie krank von Nahrungsmangel, in ihren Kleidern auf eine Matratze gestreckt, knapp bedeckt mit einem Stück Teppich, denn alles Bettzeug war im Pfandhaus. Die elenden Kinder warteten sie und sahen aus als bedürften sie umgekehrt der mütterlichen Pflege. Neunzehn Wochen erzwungnen Müssiggangs hatten sie so weit heruntergebracht, und während sie die Geschichte der bitteren Vergangenheit erzählte, stöhnte sie als ob alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft verloren wäre … Beim Austritt aus dem Hause rannte ein junger Mann auf uns zu und
bat uns in sein Haus zu gehn und zu sehn, ob irgend etwas für ihn geschehn könne. Ein junges Weib, zwei hübsche Kinder, ein Kluster von Pfandzetteln und ein ganz kahles Zimmer war alles, was er zu zeigen hatte“(FN 137).
| Der Vater | 300 Tage | zu | 1 fc. 56 c. | per Jahr | 468 fcs. |
| Die Mutter | 〃 | „ | 0 fc. 89 c. | 〃 | 267 fcs. |
| Der älteste Junge | 〃 | 〃 | 0 fc. 56 c. | 〃 | 168 fcs. |
| Die älteste Tochter | 〃 | 〃 | 0 fc. 55 c. | 〃 | 165 fcs. |
| 1,068 fcs. |
| Des Seesoldaten, | auf | 1828 fcs. | Deficit: | 760 fcs. |
| Des Soldaten, | 〃 | 1473 fcs. | 〃 | 405 fcs. |
| Des Gefangnen, | 〃 | 1112 fcs. | 〃 | 44 fcs. |
Der antagonistische Charakter der kapitalistischen Produktion und Accumulation bewährt sich nirgendwo brutaler als in dem Fortschritt des englischen Landbaus (Viehzucht eingeschlossen) und dem Rückschritt des englischen Landarbeiters. Bevor ich zu seiner gegenwärtigen Lage übergehe, ein rascher Rückblick. Die moderne Agrikultur datirt in England von der Mitte des 18. Jahrhunderts, obgleich die Umwälzung der Grundeigenthumsverhältnisse, wovon die veränderte Produktionsweise als Grundlage ausgeht, viel früheren Datums.
Nehmen wir die Angaben Arthur Young’s, eines genauen Beobachters, obgleich elenden Denkers, über den Landarbeiter von 1771, so spieltletztrer eine sehr elende Rolle, verglichen mit seinem Vorgänger Ende des 14. Jahrhunderts, „wo er in Fülle leben und Reichthum accumuliren konnte“(FN 138), gar nicht zu sprechen vom 15. Jahrhundert, „dem goldnen Zeitalter der englischen Arbeiter in Stadt und Land“. Wir brauchen jedoch nicht so weit zurückzugehn. In einer sehr gehaltreichen Schrift von 1777 liest man: „Der grosse Pächter hat sich beinahe erhoben zum Niveau des Gentleman, während der arme Landarbeiter fast zu Boden gedrückt ist … Seine unglückliche Lage zeigt sich klar durch eine vergleichende Uebersicht seiner Verhältnisse von heute und von 40 Jahr früher … Grundeigenthümer und Pächter wirken Hand in Hand zur Unterdrückung des Arbeiters“(FN 139). Es wird dann im
Detail nachgewiesen, dass der reelle Arbeitslohn auf dem Lande von 1737 bis 1777 um beinahe ¼ oder 25 % gefallen ist. „Die moderne Politik“, sagt Dr. Richard Pricc zur selben Zeit, „begünstigt die höheren Volksklassen; die Folge wird sein, dass früher oder später das ganze Königreich nur aus Gentlemen und Bettlern, aus Grandees und Sklaven besteht“(FN 140).
Dennoch ist die Lage des englischen Landarbeiters von 1770 1780, sowohl was seine Nahrungsund Wohnlichkeitszustände, als sein Selbstgefühl, Belustigungen u. s. w. betrifft, ein später nie wieder erreichtes Ideal. In Pints Weizen ausgedrückt betrug sein Durchschnittslohn 1770—1771 90 Pints, zu Eden’s Zeit (1797) nur noch 65, 1808 aber 60(FN 141).
Der Zustand der Landarbeiter Ende des Antijakobinerkriegs, während dessen sich Grundaristokratie, Pächter, Fabrikanten, Kaufleute, Banquiers, Börsenritter, Armeelieferanten u. s. w. so ausserordentlich bereichert hatten, ist bereits früher angedeutet worden. Der nominelle Arbeitslohn stieg natürlich in Folge theils der Depreciation des Geldes theils eines von dieser Depreciation unabhängigen Steigens im Preis der nothwendigsten Lebensmittel. Die wirkliche Bewegung des Arbeitslohns ist aber auf sehr einfache Art zu konstatiren, ohne Zuflucht zu hier unzulässigen Details. Das Armengesetz und seine Administration waren 1795 und 1814 dieselben. Man erinnert sich: diess Gesetz wurde auf dem Land in der Art gehandhabt, dass die Differenz zwischen dem dem Arbeiter gezahlten Arbeitslohn und der Minimalsumme, die zu seiner blossen Vegetation erheischt ist, von der Pfarrei in der Form der Armenunterstützung ergänzt wurde. Das Verhältniss zwischen dem vom
Pächter gezahlten Arbeitslohn und dem von der Pfarrei gutgemachten Deficit dieses Arbeitslohns zeigt uns zweierlei, erstens die Senkung des Arbeitslohns unter sein Minimum, zweitens den Grad, worin der Landarbeiter aus Lohnarbeiter und Pauper zusammengesetzt war, oder den Grad, worin er in einen Leibeignen seiner Pfarrei verwandelt ward. Wir nehmen eine Grafschaft, die das Durchschnittsverhältniss in allen andern Grafschaften repräsentirt. 1795 betrug der durchschnittliche Wochenlohn in Northampton 7 sh. 6d., die jährliche Totalausgabe einer Familie von 6 Personen 36 Pfd. St. 12 sh. 5 d., ihre Totaleinnahme 29 Pfd. St. 18 sh., das von der Pfarrei gutgemachte Deficit: 6 Pfd. St. 14 sh. 5 d. In derselben Grafschaft betrug 1814 der Wochenlohn 12 sh. 2 d., die jährliche Totalausgabe einer Familie von 5 Personen 54 Pfd. St. 18 sh. 4 d., ihre Totaleinnahme 36 Pfd. St. 2 sh., das von der Pfarrei gutgemachte Deficit: 18 Pfd. St. 6 sh. 4 d.(FN 142). 1795 betrug das Deficit weniger als ¼ des Arbeitslohns, 1814 mehr als die Hälfte. Dass unter diesen Umständen die geringen Komforts, die bei Eden noch in der Cottage des Landarbeiters figuriren, 1814 verschwunden waren, versteht sich von selbst(FN 143). Unter allen Thieren, die der Pächter hält, blieb von nun an der Arbeiter, das instrumentum vocale, das meist geplackte, schlechtest gefütterte und am brutalsten behandelte.
Derselbe Zustand der Dinge dauerte ruhig fort, bis „die swing Aufstände 1830 uns (d. h. den herrschenden Klassen) beim Lichtflammen der Kornschober enthüllten, dass Elend und dunkle aufrührerische Unzufriedenheit ebenso wild unter der Oberfläche des agrikolen als des industriellen Englands lodre“(FN 144). Sadler taufte damals im Unterhaus die Landarbeiter „weisse Sklaven“ („white slaves“), ein Bischof hallte das Epithet im Oberhaus wieder. Der bedeutendste politische Oekonom jener Periode, E. G. Wakefield, sagt: „der Landarbeiter Südenglands ist kein Sklave, er ist kein freier Mann, er ist ein Pauper“(FN 145).
Die Zeit unmittelbar vor der Aufhebung der Korngesetze warf neues Licht auf die Lage der Landarbeiter. Einerseits lag es natürlich im Interesse der bürgerlichen Anticornlawagitatoren nachzuweisen, wie wenig jene Schutzgesetze den wirklichen Kornproducenten beschützten. Andrerseits schäumte die industrielle Bourgeoisie auf von Ingrimm über die Denunciation der Fabrikzustände seitens der Grundaristokraten, über die affektirte Sympathie dieser grundverdorbnen, herzlosen und vornehmen Müssiggänger mit den Leiden des Fabrikarbeiters, und ihren „diplomatischen“ Eifer für Fabrikgesetzgebung. Es ist ein altes englisches Sprichwort, dass wenn zwei Diebe sich in die Haare fallen, immer etwas Nützliches geschieht. Und in der That, der geräuschvolle, leidenschaftliche Zank zwischen den zwei Fraktionen der herrschenden Klasse, welche von beiden den Arbeiter am schamlosesten ausbeute und das meiste Produkt fremder Arbeit als Privateigenthum des Nichtarbeiters usurpire, dieser Zank wurde rechts und links Geburtshelfer der Wahrheit. Graf Shaftesbury, alias Lord Ashley, war Vorkämpfer im aristokratischen Fabrikphilanthropiefeldzug. Er bildet daher 1844—1845 ein Lieblingsthema in den Enthüllungen des Morning Chronicle über die Zustände der Agrikulturarbeiter. Jenes Blatt, damals das bedeutendste liberale Organ, entsandte eigne Kommissäre in die Agrikulturdistrikte, welche sich keineswegs mit allgemeiner Schilderung und Statistik begnügten, sondern die Namen sowohl der untersuchten Arbeiterfamilien als ihrer Landlords veröffentlichten. Die folgende Liste giebt Löhne, gezahlt auf drei Dörfern, in der Nachbarschaft von Blandford, Wimbourne und Poole. Die Dörfer sind Eigenthum des Mr. G. Bankes und des Grafen von Shaftesbury. Man wird bemerken, dass dieser Pabst der „low church“, diess Haupt der englischen Pietisten, und p. p. Bankes von den Hundelöhnen ihrer Arbeiter wieder einen bedeutenden Theil unter dem Vorwand von Hausrente einstecken.
(Siehe nebenstehende Tabelle.)
Der Widerruf der Korngesetze gab dem englischen Landbau einen ungeheuren Ruck. Drainirung auf der grössten Stufenleiter147), neues System der Stallfütterung und des Anbaus der künstlichen Futterkräuter, Einführung mechanischer Düngapparate, neue Behandlung der Thonerde, gesteigerter Gebrauch mineralischer Düngmittel, Anwendung der Dampfmaschine und aller Art neuer Maschinerie u. s. w., intensivere Kultur
der östlichen Grafschaften, welche aus Kaninchengeheg und armer Viehweide in üppige Kornfelder umgezaubert wurden. Man weiss bereits, dass gleichzeitig die Gesammtzahl der in der Agrikultur betheiligten Personen abnahm. Was die eigentlichen Ackerbauer, beiderlei Geschlechts und aller Altersstufen, betrifft, so sank ihre Zahl von 1,241,269 im Jahr 1851 auf 1,163,227 im Jahr 1861(FN 149). Wenn der englische Generalregistrator daher mit Recht bemerkt: „Der Zuwachs von Pächtern und Landarbeitern seit 1801 steht in gar keinem Verhältniss zum Zuwachs des agrikolen Produkts“(FN 150), so gilt diess Missverhältniss noch viel mehr von der letzten Periode, wo positive Abnahme der ländlichen Arbeiterbevölkerung Hand in Hand ging mit Ausdehnung des bebauten Areals, intensiverer Kultur, unerhörter Accumulation des dem Boden einverleibten und des seiner Bearbeitung gewidmeten Kapitals, Steigerung des Bodenprodukts ohne Parallele in der Geschichte der englischen Agronomie, strotzenden Rentrollen der Grundeigenthümer und schwellendem Reichthum der kapitalistischen Pächter. Nimmt man diess zusammen mit der ununterbrochen raschen Erweiterung des städtischen Absatzmarkts und der Herrschaft des Freihandels, so war der Landarbeiter post tot discrimina rerum endlich in Verhältnisse gestellt, die ihn, secundum artem, glückstoll machen mussten.
Professor Rogers gelangt dagegen zum Resultat, dass der englische Landarbeiter heutigen Tags, gar nicht zu sprechen von seinem Vorgänger in der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts und im 15. Jahrhundert, sondern nur verglichen mit seinem Vorgänger aus der Periode 1770—1780, seine Lage ausserordentlich verschlechtert hat, dass „er wieder ein Leibeigner geworden ist“ und zwar schlecht gefütterter und behauster Leibeigner(FN 151). Dr. Julian Hunter, in seinem epochemachenden Bericht über die Wohnlichkeit der Landarbeiter, sagt: „Die Existenzkost des hind (der Zeit der Leibeigenschaft angehöriger Name für den Landarbeiter) ist fixirt zu dem möglichst niedrigen Betrag, womit er leben kann … seine Zufuhr
von Lohn und Obdach ist nicht berechnet auf den aus ihm herauszuschlagenden Profit. Er ist der Nullpunkt in den Berechnungen des Pächters“(FN 152). „Seine Subsistenzmittel werden stets als eine fixe Quantität behandelt“(FN 153). „Was irgend eine weitere Reduktion seines Einkommens angeht, so kann er sagen: nihil habeo, nihil curo. Er hat keine Furcht für die Zukunft, weil er über nichts verfügt ausser dem, was zu seiner Existenz absolut unentbehrlich ist. Er hat den Gefrierpunkt erreicht, von dem die Berechnungen des Pächters als Datum ausgehn. Komme was wolle, er hat keinen Antheil an Glück oder Unglück“(FN 154).
Im Jahr 1863 fand eine officielle Untersuchung über die Verpflegungsund Beschäftigungszustände der zu Transportation und öffentlicher Zwangsarbeit verurtheilten Verbrecher statt. Die Resultate sind in zwei dickleibigen Blaubüchern niedergelegt. „Eine sorgfältige Vergleichung,“ heisst es unter anderem, „zwischen der Diät der Verbrecher in den Gefängnissen von England und der der Paupers in Workhouses und der freien Landarbeiter desselben Landes zeigt unstreitig, dass die erstern viel besser genährt sind als irgend eine der beiden andern Klassen“(FN 155), während „die Arbeitsmasse, die von einem zu öffentlicher Zwangsarbeit Verurtheilten verlangt wird, ungefähr die Hälfte der vom gewöhnlichen Landarbeiter verrichteten beträgt“(FN 156). Einige wenige charakteristische Zeugenaussagen: John Smith, Direktor des Gefängnisses von Edinburg, verhört. Nr. 5056: „Die Diät in den englischen Gefängnissen ist viel besser als die der gewöhnlichen Landarbeiter.“ Nr. 5075: „Es ist Thatsache, dass die gewöhnlichen Agrikulturarbeiter Schottlands sehr selten irgend welches Fleisch erhal-
ten.“ Nr. 3047: „Kennen Sie irgend einen Grund für die Nothwendigkeit, die Verbrecher viel besser (much better) zu nähren als gewöhnliche Landarbeiter? — Sicher nicht.“ Nr. 3048: „Halten Sie es für angemessen weitere Experimente zu machen, um die Diät zu öffentlichen Zwangsarbeiten verurtheilter Gefangenen der Diät freier Landarbeiter nahe zu bringen?“(FN 157) „Der Landarbeiter,“ heisst es, „könnte sagen: Ich arbeite hart und habe nicht genug zu essen. Als ich im Gefängniss war, arbeitete ich nicht so hart und hatte Essen in Fülle, und darum ist es besser für mich im Gefängniss als im Freien zu sein“(FN 158). Aus den dem ersten Band des Berichts angehängten Tabellen ist folgende vergleichende Uebersicht zusammengestellt: Wöchentlicher Nahrungsbetrag.
Das allgemeine Resultat der ärztlichen Untersuchungskommission von 1863 über den Nahrungszustand der schlechter genährten Volksklassen ist dem Leser bereits bekannt. Er erinnert sich, dass die Diät eines grossen Theils der Landarbeiterfamilien unter dem Minimalmass „zur Abwehr von Hungerkrankheiten“ steht. Es ist diess namentlich der Fall in allen rein agrikolen Distrikten von Cornwall, Devon, Somerset, Dorset, Wilts, Stafford, Oxford, Berks und Herts. „Die Nahrung, die der Landarbeiter erhält,“ sagt Dr. Simon, „ist grösser als das Durchschnittsquantum anzeigt, da er selbst einen viel grösseren, für seine Arbeit unentbehr-
lichen, Theil der Lebensmittel erhält als seine übrigen Familienglieder, in den ärmeren Distrikten fast alles Fleisch oder Speck. Das Quantum Nahrung, das der Frau zufällt, und ebenso den Kindern in ihrer Periode raschen Wachsthums, ist in vielen Fällen, und zwar in fast allen Grafschaften, mangelhaft, hauptsächlich an Stickstoff“(FN 159). Die bei den Pächtern selbst wohnenden Knechte und Mägde werden reichlich genährt. Ihre Zahl fiel von 288,277 im Jahr 1851 auf 204,962 im Jahr 1861. „Die Arbeit der Weiber auf freiem Feld,“ sagt Dr. Smith, „von welchen sonstigen Nachtheilen auch immer begleitet, ist unter gegenwärtigen Umständen von grossem Vortheil für die Familie, denn sie liefert derselben Mittel für Beschuhung, Kleidung, Zahlung der Hausrente, und befähigt sie so besser zu essen“(FN 160). Eins der merkwürdigsten Resultate dieser Untersuchung war, dass der Landarbeiter in England bei weitem schlechter genährt ist als in den andern Theilen des Vereinigten Königreichs („is considerably the worst fed“), wie die folgende Tabelle zeigt: Wöchentlicher Konsum von Kohle und Stickstoff durch den ländlichen Durchschnittsarbeiter.
„Jede Seite von Dr. Hunters Bericht“, sagt Dr. Simon in seinem officiellen Gesundheitsbericht, „giebt Zeugniss von der unzureichenden
Quantität und miserablen Qualität der Wohnlichkeit unsres Landarbeiters. Und progressiv seit vielen Jahren hat sich sein Zustand in dieser Hinsicht verschlechtert. Es ist jetzt viel schwerer für ihn, Hausraum zu finden, und, wenn gefunden, ist er seinen Bedürfnissen viel weniger entsprechend, als vielleicht seit Jahrhunderten der Fall war. Besonders innerhalb der letzten 30 oder 20 Jahre ist das Uebel in raschem Wachsthum begriffen, und die Wohnlichkeitsverhältnisse des Landmanns sind jetzt im höchsten Grad kläglich. Ausser soweit diejenigen, die seine Arbeit bereichert, es der Mühe werth halten ihn mit einer Art von mitleidiger Nachsicht zu behandeln, ist er ganz hilflos in der Sache. Ob er Behausung findet auf dem Land, welches er bebaut, ob sie menschlich oder schweinisch ist, ob mit kleinem Garten, der den Druck der Armuth so sehr erleichtert, alles das hängt nicht von seiner Bereitheit oder Fähigkeit zur Zahlung einer angemessnen Miethe ab, sondern von dem Gebrauch, den Andre von ‚dem Recht mit ihrem Eigenthum zu thun was sie wollen‘ zu machen belieben. Eine Pacht mag noch so gross sein, es existirt kein Gesetz, dass auf ihr eine bestimmte Anzahl von Arbeiterwohnungen, und nun gar anständigen, stehen muss; noch behält das Gesetz dem Arbeiter auch nur das kleinste Recht auf den Boden vor, für welchen seine Arbeit so nothwendig ist wie Regen und Sonnenschein … Ein notorischer Umstand wirft noch ein schweres Gewicht in die Wagschale gegen ihn …, der Einfluss des Armengesetzes mit seinen Bestimmungen über Niederlassung und Belastung zur Armentaxe(FN 162). Unter seinem Einfluss hat jede Pfarrei ein Geldinteresse die Zahl ihrer residirenden Landarbeiter auf ein Minimum zu beschränken; denn, unglücklicher Weise, die Landarbeit, statt sichre und permanente Unabhängigkeit des hartschanzenden Arbeiters und seiner Familie zu verbürgen, involvirt meist nur einen längern oder kürzern Umweg zu eventuellem Pauperismus, ein Pauperismus, der während des ganzen Wegs so nahe ist, dass jede Krankheit oder irgend ein vorübergehender Mangel an Beschäftigung unmittelbar die Zuflucht zur Pfarreihilfe ernöthigt; und daher ist alle Residenz einer Ackerbaubevölkerung in einer Pfarrei augenschein-
lich ein Zuschuss zu ihrer Armensteuer … Grosse Grundeigenthümer(FN 163) haben nur zu beschliessen, dass keine Arbeiterwohnungen auf ihren Gütern stehn sollen, und sie befreien sich sofort von der Hälfte ihrer Verantwortlichkeit für die Armen. Wie weit die englische Konstitution und das Gesetz diese Art unbedingtes Grundeigenthum beabsichtigten, welches einen Landlord, der „mit seinem Eignen thut was er will“, befähigt, die Bebauer des Bodens wie Fremde zu behandeln und sie von seinem Territorium zu verjagen, ist eine Frage, deren Diskussion nicht in meinen Bereich fällt … Diese Macht der Eviktion ist keine blosse Theorie. Sie wird praktisch auf der grössten Stufenleiter geltend gemacht. Sie ist einer der Umstände, welche die Wohnlichkeitsverhältnisse des Landarbeiters beherrschen … Den Umfang des Uebels mag man aus dem letzten Census beurtheilen, wonach die Zerstörung von Häusern, trotz vermehrter lokaler Nachfrage für dieselben, während der letzten 10 Jahre, in 821 verschiednen Distrikten von England fortschritt, so dass, abgesehn von den Personen, die gezwungen wurden Nichtresidirende (nämlich in dem Kirchspiel, worin sie arbeiten) zu werden, 1861 verglichen mit 1851 eine um 5⅓ % grössere Bevölkerung in einen um 4½ % kleineren Hausraum gedrängt wurde … Sobald der Entvölkerungsprozess sein Ziel erreicht hat, ist das Resultat, sagt Dr. Hunter, ein Schaudorf (show-village), wo die Cottages auf wenige reducirt sind und wo niemand leben darf ausser Schafhirten, Gärtnern und Wildhütern, reguläre Bediente, welche die ihrer Klasse gewohnte gute Behandlung von der gnädigen Herrschaft erhalten(FN 164). Aber
das Land bedarf der Bebauung, und man wird finden, dass die darauf beschäftigten Arbeiter keine Haussassen des Grundeigenthümers sind, sondern von einem offnen Dorf herkommen, vielleicht 3 Meilen weit entfernt, wo eine zahlreiche kleine Hauseigenthümerschaft sie aufnahm, nach Zerstörung ihrer Cottages in den geschlossnen Dörfern. Wo die Dinge diesem Resultat zustreben, bezeugen die Cottages meist durch ihr elendes Aussehn das Schicksal, zu dem sie verdammt sind. Man findet sie auf den verschiednen Stufen natürlichen Verfalls. So lange das Obdach zusammenhält, wird dem Arbeiter erlaubt, Rente dafür zu zahlen, und er ist oft sehr froh diess thun zu dürfen, selbst wenn er den Preis einer guten Wohnung zu zahlen hat. Aber keine Reparatur, keine Ausbesserung, ausser die der pfenniglose Inhaber leisten kann. Wird es endlich zuletzt ganz unbewohnbar, so ist es nur eine zerstörte Cottage mehr und so viel künftige Armensteuer weniger. Während die grossen Eigenthümer die Armentaxe so von sich abwälzen durch Entvölkerung des von ihnen kontrolirten Grund und Bodens, nimmt das nächste Landstädtchen oder offne Ortschaft die hinausgeworfnen Arbeiter auf; die nächste, sage ich; aber diess „nächste“ mag 3 oder 4 Meilen vom Pachthof entfernt sein, wo der Arbeiter sich täglich abzuplacken hat. So wird seinem Tageswerk, als ob es gar nichts sei, die Nothwendigkeit eines täglichen Marsches von 6 oder 8 Meilen zur Verdienung seines täglichen Brodes hinzugefügt. Alle von seiner Frau und seinen Kindern verrichtete Landarbeit geht jetzt unter denselben erschwerenden Umständen vor. Und diess ist nicht das ganze Uebel, welches ihm die Entfernung verursacht. In der offnen Ortschaft kaufen Bauspekulanten Bodenfetzen, welche sie so dicht wie möglich mit den wohlfeilsten aller möglichen Spelunken besäen. Und in diesen elenden Wohnlichkeiten, die sogar, wenn sie auf das offne Land münden, die ungeheuerlichsten Charakterzüge der schlechtesten Stadtwohnungen theilen, hocken die Agrikulturarbeiter Englands(FN 165) … Andrerseits muss man
sich nur nicht einbilden, dass selbst der auf dem Grund und Boden, den er bebaut, behauste Arbeiter eine Wohnlichkeit findet, wie sie sein Leben produktiver Industrie verdient. Selbst auf den fürstlichsten Gütern ist seine Cottage oft von der allerjämmerlichsten Art. Es giebt Landlords, die einen Stall gut genug für ihre Arbeiter und deren Familien glauben, und die es dennoch nicht verschmähn aus ihrer Miethe so viel Baares als möglich herauszuschlagen(FN 166). Es mag nur eine verfallende Hütte mit
einer Schlafstube sein, ohne Feuerherd, ohne Abtritt, ohne öffenbare Fenster, ohne Wasserzufuhr ausser dem Graben, ohne Garten, der Arbeiter ist hilflos gegen die Unbill. Und unsere gesundheitspolizeilichen Gesetze („The Nuisances Removal Acts“) sind ein todter Buchstabe. Ihre Ausführung ist ja grade den Eigenthümern anvertraut, welche solche Löcher vermiethen … Man muss sich durch ausnahmsweise lichtvollere Scenen nicht blenden lassen über das erdrückende Uebergewicht der Thatsachen, die ein Schandfleck der englischen Civilisation sind. Schauderhaft muss in der That die Lage der Dinge sein, wenn, trotz der augenfälligen Ungeheuerlichkeit der gegenwärtigen Behausung, kompetente Beobachter einstimmig zu dem Schlussresultat gelangen, dass selbst die allgemeine Nichtswürdigkeit der Wohnungen noch ein unendlich minder drückendes Uebel ist als ihr bloss numerischer Mangel. Seit Jahren war die Ueberstopfung der Wohnungen der Landarbeiter ein Gegenstand tiefen Kummers nicht nur für Personen, die auf Gesundheit, sondern für alle, die auf anständiges und moralisches Leben halten. Denn, wieder und wieder, in Phrasen so gleichförmig, dass sie stereotypirt zu sein scheinen, denunciren die Berichterstatter über die Verbreitung epidemischer Krankheiten in den Ruraldistrikten Haus-Ueberfüllung als einen Einfluss, der jeden Versuch, den Fortschritt einer einmal eingeführten Epidemie aufzuhalten, durchaus vereitelt. Und wieder und wieder ward nachgewiesen, dass den vielen gesundheitlichen Einflüssen des Landlebens zum Trotz die Agglomeration, welche das Umsichgreifen ansteckender Krankheiten so sehr beschleunigt, auch die Entstehung nicht ansteckender Krankheiten fördert. Und die Personen, welche diesen Zustand denuncirt haben, verschwiegen weiteres Unheil nicht. Selbst wo ihr ursprüngliches Thema nur die Gesundheitspflege betraf, waren sie beinahe gezwungen auf die andern Seiten des Gegenstandes einzugehn. Indem sie nachwiesen, wie häufig es sich ereignet, dass erwachsne Personen beiderlei Geschlechts, verheirathet und unverheirathet, zusammengehudelt („huddled“) werden in engen Schlafstuben, mussten ihre Berichte die Ueberzeugung hervorrufen, dass unter den beschriebenen Umständen Schamund Anstandsgefühl aufs gröbste verletzt und alle Moralität fast nothwendig ruinirt wird(FN 167).
… Z. B. im Appendix meines letzten Berichts erwähnt Dr. Ord, in seinem Bericht über den Fieberausbruch zu Wing in Buckinghamshire, wie ein junger Mann von Wingrave mit Fieber dorthin kam. In den ersten Tagen seiner Krankheit schlief er mit 9 andern Personen in einem Gemach zusammen. In zwei Wochen wurden verschiedne dieser Personen angegriffen, im Verlauf weniger Wochen verfielen 5 von den 9 Personen dem Fieber und eine starb! Gleichzeitig berichtete mir Dr. Harvey vom St. George’s Spital, der Wing während der Epidemiezeit in Angelegenheiten seiner Privatpraxis besuchte, in demselben Sinne: „Ein junges, fieberkrankes Frauenzimmer schlief Nachts in derselben Stube mit Vater, Mutter, ihrem Bastardkind, zwei jungen Männern, ihren Brüdern, und ihren zwei Schwestern, jede mit einem Bastard, in allem 10 Personen. Wenige Wochen vorher schliefen 13 Kinder in demselben Raume“(FN 168).
Dr. Hunter untersuchte 5375 Landarbeiter-Cottages, nicht nur in den reinen Agrikulturdistrikten, sondern in allen Grafschaften Englands. Unter diesen 5375 hatten 2195 nur eine Schlafstube (oft zugleich Wohnstube), 2930 nur 2 und 250 mehr als 2. Ich will für ein Dutzend Grafschaften eine kurze Blüthenlese geben.
1) Bedfordshire.
Wrestlingworth: Schlafzimmer ungefähr 12 Fuss lang und 10 breit, obgleich viele kleiner sind. Die kleine einstöckige Hütte wird oft durch Bretter in zwei Schlafstuben getheilt, oft ein Bett in einer Küche 5 Fuss 6 Zoll hoch. Miethe 3 Pfd. St. Die Miether haben ihre eignen Abtritte zu bauen, der Hauseigenthümer liefert nur ein Loch. So oft einer
einen Abtritt baut, wird letzterer von der ganzen Nachbarschaft benutzt. Ein Haus Namens Richardson von unerreichbarer Schöne. Seine Mörtelwände bauschten aus wie ein Damenkleid beim Knix. Ein Giebelende war konvex, das andre konkav, und auf dem letztern stand unglücklicher Weise der Schornstein, ein krummes Rohr von Lehm und Holz gleich einem Elephantenrüssel. Ein langer Stock diente als Stütze, um den Fall des Schornsteins zu verhindern, Thüre und Fenster rautenförmig. Von 17 besuchten Häusern nur 4 mit mehr als 1 Schlafzimmer und diese 4 überstopft. Die einschläfrigen Cots bargen 3 Erwachsne mit 3 Kindern, ein verheirathetes Paar mit 6 Kindern u. s. w.
Dunton: Hohe Haus-Renten, von 4 bis 5 Pfd. St., Wochenlohn der Männer 10 sh. Sie hoffen durch Strohflechten der Familie die Miethe herauszuschlagen. Je höher die Hausmiethe, desto grösser die Zahl, die sich zusammenthun muss, um sie zu zahlen. Sechs Erwachsne, die mit 4 Kindern in einer Schlafstube, zahlen dafür 3 Pfd. St. 10 sh. Das wohlfeilste Haus in Dunton, von der Aussenseite 15 Fuss lang, 10 breit, vermiethet für 3 Pfd. St. Nur eins von den 14 untersuchten Häusern hatte zwei Schlafstuben. Etwas vor dem Dorf ein Haus, von den Insassen bekothet vor seinen Aussenwänden, die untern 5 Zoll der Thüre verschwunden durch reinen Verfaulungsprozess, einige Ziegelsteine von innen sinnreich des Abends beim Zuschliessen vorgeschoben und mit etwas Matte verhangen. Ein halbes Fenster, sammt Glas und Rahmen, war ganz den Weg allen Fleisches gegangen. Hier, ohne Möbel, hudelten 3 Erwachsne und 5 Kinder zusammen. Dunton ist nicht schlimmer als der Rest der Biggleswude Union.
2) Berkshire.
Beenham: Juni 1864 lebte ein Mann, Frau, 4 Kinder in einem Cot (einstöckigen Cottage). Eine Tochter kam heim aus dem Dienst mit Scharlachfieber. Sie starb. Ein Kind erkrankte und starb. Die Mutter und ein Kind litten an Typhus, als Dr. Hunter gerufen wurde. Der Vater und ein Kind schliefen auswärts, aber die Schwierigkeit Isolirung zu sichern, zeigte sich hier, denn im vollgepfropften Markt des elenden Dorfs lag das Leinen des fiebergeschlagnen Hauses, auf Wäsche wartend. — Die Miethe von H.’s Haus 1 sh. wöchentlich; das eine Schlafzimmer für 1 Paar und 6 Kinder. Ein Haus vermiethet zu 8 d. (wöchentlich), 14 Fuss 6 Zoll lang, 7 Fuss breit, Küche 6 Fuss hoch; das Schlafzimmer
ohne Fenster, Feuerplatz, Thüre, noch Oeffnung, ausser nach dem Gang zu, kein Garten. Ein Mann lebte hier vor kurzem mit zwei erwachsnen Töchtern und einem aufwachsenden Sohn; Vater und Sohn schliefen auf dem Bett, die Mädchen auf dem Hausgang. Jede hatte ein Kind, so lange die Familie hier lebte, aber eine ging zum Workhouse für ihre Entbindung und kehrte dann heim.
3) Buckinghamshire.
30 Cottages — auf 1000 Acres Land — enthalten hier ungefähr 130—140 Personen. Die Pfarrei von Bradenham umfasst 1000 Acres; sie hatte 1851 36 Häuser und eine Bevölkerung von 84 Mannsund 54 Weibspersonen. Diese geschlechtliche Ungleichheit geheilt 1861, wo sie 98 männlichen und 87 weiblichen Geschlechts zählte, Zuwachs in 10 Jahren von 14 Männern und 33 Weibern. Unterdess hatte die Häuserzahl um 1 abgenommen.
Winslow: Grosser Theil davon neu gebaut in gutem Styl; Nachfrage nach Häusern scheint bedeutend, weil sehr armselige Cots vermiethet zu 1 sh. und 1 sh. 3 d. per Woche.
Water Eaton: Hier haben die Eigenthümer im Angesicht wachsender Bevölkerung ungefähr 20 % der existirenden Häuser zerstört. Ein armer Arbeiter, der ungefähr 4 Meilen zu seinem Werk zu gehn hatte, antwortete auf die Frage, ob er kein Cot näher finden könnte: „Nein, sie werden sich verdammt hüten, einen Mann mit meiner grossen Familie aufzunehmen.“
Tinker’s End, bei Winslow: Eine Schlafstube, worin 4 Erwachsne und 4 Kinder, 11 Fuss lang, 9 Fuss breit, 6 Fuss 5 Zoll hoch am höchsten Punkt; ein andres 11 Fuss 3 Zoll lang, 9 Fuss breit, 5 Fuss 10 Zoll hoch, beherbergte 6 Personen. Jede dieser Familien hatte weniger Raum als nöthig für einen Galeerensträfling. Kein Haus hatte mehr als ein Schlafzimmer, keins eine Hinterthür, Wasser sehr selten, Wochenmiethe von 1 sh. 4 d. zu 2 sh. In 16 untersuchten Häusern nur ein einziger Mann, der 10 sh. wöchentlich verdiente. Das Luftreservoir, jeder Person in dem erwähnten Falle gegönnt, entspricht dem, das ihr zu gut käme, wenn des Nachts eingeschlossen in eine Schachtel von 4 Kubikfuss. Allerdings bieten die alten Hütten eine Masse naturwüchsiger Ventilation.
4) Cambridgeshire.
Gamblingay gehört verschiednen Eigenthümern. Es enthält die
lumpigsten Cots, die man irgendwo finden kann. Viel Strohflechterei. Eine tödtliche Mattheit, eine hoffnungslose Ergebung in Schmutz beherrscht Gamblingay. Die Vernachlässigung in seinem Centrum wird zur Tortur an den Extremitäten, Nord und Süd, wo die Häuser stückweis abfaulen. Die abwesenden Landlords lassen dem armen Nest frei zur Ader. Die Miethen sind sehr hoch, 8 bis 9 Personen gepackt in ein einschläfriges Zimmer, in zwei Fällen 6 Erwachsne mit je 1 und 2 Kindern in einer kleinen Schlafstube.
5) Essex: In dieser Grafschaft gehn in vielen Pfarreien Abnahme von Personen und Cottages Hand in Hand. In nicht weniger als 22 Pfarreien hat jedoch die Häuserzerstörung den Bevölkerungsanwachs nicht aufgehalten, oder nicht die Expulsion bewirkt, welche unter dem Namen: „ Wanderung nach den Städten“ überall vorgeht. In Fingringhoe, einer Pfarrei von 3443 Acres, standen 1851 145 Häuser, 1861 nur noch 110, aber das Volk wollte nicht fort und brachte es fertig selbst unter dieser Behandlung zuzunehmen. Zu Ramsden Crays bewohnten 1851 252 Personen 61 Häuser, aber 1861 waren 262 Personen in 49 Häuser gequetscht. In Basilden lebten 1851 auf 1827 Acres 157 Personen in 35 Häusern, am Ende des Decenniums 180 Personen in 27 Häusern. In den Pfarreien von Fingringhoe, South Fambridge, Widford, Basilden und Ramsden Crays lebten 1851 auf 8449 Acres 1392 Personen in 316 Häusern, 1861 auf demselben Areal 1473 Personen in 249 Häusern.
6) Herefordshire: Diese kleine Grafschaft hat mehr gelitten vom „Evictionsgeist“ als irgend eine andre in England. Zu Madby gehören die überstopften Cottages, meist mit 2 Schlafzimmern, grossentheils den Pächtern. Sie vermiethen selbe leicht zu 3 oder 4 Pfd. St. per Jahr und zahlen Wochenlohn von 9 sh.!
7) Huntingdonshire.
Hartford hatte 1851 87 Häuser, kurz nachher 19 Cottages zerstört in dieser kleinen Pfarrei von 1720 Acres; Einwohnerschaft 1831 : 452 Personen, 1852: 832 und 1861: 341. Vierzehn einschläfrige Cots untersucht. In einem 1 verheirathetes Paar, 3 erwachsne söhne, 1 erwachsnes Mädchen, 4 Kinder, zusammen 10; in einem andern 3 Erwachsne, 6 Kinder. Eine dieser Stuben, worin 8 Personen schliefen, mass 12 Fuss, 10 Zoll in der Länge, 12 Fuss, 2 Zoll breit, 6 Fuss, 9 Zoll hoch; Durchschnittsmass, ohne Abzug der Vorsprünge, ergab ungefähr 130 Kubikfuss per Kopf. In den 14 Schlafstuben 34 Erwachsne
und 33 Kinder. Diese Cottages selten mit Gärtchen versehn, aber viele der Insassen konnten kleine Fetzen Land, 10 oder 12 sh. per rood (etwa 17 Fuss) pachten. Diese allotments sind entfernt von den abtrittlosen Häusern. Die Familie muss entweder zu ihrer Parcelle gehn, um ihre Exkremente abzulagern, oder, wie es, mit Respekt zu melden, hier geschieht, die Schublade eines Schranks damit füllen. Sobald er voll, wird er ausgezogen und dort entleert, wo sein Inhalt nöthig ist. In Japan geht der Cirkellauf der Lebensbedingungen reinlicher von statten.
8) Lincolnshire.
Langtofft: Ein Mann wohnt hier in Wright’s Haus mit seiner Frau, ihrer Mutter, und 5 Kindern; das Haus hat Vorderküche, Spülkammer, Schlafzimmer über der Vorderküche; Vorderküche und Schlafstube 12 Fuss 2 Zoll lang, 9 Fuss 5 Zoll breit, die ganze Grundfläche 21 Fuss 3 Zoll lang, 9 Fuss 5 Zoll breit. Die Schlafstube ist ein Dachraum, die Wände laufen zuckerhutig an der Decke zusammen, und ein Kappfenster öffnet sich in der Front. Warum lebte er hier? Garten? Ausserordentlich winzig. Miethe? Hoch, 1 sh. 3 d. per Woche. Nah seiner Arbeit? Nein, 6 Meilen entfernt, so dass er täglich 12 Meilen hin und her vermarschirt. Er lebte da, weil es ein vermiethbares Cot war und weil er ein Cot für sich allein haben wollte, irgendwo, zu irgend einem Preis, in irgend einem Zustand. Folgendes ist die Statistik von 12 Häusern in Langtofft mit 12 Schlafstuben, 38 Erwachsnen und 36 Kindern: 12 Häuser in Langtofft.
9) Kent.
Kennington, höchst traurig überfüllt 1859, als die Diphtherie erschien und der Surgeon des Kirchspiels eine amtliche Untersuchung über
die Lage der ärmeren Volksklasse veranstaltete. Er fand, dass in dieser Ortschaft, wo viel Arbeit nöthig, verschiedne Cots zerstört und keine neuen erbaut worden waren. In einem Bezirk standen 4 Häuser, birdcages ( Vogelkäfige) benamst; jedes hatte 4 Zimmer mit den folgenden Dimensionen in Fuss und Zoll:
10) Northamptonshire.
Brinworth, Pickford und Floore: In diesen Dörfern lungern im Winter 20—30 Mann aus Arbeitsmangel auf den Strassen herum. Die Pächter bestellen nicht immer hinreichend das Kornund Wurzelland, und der Landlord hat es passend gefunden alle seine Pachten in 2 oder 3 zusammenzuwerfen. Daher Mangel an Beschäftigung. Während von der einen Seite des Grabens das Feld nach Arbeit schreit, werfen die geprellten Arbeiter von der anderen Seite sehnsüchtige Blicke danach. Fieberhaft überarbeitet im Sommer und halbverhungert im Winter, ist es kein Wunder, wenn sie in ihrem eignen Patois sagen, dass „the parson and gentlefolks seem frit to death at them.“
Zu Floore Beispiele von Paaren mit 4, 5, 6 Kindern in einer Schlafstube kleinster Ausgabe, ditto 3 Erwachsne mit 5 Kindern, ditto ein Paar mit Grossvater und 6 scharlachkranken Kindern u. s. w.; in 2 Häusern mit 2 Schlafstuben 2 Familien von je 8 und 9 Erwachsnen.
11) Wiltshire.
Stratton: 31 Häuser besucht, 8 mit nur einer Schlafstube; Pentill in derselben Pfarrei. Ein Cot vermiethet zu 1 sh. 3 d. wöchentlich an 4 Erwachsne und 4 Kinder, hatte ausser guten Wänden nichts Gutes an sich, vom Estrich aus rauhgehaunen Steinen bis zum faulen Strohdach.
12) Worcestershire. Hauszerstörung hier nicht ganz so arg; doch von 1851—1861 vermehrte sich das Personal per Haus von 4.2 zu 4.6 Individuen.
Badsey. Viele Cots und Gärtchen hier. Einige Pächter erklären die Cots „a great nuisance here, because they bring the poor“. (Die Cots grosser Missstand, weil sie die Armen herbringen.) Auf die Aeusse-
rung eines Gentleman: „Die Armen sind desswegen um nichts besser dran, wenn man 500 Cots baut, gehn sie wie die Wecken ab, in der That je mehr man davon baut, desto mehr sind nöthig“ — die Häuser bringen nach ihm die Einwohner hervor, die naturgesetzlich auf „die Mittel der Behausung“ drücken —, bemerkt Dr. Hunter: „Nun diese Armen müssen irgendwoher kommen, und da keine besondre Attraktion, wie milde Gaben, in Badsey existirt, muss Repulsion von einem noch unbequemeren Platz existiren, der sie hierhin treibt. Könnte jeder ein Cot und ein Stückchen Land in der Nähe seines Arbeitsplatzes finden, so würde er solche sicher Badsey vorziehn, wo er für seine Handvoll Boden zweimal soviel zahlt als der Pächter für den seinen.“
Die beständige Emigration nach den Städten, die beständige „Ueberzähligmachung“ auf dem Land durch Koncentration, Verwandlung von Acker in Weide, Maschinerie u. s. w., und die beständige Eviktion der Landbevölkerung durch Zerstörung der Cottages gehn Hand in Hand. Je menschenleerer der Distrikt, desto grösser seine „relative Uebervölkerung“, desto grösser ihr Druck auf die Beschäftigungsmittel, desto grösser der absolute Ueberschuss des Landvolks über seine Behausungsmittel, desto grösser also in den Dörfern die lokale Ueberpopulation und die pestilenzialischste Menschenzusammenpackung. Die Verdichtung des Menschenknäuels in zerstreuten kleinen Dörfern und Marktflecken entspricht der gewaltsamen Menschenentleerung auf der Oberfläche des Landes. Die ununterbrochene „Ueberzähligmachung“ der Landarbeiter trotz ihrer abnehmenden Anzahl und mit der wachsenden Masse ihres Produkts, ist die Wiege ihres Pauperismus. Ihr eventueller Pauperismus ist ein Motiv ihrer Eviktion und die Hauptquelle ihrer Wohnlichkeitsmisère, welche die letzte Widerstandsfähigkeit bricht und sie zu reinen Sklaven der Landlords(FN 169)
und Pächter macht, so dass das Minimum des Arbeitslohns sich zum Naturgesetz für sie befestigt. Andrerseits ist das Land trotz seiner beständigen „relativen Uebervölkerung“ zugleich untervölkert. Diess zeigt sich nicht nur lokal auf solchen Punkten, wo der Menschenabfluss nach den Städten, Minen, Eisenbahnbauten u. s. w. zu rasch vorgeht, es zeigt sich überall sowohl zur Herbstzeit als im Frühling und Sommer während der zahlreichen Momente, wo die sehr sorgfältige und intensive englische Agrikultur Extrahände braucht. Es sind der Landarbeiter stets zu viel für die mittleren und stets zu wenig für die ausnahmsweisen oder temporären Bedürfnisse des Landbaus(FN 170). Daher findet man in den officiellen Dokumenten die widerspruchsvolle Klage derselben Orte über gleichzeitigen Arbeitsmangel und Arbeitsüberfluss registrirt. Der temporäre oder lokale Arbeitsmangel bewirkt keine Erhöhung des Arbeitslohns, sondern Pressung von Weibern und Kindern in den Feldbau und Herabsteigen zu stets niedrigeren Altersstufen. Sobald die Weiberund Kinderausbeutung grösseren Spielraum gewinnt, wird sie ihrerseits ein neues Mittel zur Ueberzähligmachung des männlichen Landarbeiters und
Niederhaltung seines Lohns. Im Osten Englands blüht eine schöne Frucht dieses cercle vicieux — das s. g. Gangsystem (Gangoder Bandensystem), worauf ich hier kurz zurückkomme(FN 171).
Das Gangsystem haust fast ausschliesslich in Lincolnshire, Huntingdonshire, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk und Nottinghamshire, sporadisch in den benachbarten Grafschaften von Northampton, Bedford und Rutland. Als Beispiel diene hier Lincolnshire. Ein grosser Theil dieser Grafschaft ist neu, früherer Moor oder auch, wie in andern der genannten östlichen Grafschaften, der See erst abgewonnenes Land. Die Dampfmaschine hat für die Entwässerung Wunder gewirkt. Früherer Morast und Sandboden trägt jetzt ein üppiges Kornmeer und die höchsten Grundrenten. Dasselbe gilt von dem künstlich gewonnenen Alluvialland, wie in der Insel von Axholme und den andren Pfarreien am Ufer des Trent. Im Mass wie die neuen Pachten entstanden, wurden nicht nur keine neuen Cottages gebaut, sondern alte niedergerissen, die Arbeitszufuhr aber verschafft aus den meilenweit entfernten offnen Dörfern längst den Landstrassen, die an Hügelrücken vorbeischlängeln. Dort hatte die Bevölkerung früher allein Schutz vor den langanhaltenden Winterüberschwemmungen gefunden. Auf den Pachten von 400 bis 1000 Acres ansässige Arbeiter (sie heissen hier „confined labourers“) dienen ausschliesslich zur permanenten schweren und mit Pferden verrichteten Landarbeit. Auf je 100 Acres (1 Acre = 1.584 preussische Morgen) kommt im Durchschnitt kaum eine Cottage. Ein Fenlandpächter z. B. sagt aus vor der Untersuchungskommission: „Meine Pacht erstreckt sich über 320 Acres, alles Kornland. Sie hat keine Cottage. Ein Arbeiter wohnt jetzt bei mir. Ich habe vier Pferdemänner in der Umgegend logirend. Das leichte Werk, wozu zahlreiche Hände nöthig, wird durch Gänge vollbracht“(FN 172). Der Boden erheischt viel leichtes Feldwerk wie Ausjäten des Unkrauts, Behackung, gewisse Düngeroperationen, Auflesen der Steine u. s. w. Es wird verrichtet durch die Gänge oder organisirten Banden, deren Wohnsitz in den offenen Ortschaften.
Der Gang besteht aus 10 bis 40 oder 50 Personen, nämlich Wei-
bern, jungen Personen beiderlei Geschlechts (13—18 Jahr), obgleich Jungen meist mit dem 13. Jahr ausscheiden, endlich Kindern beiderlei Geschlechts (6—13. Jahr). An der Spitze steht der Gangmaster (Gangmeister), immer ein gewöhnlicher Landarbeiter, meist ein s. g. schlechter Kerl, Liederjahn, unstät, versoffen, aber mit einem gewissen Unternehmungsgeist und savoir faire. Er wirbt den Gang, der unter ihm arbeitet, nicht unter dem Pächter. Mit letztrem akkordirt er meist auf Stückwerk, und sein Einkommen, das im Durchschnitt nicht sehr hoch über das eines gewöhnlichen Landarbeiters steigt(FN 173), hängt fast ganz ab vom Geschick, womit er in kürzester Zeit möglichst viel Arbeit aus seiner Bande flüssig zu machen weiss. Die Pächter haben entdeckt, dass Frauenzimmer nur unter männlicher Diktatur ordentlich arbeiten, dass aber Frauenzimmer und Kinder, wenn einmal im Zug, mit wahrem Ungestüm, was schon Fourier wusste, ihre Lebenskraft verausgaben, während der erwachsne männliche Arbeiter so heimtückisch ist damit, soviel er kann, hauszuhalten. Der Gangmeister zieht von einem Gut zum andern und beschäftigt so seine Bande 6—8 Monate im Jahr. Er ist daher ein viel einträglicherer und sicherer Kunde für die Arbeiterfamilien als der einzelne Pächter, welcher die Kinder nur gelegentlich beschäftigt. Dieser Umstand befestigt seinen Einfluss so sehr in den offnen Ortschaften, dass in vielen die Kinder nur durch seine Dazwischenkunft habbar sind. Das individuelle Verpumpen derselben, ausserhalb des Gangs, an die Pächter, bildet sein Nebengeschäft.
Die „Schattenseiten“ des Systems sind die Ueberarbeit der Kinder und jungen Personen, die ungeheuren Märsche, die sie täglich zu und von den 5, 6 und manchmal 7 Meilen entfernten Gütern zu machen haben, endlich die Demoralisation des „Gangs“. Obgleich der Gangmeister, der in einigen Gegenden „the driver“ (Treiber) heisst, mit einem langen Stabe ausgerüstet ist, wendet er solchen jedoch nur selten an, und Klage über brutale Behandlung ist Ausnahme. Er ist ein demokratischer Kaiser oder eine Art Rattenfänger von Hameln. Er bedarf also der Popularität unter seinen Unterthanen und fesselt sie an sich durch das unter seinen Auspicien blühende Zigeunerthum. Rohe Ungebundenheit, lustige Ausge-
lassenheit und obscönste Frechheit leihen dem Gang Flügel. Meist zahlt der Gangmeister in einer Kneipe aus und kehrt dann wohl wankend, rechts und links gestützt auf ein stämmiges Frauenmensch, an der Spitze des Zugs heim, die Kinder und jungen Personen hinterher tollend, Spottund Zotenlieder singend. Auf dem Rückweg ist das, was Fourier ‚Phanerogamie‘ nennt, an der Tagesordnung. Die Schwängerung dreizehnund vierzehnjähriger Mädchen durch ihre männlichen Altersgenossen ist häufig. Die offenen Dörfer, welche das Kontingent des Gangs stellen, werden Sodoms und Gomorrhas(FN 174) und liefern doppelt so viel unehliche Geburten als der Rest des Königreichs. Was in dieser Schule gezüchtete Mädchen als verheirathete Frauen in der Moralität leisten, ward schon früher angedeutet. Ihre Kinder, soweit sie selbe nicht durch Opium u. s. w. beseitigen, sind geborne Rekruten des Gangs.
Der Gang in seiner eben beschriebenen klassischen Form heisst öffentlicher, gemeiner oder Wandergang (public, common or tramping gang). Es giebt nämlich auch Privatgänge (private gangs). Sie sind zusammengesetzt wie der Gemeingang, zählen aber weniger Köpfe und arbeiten, statt unter dem Gangmeister, unter einem alten Bauernknecht, den der Pächter nicht besser zu verwenden weiss. Der Zigeunerhumor verschwindet hier, aber nach allen Zeugenaussagen verschlechtern sich Zahlung und Behandlung der Kinder.
Das Gangsystem, das sich seit den letzten Jahren beständig ausdehnt(FN 175), existirt offenbar nicht dem Gangmeister zu lieb. Es existirt zur Bereicherung der grossen Pächter(FN 176), resp. Landlords(FN 177). Für den Päch-
ter giebt’s keine sinnreichere Methode, sein Arbeiterpersonal tief unter dem normalen Niveau zu halten und dennoch für alles Extrawerk stets die Extrahand bereit zu haben, mit möglichst wenig Geld möglichst viel Arbeit herauszuschlagen(FN 178) und den erwachsnen männlichen Arbeiter „überzählig“ zu machen. Nach der frühern Auseinandersetzung versteht man, wenn einerseits die grössere oder geringere Beschäftigungslosigkeit des Landmanns zugestanden, andrerseits zugleich das Gangsystem wegen Mangels an männlicher Arbeit und ihrer Wanderung nach den Städten für „ nothwendig“ erklärt wird(FN 179). Das unkrautreine Feld und das Menschenunkraut von Lincolnshire u. s. w. sind Pol und Gegenpol der kapitalistischen Produktion(FN 180).
Zum Schluss dieses Abschnitts müssen wir noch einen Augenblick nach Irland wandern. Zunächst die Thatsachen, worauf es hier ankommt.
Irlands Bevölkerung war 1841 auf 8,222,664 Personen angewachsen, 1851 auf 6,623,982 zusammengeschmolzen, 1861 auf 5,850,309, 1866 auf 5½ Mill., ungefähr auf ihr Niveau von 1801. Die Abnahme begann mit dem Hungerjahr 1846, so dass Irland in weniger als 20 Jahren mehr als seiner Volksmenge verlor(FN 181). Seine Gesammtemigration von Mai 1851 bis Juli 1865 zählte 1,591,487 Personen, die Emigration während der letzten 5 Jahre 1861—1865 mehr als eine halbe Million. Die Zahl der bewohnten Häuser verminderte sich von 1851—1861 um 52,990. Von 1851—1861 wuchs die Zahl der Pachthöfe von 15—30 Acres um 61,000, die der Pachthöfe über 30 Acres um 109,000, während die Gesammtzahl aller Pachten um 120,000 abnahm, eine Abnahme, die also ausschliesslich der Vernichtung von Pachten unter 15 Acres, alias ihrer Koncentration geschuldet ist.
Die Abnahme der Volksmenge war natürlich im Grossen und Ganzen von einer Abnahme der Produktenmasse begleitet. Für unsren Zweck genügt es, die 5 Jahre 1861—1865 zu betrachten, während deren über ½ Million emigrirte und die absolute Volkszahl um mehr als ⅓ Million sank.
Tabelle A. Viehstand.
Aus der vorhergehenden Tabelle ergiebt sich:
Wenden wir uns jetzt zum Ackerbau, der die Lebensmittel für Vieh und Mensch liefert. In der folgenden Tabelle ist Aboder Zunahme für das Jahr 1861 auf das Jahr 1860 berechnet, kurz für jedes einzelne Jahr
mit Bezug auf das unmittelbar vorhergehende. Die Kornfrucht umfasst Weizen, Hafer, Gerste, Bere, Roggen, Bohnen und Erbsen, die Grünfrucht Kartoffeln, Turnips, Mangelund Runkelrübe, Kohl, gelbe Rüben, Parsnips, Wicke u. s. w.
Tabelle B. Zuoder Abnahme des zum Fruchtbau und als Wiese (resp. Weide) benutzten Bodenareals in Acres.
Im Jahr 1865 kamen unter der Rubrik „Grasland“ 127,470 Acres hinzu, hauptsächlich weil das Areal unter der Rubrik „ unbenutztes wüstes Land und Bog (Sumpfland)“ um 101,543 Acres abnahm. Vergleichen wir 1865 mit 1864, so Abnahme in Kornfrucht 246,667 Qrs., wovon 48,999 Weizen, 166,605 Hafer, 29,892 Gerste u. s. w., Abnahme von Kartoffelertrag, obgleich das Areal ihrer Bebauung 1865 wuchs, 446,398 Tonnen u. s. w.
Tabelle C. Zuoder Abnahme in dem Areal des bebauten Bodens, dem Produkt per Acre, und dem Gesammtprodukt, 1865 verglichen mit 1864.
Von der Bewegung der Bevölkerung und Bodenproduktion Irlands gehn wir über zur Bewegung in der Börse seiner Landlords, grösseren Pächter und industriellen Kapitalisten. Sie reflektirt sich im Ab und Zu der der Einkommensteuer unterworfenen jährlichen Einkommen. Zum Verständniss der folgenden Tabelle bemerken wir, dass Rubrik D ( Profite mit Ausnahme der Pächterprofite) auch s. g. „professionelle“ Profite einbegreift, d. h. die Einkommen von Advokaten, Aerzten u. s. w., die nicht besonders aufgezählten Rubriken C und E aber die Einnahmen von Beamten, Officieren, Staatssynekuristen, Staatsgläubigern u. s. w.
Tabelle D. Der Einkommensteuer unterliegende Einkommen in Pfd. St.
Unter Rubrik D betrug die Zunahme des Einkommens im Jahresdurchschnitt von 1853—1864 nur 0.93, während sie in derselben Periode in Grossbritanien 4.58 betrug. Die folgende Tabelle zeigt die Vertheilung der Profite (mit Ausschluss der Pächterprofite) für die Jahre 1864 und 1865: Siehe nebenstehende Tabelle E.
England, ein Land entwickelter kapitalistischer Produktion und vorzugsweis industriell, wäre verblutet an einem Volksaderlass, gleich dem irischen. Aber Irland ist gegenwärtig nur ein durch einen breiten Wassergraben abgezäunter Agrikulturdistrikt Englands, dem es Korn, Wolle, Vieh, industrielle und militärische Rekruten liefert.
Die Entvölkerung hat viel Land ausser Bebauung geworfen, das
Tabelle E. Rubrik D. Einkommen aus Profiten (über 60 Pfd. St.) in Irland.
Zersplitterte Produktionsmittel, die den Producenten selbst als Beschäftigungsund Subsistenzmittel dienen, ohne sich durch Einverleibung
fremder Arbeit zu verwerthen, sind eben so wenig Kapital als das von seinem eignen Producenten verzehrte Produkt Waare ist. Wenn also auch mit der Volksmasse die Masse der in der Agrikultur angewandten Produktionsmittel sich verminderte, vermehrte sich die Masse des in ihr angewandten Kapitals, weil ein Theil jener vorher zersplitterten Produktionsmittel in Kapital verwandelt ward.
Das ausserhalb der Agrikultur, in Industrie und Handel angelegte Gesammtkapital Irlands accumulirte langsam während der letzten zwei Decennien und unter beständiger grosser Fluktuation. Andrerseits entwickelte sich um so rascher die Koncentration seiner individuellen Bestandtheile. Endlich, wie langsam immerhin das Kapital absolut wuchs, relativ, im Verhältniss zur zusammengeschmolzenen Volkszahl, war es ausserordentlich angeschwollen.
Hier entrollt sich also, unter unsern Augen, auf grosser Stufenleiter, ein Prozess wie die orthodoxe Oekonomie ihn nicht schöner wünschen konnte zur Bewähr ihres Dogma’s, welches das Elend aus absoluter Uebervölkerung erklärt und das Gleichgewicht durch Entvölkerung wieder herstellt. Es ist diess ein ganz anders wichtiges Experiment als die von den Malthusianern so sehr verherrlichte Pest in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Nebenbei bemerkt. War es an sich schulmeisterlich naiv, den Produktionsund entsprechenden Bevölkerungsverhältnissen des 19. Jahrhunderts den Massstab des 14. Jahrhunderts anzulegen, so übersah diese Naivetät noch obendrein, dass wenn jener Pest und der sie begleitenden Decimation, diesseits des Kanals, in England, Befreiung und Bereicherung des Landvolks, ihr jenseits, in Frankreich, grössere Knechtung und erhöhtes Elend auf dem Fuss nachfolgten.
Die Hungersnoth erschlug 1846 in Irland über eine Menschenmillion, aber nur arme Teufel, ohne den geringsten Abbruch am Reichthum des Landes. Der nachfolgende zwanzigjährige und stets noch anschwellende Exodus decimirte nicht, wie etwa der dreissigjährige Krieg, mit den Menschen zugleich ihre Produktionsmittel. Das irische Genie erfand eine ganz neue Methode, ein armes Volk Tausende von Meilen vom Schauplatz seines Elends wegzuhexen. Die in die Vereinigten Staaten übergesiedelten Auswanderer schicken jährlich Geldsummen nach Haus, die Reisemittel der Zurückgebliebenen. Jeder Trupp, der dieses Jahr auswandert, zieht nächstes Jahr einen andern Trupp nach. Statt Irland zu kosten, bildet
die Auswanderung so einen der einträglichsten Zweige seines Exportgeschäfts. Endlich ist diess ein systematischer Prozess, der nicht etwa ein vorübergehendes Loch in die Volksmasse bohrt, sondern jährlich mehr Menschen aus ihr auspumpt als der Nachwuchs ersetzt, so dass das absolute Bevölkerungsniveau von Jahr zu Jahr sinkt.
Welches waren die Folgen für die zurückbleibende, von der „Surpluspopulation“ befreite Arbeiterbevölkerung Irlands? Dass die relative Uebervölkerung heute so gross ist wie vor 1846, dass der Arbeitslohn eben so niedrig steht und die Arbeitsplackerei zugenommen hat, dass die Misère auf dem Land wieder zu einer neuen Krise drängt. Die Ursachen sind einfach. Die Revolution in der Agrikultur hielt Schritt mit der Emigration. Die Produktion der relativen Uebervölkerung hielt mehr als Schritt mit der absoluten Entvölkerung. Ein Blick auf Tabelle C zeigt, wie die Verwandlung von Ackerbau in Viehweide in Irland noch akuter wirken muss als in England. Hier wächst mit der Viehzucht der Bau von Grünfrucht, dort nimmt er ab. Während grosse Massen früher bestellter Aecker brachgelegt oder in permanentes Grasland verwandelt werden, wird ein grosser Theil des früher unbenutzten wüsten Landes und Bog’s zur Ausdehnung der Viehzucht benutzt. Die kleineren und mittleren Pächter — ich rechne dazu alle, die nicht über 100 Acres bebauen — haben immer noch ungefähr des irischen Bodens inne. Sie werden progressiv in ganz anderem Grad als zuvor von der Konkurrenz des kapitalistisch betriebenen Ackerbaus erdrückt und liefern daher der eigentlichen Arbeiterklasse beständig neue Rekruten. Die einzige grosse Industrie Irlands, die Leinenfabrikation, braucht verhältnissmässig wenig erwachsne männliche Arbeiter und beschäftigt überhaupt, trotz ihrer Expansion seit der Vertheurung der Baumwolle, nur einen verhältnissmässig unbedeutenden Theil der Arbeitermasse. Gleich jeder andern grossen Industrie producirt sie durch die beständigen Schwankungen in ihrer eignen Sphäre beständig eine relative Uebervölkerung, selbst bei absolutem Wachsthum der von ihr absorbirten Arbeiterzahl. Die Misère des Landvolks bildet das Piedestal riesenhafter Hemdenfabriken u. s. w., deren Arbeiterarmee zum grössten Theil über das flache Land zerstreut ist. Wir finden hier das früher geschilderte System der Hausarbeit wieder, welches in Unterzahlung und Ueberarbeit seine methodischen Mittel der „Ueberzähligmachung“ besitzt. Endlich, obschon die Entvölkerung nicht so zer-
störende Folgen hat, wie in einem Land entwickelter kapitalistischer Produktion, vollzieht sie sich nicht ohne beständigen Rückschlag. Die Emigration lässt nicht nur leere Häuser zurück, sondern auch ruinirte Hausvermiether. Klein wie der Konsum jedes ihrer individuellen Bestandtheile, producirt ihr Gesammtausfall eine beständige Lücke im innern Markt, der namentlich Kleinkrämer, Handwerker und kleine Gewerbsleute überhaupt trifft. Jeder neue Exodus schleudert einen Theil der kleinen Mittelklasse ins Proletariat. Sieh Tabelle E die Abnahme der Einkommen unter 100 Pfd. St.
Der Wochenlohn des Ackerbauers in der Umgegend von Dublin — der Maximallohn des irischen Ackerbauers — steht in diesem Augenblick, bei hohem Preis der ersten Lebensmittel, auf 7 sh. Man kann daraus auf seinen Stand in den rein agrikolen und entlegenen Distrikten zurückschliessen. Zur Schilderung der Lage selbst des geschickten irischen industriellen Arbeiters genügt ein Beispiel.
„Bei meiner neulichen Inspektion des Nordens von Irland“, sagt der englische Fabrikinspektor Robert Baker, „frappirte mich die Bemühung eines geschickten irischen Arbeiters aus den allerdürftigsten Mitteln seinen Kindern Erziehung zu verschaffen. Ich gebe seine Aussage verbatim, wie ich sie aus seinem Mund erhielt. Dass er eine geschickte Fabrikhand, weiss man, wenn ich sage, dass man ihn zu Artikeln für den Manchester Markt verwandte. Johnson: Ich bin ein beetler, und arbeite von 6 Uhr Morgens bis 11 in die Nacht, von Montag bis Freitag; Samstags endigen wir um 6 Uhr Abends und haben 3 Stunden für Mahlzeit und Erholung. Ich habe 5 Kinder. Für diese Arbeit erhalte ich 10 sh. 6 d. wöchentlich; meine Frau arbeitet auch und verdient 5 sh. die Woche. Das älteste Mädchen, zwölfjährig, wartet das Haus. Sie ist unser Koch und einziger Gehülfe. Sie macht die jüngeren zur Schule fertig. Meine Frau steht mit mir auf und geht mit mir fort. Ein Mädchen, die unser Haus entlang geht, weckt mich um halb 6 Uhr Morgens. Wir essen nichts, bevor wir zur Arbeit gehn. Das zwölfjährige Kind sorgt für die Kleineren des Tags über. Wir frühstücken um 8 und gehn dazu nach Hause. Wir haben Thee einmal die Woche; sonst haben wir einen Brei (stirabout), manchmal von Hafermehl, manchmal von indischem Mehl, je nachdem wir fähig sind es zu verschaffen. Im Winter haben wir ein wenig Zucker und Wasser zu unserm indischen Mehl. Im Sommer erndten wir einige Kartoffeln, womit wir selbst ein Bodenfetzchen bepflanzen, und wenn sie zu Ende sind, kehren wir zum Brei zu-
rück. So geht’s Tag aus Tag ein, Sonntag und Werkeltag, das ganze Jahr durch. Ich bin stets sehr müde des Abends nach vollbrachtem Tagwerk. Einen Bissen Fleisch sehn wir ausnahmsweis, aber sehr selten. Drei unsrer Kinder besuchen Schule, wofür wir 1 d. per Kopf wöchentlich zahlen. Unsere Hausmiethe ist 9 d. die Woche, Torf für Feuerung kostet mindestens 1 sh. 6 d. vierzehntägig“(FN 187). Das sind irische Löhne, das ist irisches Leben!
In der That, das Elend Irlands ist wieder Tagesthema in England. Ende 1866 und Anfang 1867 machte sich in der Times einer der irischen Landmagnaten, Lord Dufferin, an die Lösung. „Wie menschlich von solch’ grossem Herrn!“
Aus Tabelle E sah man, dass während 1864 von 4,368,610 Pfd. St. Gesammtprofit 3 Plusmacher nur 262,610, dieselben 3 Virtuosen der „Entsagung“ 1865 von 4,669,979 Pfd. St. Gesammtprofit dagegen 274,448 Pfd. St. einsteckten, 1864: 26 Plusmacher 646,377 Pfd. St., 1865 : 28 Plusmacher 736,448 Pfd. St., 1864 : 121 Plusmacher 1,066,912 Pfd. St., 1865 : 186 Plusmacher 1,320,996 Pfd. St., 1864 : 1131 Plusmacher 2,150,818 Pfd. St., beinahe die Hälfte des jährlichen Gesammtprofits, 1865 : 1194 Plusmacher 2,418,933 Pfd. St., mehr als die Hälfte des jährlichen Gesammtprofits. Der Löwenantheil aber, welchen eine verschwindend kleine Anzahl Landmagnaten in England, Schottland und Irland vom jährlichen Nationalrental verschlingt, ist so monströs, dass die englische Staatsweisheit es angemessen findet, für die Vertheilung der Grundrente nicht dasselbe statistische Material zu liefern wie für die Vertheilung des Profits. Lord Dufferin ist einer dieser Landmagnaten. Dass Rentrollen und Profite jemals „ überzählig“ sein können, oder dass ihre Plethora mit der Plethora des Volkselends irgendwie zusammenhängt, ist natürlich eine ebenso „irrespektable“ als „ungesunde“ (unsound) Vorstellung. Er hält sich an Thatsachen. Die Thatsache ist, dass wie die irische Volkszahl abnimmt, die irischen Rentrollen schwellen, dass die Entvölkerung dem Grundeigenthümer „wohlthut“, also auch dem Grund, also auch dem Volk, das nur ein Accessorium des Bodens ist. Er erklärt also, Irland sei immer noch übervölkert und der Strom der Emigration fliesse
stets noch zu träg. Um vollständig glücklich zu sein, müsse Irland wenigstens noch ⅓ Million Arbeitsmenschen ablassen. Man wähne nicht, dieser obendrein noch poetische Lord sei ein Arzt aus der Schule Sangrado’s, der, so oft er seinen Kranken nicht besser fand, Aderlass verordnete, neuen Aderlass, bis der Patient mit seinem Blut auch seine Krankheit verlor. Lord Dufferin verlangt einen neuen Aderlass von nur ⅓ Million, statt von ungefähr 2 Millionen, ohne deren Ablass in der That das Millennium in Erin nicht herstellbar ist. Der Beweis ist leicht geliefert.
Anzahl und Umfang der Pachten in Irland 1864.
Die Koncentration hat von 1851 bis 1861 hauptsächlich Pachten der ersten 3 Kategorieen, unter 1 und nicht über 15 Acres, vernichtet. Sie müssen vor allem verschwinden. Diess giebt 307,058 „überzählige“ Pächter, und die Familie zum niedrigen Durchschnitt von 4 Köpfen gerechnet, 1,228,232 Personen. Unter der extravaganten Unterstellung, dass ¼ davon nach vollbrachter agrikoler Revolution wieder absorbirbar, bleiben auszuwandern: 921,174 Personen. Die Kategorieen 4, 5, 6, von über 15 und nicht über 100 Acres, sind, wie man längst in England weiss, für den kapitalistischen Kornbau zu klein, für Schafzucht aber fast verschwindende Grössen. Unter denselben Unterstellungen wie vorher sind also fernere 788,761 Personen auszuwandern, Summe: 1,709,532. Und, comme l’appétit vient en mangeant, werden die Augen der Rentrolle bald entdecken, dass Irland mit 3½ Millionen immer noch elend, und elend, weil übervölkert ist, also seine Entvölkerung noch viel weiter gehen muss, damit es seinen wahren Beruf erfülle, den einer englischen Schaftrift und Viehweide.
Diese einbringliche Methode hat wie alles Gute in dieser Welt ihren Missstand. Mit der Accumulation der Grundrente in Irland hält Schritt die Accumulation der Irländer in Amerika. Der durch Schaf und Ochs beseitigte Ire ersteht auf der andern Seite des Oceans als Fenian. Und gegenüber der alten Seekönigin erhebt sich drohend und drohender die junge Riesenrepublik.
Acerba fata Romanos agunt Scelusque fraternae necis. 2) Die s. g. Ursprüngliche Accumulation.↑Man hat gesehn, wie Geld in Kapital verwandelt, mit dem Kapital Mehrwerth und aus dem Mehrwerth mehr Kapital gemacht wird. Indess setzt die Accumulation des Kapitals den Mehrwerth, der Mehrwerth die kapitalistische Produktion, diese aber das Vorhandensein grösserer Kapitalmassen in den Händen von Waarenproducenten voraus. Der ganze Prozess scheint also eine der kapitalistischen Accumulation vorausgehende „ ursprüngliche“ Accumulation („ previous accumulation“ bei Adam Smith) zu unterstellen, eine Accumulation, welche nicht das Resultat der kapitalistischen Produktionsweise ist, sondern ihr Ausgangspunkt.
Diese ursprüngliche Accumulation spielt in der politischen Oekonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleissige Elite und auf der andern faulenzende Lumpen. So kam es, dass die ersten Reichthum accumulirten und die letzteren schliesslich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne Haut. Und von diesem Sündenfall datirt die Armuth der grossen Masse, die immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichthum der Wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten. Solche fade Kinderei kaut Herr Thiers z. B. noch mit staatsfeierlichem Ernst, zur Vertheidigung der propriété, den einst so geistreichen Franzosen vor. Aber sobald die Eigenthumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Erobe-
rung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt die grosse Rolle. In der sanften politischen Oekonomie herrschte von jeher die Idylle. Recht und „Arbeit“ waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von „ diesem Jahr“. In der That sind die Methoden der ursprünglichen Accumulation alles andre, nur nicht idyllisch.
Geld und Waare sind nicht von vornherein Kapital, so wenig wie Produktionsund Lebensmittel. Sie bedürfen der Verwandlung in Kapital. Dieser Verwandlungsprozess selbst kann aber nur unter bestimmten Umständen vorgehn. Sie spitzen sich dahin zusammen: Zweierlei sehr verschiedne Sorten von Waarenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten, einerseits Eigner von Geld, Produktionsund Lebensmitteln, welche die von ihnen geeignete Werthsumme verwerthen wollen durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andrerseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, dass sie weder selbst unmittelbar zu den Produktionsbedingungen gehören, wie Sklaven, Leibeigne u. s. w., noch auch die Produktionsbedingungen ihnen gehören, wie beim selbstwirthschaftenden Bauer u. s. w., sie davon vielmehr frei, los und ledig sind. Mit dieser Polarisation des Waarenmarkts sind die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gegeben. Das Kapitalverhältniss setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigenthum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eignen Füssen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, sondern reproducirt sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozess, der das Kapitalverhältniss schafft, kann also nichts anders sein als der Scheidungsprozess des Arbeiters von den Arbeitsbedingungen, ein Prozess, der einerseits die gesellschaftlichen Lebensund Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Producenten in Lohnarbeiter. Die s. g. ursprüngliche Accumulation ist also nichts als der historische Scheidungsprozess von Producent und Produktionsmittel. Er erscheint als „ ursprünglich“, weil er die Vorgeschichte des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktionsweise bildet.
Man sieht auf den ersten Blick, dass dieser Scheidungsprozess eine
ganze Reihe historischer Prozesse einschliesst, und eine doppelseitige Reihe, einerseits Auflösung der Verhältnisse, die den Arbeiter selbst zum Eigen thum dritter Personen machten und zu einem selbst angeeigneten Produktionsmittel, andrerseits Auflösung des Eigenthums der unmittelbaren Producenten an ihren Produktionsmitteln. Der Scheidungsprozess umfasst also in der That die ganze Entwicklungsgeschichte der modernen bürgerlichen Gesellschaft, eine Geschichte, welche gar keine Schwierigkeiten böte, hätten die bürgerlichen Geschichtschreiber die Auflösung der feudalen Produktionsweise nicht ausschliesslich unter dem clair obscur der Emancipation des Arbeiters dargestellt, statt zugleich als Verwandlung der feudalen in die kapitalistische Exploitationsweise. Der Ausgangspunkt der Entwicklung war die Knechtschaft des Arbeiters. Ihr Fortgang bestand in einem Formwechsel dieser Knechtung. Jedoch erheischt unser Zweck keineswegs Analyse der mittelaltrigen Bewegung. Obgleich die kapitalistische Produktion schon im 14. und 15. Jahrhundert sporadisch ihren Sitz in den Ländern am Mittelmeer aufschlug, datirt die kapitalistische Aera erst vom 16. Jahrhundert. Dort, wo sie aufblüht, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und das mittelaltrige Städtewesen bereits in das Stadium seines Verfalls getreten.
Historisch epochemachend in der Geschichte des Scheidungsprozesses sind die Momente, worin grosse Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzund Produktionsmitteln geschieden und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeitsmarkt geschleudert werden. Die Expropriation der Arbeiter von Grund und Boden bildet die Grundlage des ganzen Prozesses. Wir haben sie also zuerst zu betrachten. Ihre Geschichte nimmt in verschiednen Ländern verschiedne Färbung an und durchläuft die verschiedenen Phasen in verschiedner Reihenfolge. Nur in England, das wir daher als Beispiel nehmen, besitzt sie klassische Form(FN 189).
In England war die Leibeigenschaft im letzten Theil des 14. Jahrhunderts faktisch verschwunden. Die ungeheure Mehrzahl der Bevölkerung(FN 190) bestand damals und noch mehr im 15. Jahrhundert aus freien, selbstwirthschaftenden Bauern, durch welch feudales Aushängeschild ihr Eigenthum immer versteckt sein mochte. Auf den grösseren herrschaftlichen Gütern war der früher selbst leibeigne bailiff (Vogt) durch den freien Pächter verdrängt. Die Lohnarbeiter der Agrikultur bestanden theils aus Bauern, die ihre Mussezeit durch Arbeit bei grossen Grundeigenthümern verwertheten, theils aus einer selbstständigen, relativ und absolut wenig zahlreichen Klasse eigentlicher Lohnarbeiter. Auch letztre waren faktisch zugleich selbstwirthschaftende Bauern, indem sie ausser ihrem Lohn Ackerland zum Belauf von 4 und mehr Acres nebst Cottages angewiesen erhielten. Sie genossen zudem mit den eigentlichen Bauern die Nutzniessung des Gemeindelandes, worauf ihr Vieh weidete und das ihnen zugleich die Mittel der Feuerung, Holz, Torf u. s. w. bot(FN 191). In allen Ländern Europa’s ist die feudale Produktion durch Theilung des Bodens unter möglichst viele Untersassen charakterisirt. Die Macht des Feudalherrn, wie die jeden Souverains, beruhte nicht auf der Länge seiner Rentrolle, sondern auf der Zahl seiner Unterthanen, und letztere hing von der Zahl selbstwirthschaftender Bauern ab(FN 192). Obgleich der englische Boden daher nach der normännischen Eroberung in riesenhafte Baronien vertheilt
ward, wovon eine einzige oft 900 alte angelsächsische Lordschaften einschloss, war er besät von kleinen Bauernwirthschaften, nur hier und da durchbrochen von grösseren herrschaftlichen Gütern. Solche Verhältnisse, bei gleichzeitiger Blüthe des Städtewesens, wie sie das 15. Jahrhundert auszeichnet, erlaubten jenen Volksreichthum, den der Staatskanzler Fortescue so beredt in seinen „ Laudibus Legum Angliae“ schildert, aber sie schlossen den Kapitalreichthum aus.
Das Vorspiel der Umwälzung, welche die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise schuf, ereignet sich im letzten Drittheil des 15. und den ersten Decennien des 16. Jahrhunderts. Eine Masse vogelfreier Proletarier ward auf den Arbeitsmarkt geschleudert durch die Auflösung der feudalen Gefolgschaften, die, wie Sir James Steuart richtig bemerkt, „überall nutzlos Haus und Hof füllten.“ Obgleich die königliche Macht, selbst ein Produkt der bürgerlichen Entwicklung, in ihrem Streben nach absoluter Souverainität die Auflösung dieser Gefolgschaften gewaltsam beschleunigte, war sie keineswegs deren einzige Ursache. Vielmehr im trotzigsten Gegensatz zu Königthum und Parlament, schuf der grosse Feudalherr ein ungleich grösseres Proletariat durch gewaltsame Verjagung der Bauernschaft von dem Grund und Boden, worauf sie denselben feudalen Rechtstitel besass wie er selbst, und durch Usurpation ihres Gemeindelandes. Den unmittelbaren Anstoss dazu gab in England namentlich das Aufblühn der flandrischen Wollmanufaktur, und das entsprechende Steigen der Wollpreise. Den alten Feudaladel hatten die grossen Feudalkriege verschlungen, der neue war ein Kind seiner Zeit, für welche Geld die Macht aller Mächte. Verwandlung von Ackerland in Schafweide ward also sein Losungswort. Harrison, in seiner „ Description of England. Prefixed to Holinshed’s Chronicles“, beschreibt, wie die Expropriation der kleinen Bauern das Land ruinirt. „What care our great incroachers!“ (Was fragen unsre grossen Usurpatoren danach?) Die Wohnungen der Bauern und die Cottages der Arbeiter wurden gewaltsam niedergerissen oder dem Verfall geweiht. „Wenn man“, sagt Harrison, „die älteren Inventarien jeden Ritterguts vergleichen will, so wird man finden, dass unzählige Häuser und kleine Bauernwirthschaften verschwunden sind, dass das Land viel weniger Leute nährt, dass viele Städte verfallen sind, obgleich einige neue aufblühn . . . . Von Städten und Dörfern, die man für Schaftriften zerstört hat, und worin nur noch
die Herrschaftshäuser stehn, könnte ich etwas erzählen.“ Die Klagen jener alten Chroniken sind immer übertrieben, aber sie zeichnen genau den Eindruck der Revolution in den Produktionsverhältnissen auf die Zeitgenossen selbst. Ein Vergleich zwischen den Schriften der Schatzkanzler Fortescue und Thomas Morus veranschaulicht die Kluft zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert. Aus ihrem goldnen Zeitalter, wie Thornton richtig sagt, stürzte die englische Arbeiterklasse ohne alle Zwischenübergänge in das eiserne.
Die Gesetzgebung erschrak vor dieser Umwälzung. Sie stand noch nicht auf der Civilisationshöhe, wo „ Wealth of the Nation“, d. h. Kapitalbildung und rücksichtslose Exploitation und Verarmung der Volksmasse als ultima Thule aller Staatsweisheit gelten. In seiner „ Geschichte Heinrich’s VII.“ sagt Baco: „Um diese Zeit (1489) mehrten sich die Klagen über Verwandlung von Ackerland in Weide (zur Schaftrift u. s. w.), leicht zu versehn durch wenige Hände. Diess brachte einen Verfall des Volks hervor … König und Parlament ergriffen Massregeln wider diese entvölkernde Usurpation der Gemeindeländereien (depopulating inclosures) und die ihr auf dem Fuss folgende entvölkernde Weidewirthschaft (depopulating pasture).“ Ein Akt Heinrich des VII., 1489, c. 19, verbot die Zerstörung aller Bauernhäuser, wozu wenigstens 20 Acres Land gehörten. In einem Akt 25, Heinrich VIII., wird dasselbe Gesetz erneuert. Es heisst darin u. a., dass „viele Pachten und grosse Viehmassen, besonders Schafe, sich in wenigen Händen aufhäufen, wodurch die Grundrenten sehr gewachsen und der Ackerbau (tillage) sehr verfallen, Kirchen und Häuser niedergerissen, wunderbare Volksmassen verunfähigt seien, sich selbst und Familien zu erhalten.“ Das Gesetz verordnet daher den Wiederbau der verfallnen Pachthäuser, bestimmt den Kornbau im Verhältniss zur Schafweide u. s. w. Ein Akt von 1533 klagt, dass manche Eigenthümer 24,000 Schafe besitzen und beschränkt deren Zahl auf 2000. Die Volksklage(FN 193) und die seit Heinrich dem VII. an 150 Jahre fortdauernde Gesetzgebung wider die Expropriation der kleinen Pächter und Bauern waren gleich fruchtlos. Das Geheimniss ihrer
Erfolglosigkeit verräth uns Baco wider Wissen. „Der Akt Heinrich’s VII.,“ sagt er in seinen „ Essays, civil and moral“ Sect. 20, „war tief und bewunderungswürdig, indem er Landwirthschaften und Ackerbauhäuser von bestimmtem Normalmass schuf, d. h. eine Proportion von Land für sie erhielt, die sie befähigte Unterthanen von genügendem Reichthum und ohne servile Lage auf die Welt zu setzen und den Pflug in der Hand von Eigenthümern, nicht von Miethlingen zu halten“ („to keep the plough in the hand of the owners and not hirelings“). Was die kapitalistische Produktion erheischte, war umgekehrt servile Lage der Volksmasse, ihre eigne Verwandlung in Miethlinge, und Verwandlung ihrer Arbeitsmittel in Kapital. Jene ältere Gesetzgebung sucht auch die 4 Acres Land bei der Cottage des ländlichen Lohnarbeiters zu erhalten, wie sie ihm die Aufnahme von Miethsleuten in seine Cottage verbot. Noch 1627, unter Jakob I., wurde Roger Crocker von Frontmill verurtheilt wegen Bau’s einer Cottage im Manor von Frontmill ohne 4 Acres Land als beständiges Annex an dieselbe; noch 1638, unter Karl I., wurde eine königliche Kommission ernannt, um die alten Gesetze, namentlich auch über die 4 Acres Land, zu erzwingen; noch Cromwell verbot Erbauung eines Hauses in 4 Meilen weitem Umkreis von London ohne Ausstattung desselben mit 4 Acres Land. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird geklagt, wenn die Cottage des Landarbeiters kein Zubehör von 1 bis 2 Acres hat. Heutzutag ist er glücklich, wenn sie mit einem Gärtchen ausgestattet ist, oder wenn er weitab von ihr ein Paar Ruthen Land miethen kann. „Landlords und Pächter“, sagt Dr. Hunter, „handeln hier Hand in Hand. Wenige Acres zur Cottage würden den Arbeiter zu unabhängig machen“(FN 194).
Einen neuen furchtbaren Anstoss erhielt der gewaltsame Expropriationsprozess der Volksmasse im 16. Jahrh. durch die Reformation und, in ihrem Gefolge, den kolossalen Diebstahl der Kirchengüter. Die katholische Kirche war zur Zeit der Reformation Feudal-
eigenthümer eines grossen Theils des englischen Grund und Bodens. Die Unterdrückung der Klöster u. s. w. schleuderte deren Einwohner ins Proletariat. Die Kirchengüter selbst wurden grossentheils an raubsüchtige königliche Günstlinge verschenkt oder zu einem Spottpreis an spekulirende Pächter und Stadtbürger verkauft, welche die alten erblichen Untersassen massenhaft verjagten und ihre Wirthschaften zusammenwarfen. Das gesetzlich garantirte Eigenthum verarmter Landleute an einem Theil der Kirchenzehnten ward stillschweigend konfiscirt(FN 195). „Pauper ubique jacet“, rief Königin Elisabeth nach einer Rundreise durch England. Im 43. Jahre ihrer Regierung war man endlich gezwungen, den Pauperismus officiell anzuerkennen durch Einführung der Armensteuer. „Die Urheber dieses Gesetzes schämten sich seine Gründe auszusprechen und schickten es daher, wider alles Herkommen, ohne irgend ein preamble (Eingangsworte) in die Welt“(FN 196). Durch 16. Carolus I., 4 wurde es perpetuell erklärt und erhielt in der That erst 1834 eine neue härtere Form(FN 197). Diese unmittelbaren Wirkungen der Reformation
waren nicht ihre nachhaltigsten. Das Kircheneigenthum bildete das religiöse Bollwerk der alterthümlichen Grundeigenthumsverhältnisse. Mit seinem Fall waren sie nicht länger vertheidigbar(FN 198).
Noch in den letzten Decennien des 17. Jahrhunderts war die Yeomanry, eine unabhängige Bauernschaft, zahlreicher als die Klasse der Pächter. Sie hatte die Hauptstärke Cromwell’s gebildet und stand, selbst nach Macaulay’s Geständniss, in vortheilhaftem Gegensatz zu den versoffenen Mistjunkern und ihren Bedienten, den Landpfaffen, welche die herrschaftliche „Lieblingsmagd“ unter die Haube bringen mussten. Noch waren selbst die ländlichen Lohnarbeiter Miteigenthümer am Gemeindeeigenthum.
1750 ungefähr war die Yeomanry verschwunden(FN 199), und in den letzten Decennien des 18. Jahrhunderts die letzte Spur vom Gemeindeeigenthum der Ackerbauer. Wir sehn hier ab von den rein ökonomischen Agentien der Agrikulturrevolution. Wir fragen nach ihren gewaltsamen Hebeln.
Unter der Restauration der Stuarts setzten die Grundeigenthümer eine Usurpation gesetzlich durch, die sich überall auf dem Kontinent auch ohne gesetzliche Weitläufigkeit vollzog. Sie hoben die Feudalverfassung des Bodens auf, d. h. sie schüttelten seine Leistungspflichten an den Staat ab, „entschädigten“ den Staat durch Steuern auf die Bauernschaft und übrige Volksmasse, vindicirten modernes Privateigenthum an Gütern, worauf sie nur Feudaltitel besassen, und oktroyirten schliesslich jene Niederlassungsgesetze (laws of settlement), die, mutatis mutandis, auf die englischen Ackerbauer wirkten, wie des Tartaren Boris Go dunof Edikt auf die russische Bauernschaft.
Die „ glorious Revolution“ (glorreiche Revolution) brachte mit dem Oranier Wilhelm III.(FN 200) die grundeigenthümlichen und kapitalistischen Plusmacher zur Herrschaft. Sie weihten die neue Aera ein, indem sie den bisher nur bescheiden betriebenen Diebstahl an den
Staatsdomänen auf kolossaler Stufenleiter ausübten. Diese Ländereien wurden verschenkt, zu Spottpreisen verkauft, oder auch durch direkte Usurpation an Privatgüter annexirt(FN 201). Alles das geschah ohne die geringste Beobachtung gesetzlicher Etiquette. Das so fraudulent angeeignete Staatsgut sammt dem Kirchenplunder, so weit er während der republikanischen Revolution nicht abhanden kam, bildet die Grundlage der heutigen fürstlichen Domänen der englischen Oligarchie(FN 202). Die bürgerlichen Kapitalisten begünstigten die Operation, u. a. um den Grund und Boden in einen reinen Handelsartikel zu verwandeln, um ihre Zufuhr vogelfreier Proletarier vom Land zu vermehren u. s. w. Sie handelten für ihr Interesse ganz so richtig als die schwedischen Stadtbürger, deren ökonomisches Bollwerk die Bauernschaft war, wesshalb sie Hand in Hand mit derselben die Könige in der gewaltsamen Resumption der Kronländereien von der Oligarchie (seit 1604, später unter Karl X. und Karl XI.) unterstützten.
Gemeindeeigenthum war eine altgermanische Einrichtung, die unter der Decke der Feudalität fortlebte. Man hat gesehn, wie die gewaltsame Usurpation desselben, meist begleitet von Verwandlung des Ackerlands in Viehweide, Ende des 15. Jahrhunderts beginnt und im 16. Jahrhundert fortdauert. Aber damals vollzog sich der Prozess als individuelle Gewaltthat, wogegen die Gesetzgebung 150 Jahre durch vergeblich ankämpft. Der Fortschritt des 18. Jahrh. offenbart sich darin, dass das Gesetz selbst jetzt zum Vehikel des Raubs am Volksland wird, obgleich die grossen Pächter nebenbei auch ihre kleinen unabhängigen Privatmethoden anwenden(FN 203). Die parlamentarische Form
des Raubs ist die der „ Bills for Inclosures of Commons“ (Bills für Einschluss der Gemeindeländereien), in andern Worten Dekrete, wodurch die Landlords Volkseigenthum sich selbst als Privateigenthum schenken, Dekrete der Volksexpropriation. Sir F. M. Eden widerlegt sein pfiffiges Advokatenplaidoyer, worin er das Gemeindeeigenthum als Privateigenthum der an die Stelle der Feudalen getretenen Landlords darzustellen sucht, indem er selbst einen „ allgemeinen Parlamentsakt für die inclosure der Gemeindeländerei“ verlangt, also zugiebt, dass ein parlamentarischer Staatsstreich zu ihrer Verwandlung in Privateigenthum nöthig ist, andrerseits aber von der Legislatur „ Schadenersatz“ für die exproprürten Armen fordert(FN 204).
Während an die Stelle der unabhängigen Yeomen tenants-atwill traten, kleinere Pächter auf einjährige Kündigung, eine servile und von der Willkühr der Landlords abhängige Rotte, half, neben dem Raub der Staatsdomänen, namentlich der systematisch betriebne Diebstahl des Gemeindeeigenthums jene grossen Pachten anschwellen, die man im 18. Jahrhundert Kapital-Pachten(FN 205) oder Kaufmanns-Pachten(FN 206) nannte, und das Landvolk als Proletariat für die Industrie „freisetzen“.
Das 18. Jahrh. begriff jedoch noch nicht in demselben Mass wie das 19. die Identität zwischen Nationalreichthum und Volksarmuth. Daher heftigste Polemik in der ökonomischen Literatur jener Zeit über die „ inclosure of commons“. Ich gebe aus dem massenhaften Material, das mir vorliegt, einige wenige Stellen, weil dadurch lebhaft die Zustände veranschaulicht werden.
„In vielen Pfarreien von Hertfordshire“, schreibt eine entrüstete Feder, „sind 24 Pachten von 50 bis 150 Acres auf 3 zusammenge-
schmolzen“(FN 207). „In Northamptonshire und Lincolnshire hat der Einschluss der Gemeindeländereien sehr vorgeherrscht und die meisten aus den enclosures entsprungenen neuen Lordschaften sind in Weideland verwandelt; in Folge davon haben viele Lordschaften jetzt nicht 50 Acres unter dem Pflug, wo früher 1500 gepflügt wurden … Ruinen früherer Wohnhäuser, Scheunen, Ställe u. s. w. sind die einzigen Spuren der früheren Einwohner. Hunderte von Häusern und Familien sind an manchen Plätzen zusammengeschrumpft auf 8 oder 10. Der Grundeigenthümer in den meisten Pfarreien, wo der Einschluss erst seit 15 oder 20 Jahren vorging, sind sehr wenige in Vergleich zu den Zahlen, von denen das Land im offnen Feldzustand bebaut wurde. Es ist nichts Ungewöhnliches, 4 oder 5 reiche Viehmäster grosse, jüngst eingeschlossene Lordschaften usurpiren zu sehn, die sich früher in der Hand von 20—30 Pächtern und vielen kleineren Eigenthümern und Insassen befanden. Alle diese sind mit ihren Familien aus ihrem Besitzthum herausgeworfen worden, nebst vielen andren Familien, die durch sie beschäftigt und erhalten wurden“(FN 208). Es war nicht nur brachliegendes, sondern oft, unter bestimmter Zahlung an die Gemeinde, oder gemeinschaftlich bebautes Land, das unter dem Vorwand der „enclosure“ vom angränzenden Landlord annexirt wurde. „Ich spreche hier vom Einschluss offner Felder und Ländereien, die bereits bébaut sind. Selbst die Schriftsteller, welche die Inclosures vertheidigen, geben zu, dass sie in diesem Fall den Feldbau vermindern, die Preise der Lebensmittel erhöhen und Entvölkerung produciren … und selbst die inclosure wüster Ländereien, wie jetzt betrieben, raubt dem Armen einen Theil seiner Subsistenzmittel und schwellt Pachten auf, die bereits zu gross sind“(FN 209). „Wenn“, sagt Dr. Price, „das Land in die Hände einiger weniger grossen Pächter geräth, werden
die kleinen Pächter (früher von ihm bezeichnet als „eine Menge kleiner Eigenthümer und Pächter, die sich selbst und Familien erhalten durch das Produkt des von ihnen bestellten Landes, durch Schafe, Geflügel, Schweine u. s. w., die sie auf das Gemeindeland schicken, so dass sie wenig Gelegenheit zum Kauf von Subsistenzmitteln haben“) verwandelt in Leute, die ihre Subsistenz durch Arbeit für Andre gewinnen müssen und gezwungen sind, für alles, was sie brauchen, zu Markt zu gehn … Es wird vielleicht mehr Arbeit verrichtet, weil mehr Zwang dazu herrscht … Städte und Manufakturen werden wachsen, weil mehr Leute zu ihnen verjagt werden, welche Beschäftigung suchen. Diess ist der Weg, worin die Koncentration der Pachten naturgemäss wirkt und worin sie, seit vielen Jahren, in diesem Königreich thatsächlich gewirkt hat“(FN 210). Er fasst die Gesammtwirkung der inclosures so zusammen: „Im Ganzen hat sich die Lage der niederen Volksklassen fast in ieder Hinsicht verschlechtert, die kleineren Grundbesitzer und Pächter sind herabgedrückt auf den Stand von Taglöhnern und Miethlingen; und zur selben Zeit ist der Lebensgewinn in diesem Zustand schwieriger geworden“(FN 211). In der That wirkten Usurpation des Gemeindelands und die
sie begleitende Revolution der Agrikultur so akut auf die Ackerbauarbeiter, dass, nach Eden selbst, zwischen 1765 und 1780 ihr Lohn anfing unter das Minimum zu fallen und durch officielle Armenunterstützung ergänzt zu werden. Ihr Arbeitslohn, sagt er, „genügte nicht mehr für die absoluten Lebensbedürfnisse.“
Hören wir noch einen Augenblick einen Vertheidiger der enclosures und Gegner des Dr. Price. „Es ist ein durchaus falscher Schluss, dass Entvölkerung vorhanden, weil man Leute nicht länger ihre Arbeit im offnen Feld verwüsten sieht. Sind ihrer jetzt weniger auf dem Land, so sind ihrer desto mehr in den Städten … Wenn nach Verwandlung kleiner Bauern in Leute, die für andere arbeiten müssen, mehr Arbeit flüssig gemacht wird, so ist das ja ein Vortheil, den die Nation (wozu die Verwandelten natürlich nicht gehören) wünschen muss … Das Produkt wird grösser sein, wenn ihre kombinirte Arbeit auf einer Pacht angewandt wird: so wird Surplusprodukt für die Manufakturen gebildet, und dadurch werden Manufakturen, eine der Minen dieser Nation, im Verhältniss zum producirten Kornquantum vermehrt“(FN 212).
Die stoische Seelenruhe, womit der politische Oekonom frechste Schän dung des „heiligen Rechts des Eigenthums“ und gröbste Gewaltthat wider Personen betrachtet, soweit sie erheischt sind, um die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise herzustellen, zeigt uns u.a. der überdem noch torystisch gefärbte und „philanthropische“ Sir F. M. Eden. Die ganze Reihe von Raubthaten, Greueln und Volkselend, welche die gewaltsame Volksexpropriation vom letzten Drittel des 15. bis zum Ende des 18. Jahrh. begleiten, treibt ihn nur zur „comfortablen“ Schlussreflexion: „ Die richtige (due) Proportion zwischen Ackerund Viehland musste hergestellt werden. Noch im ganzen 14. und grössten Theil des 15. Jahrh. kam 1 Acre Viehweide auf 2, 3, und selbst 4 Acres Ackerland. In der
Mitte des 16 Jahrhunderts verwandelte sich die Proportion in 3 Acres Viehland auf 2, später von 2 Acres Viehweide auf 1 Acre Ackerland, bis endlich die richtige Proportion von 3 Acres Viehland auf 1 Acre Ackerland herauskam.“
Im 19. Jahrhundert verlor sich natürlich selbst die Erinnerung des Zusammenhangs zwischen Ackerbauer und Gemeindeeigenthum. Von späterer Zeit gar nicht zu reden, welchen Farthing Ersatz erhielt das Landvolk jemals für die 3,511,770 Acres Gemeinland, die ihm zwischen 1801 und 1831 geraubt und parlamentarisch den Landlords von den Landlords geschenkt wurden?
Der letzte grosse Expropriationsprozess der Ackerbauer von Grund und Boden endlich ist das s. g. „ Clearing of Estates“ ( Lichten der Güter, in der That Wegfegung der Menschen von denselben). Alle bisher betrachteten englischen Methoden kulminirten im „Lichten“. Wie man bei der Schilderung des modernen Zustands im vorigen Abschnitt sah, geht es jetzt, wo unabhängige Bauern nicht mehr wegzufegen sind, bis zum „Lichten“ der Cottages fort, so dass die Ackerbauarbeiter auf dem Boden, den sie bestellen, selbst nicht mehr den nöthigen Raum zur eignen Behausung finden. Indess unterscheidet sich das eigentliche „ Clearing of Estates“ durch den mehr systematischen Charakter, die Grösse der Stufenleiter, worauf die Operation auf einmal ausgeführt wird (in Schottland auf Arealen so gross, wie deutsche Fürstenthümer), und durch die eigenthümliche Form des Grundeigenthums, welches so gewaltsam in modernes Privateigenthum verwandelt wird. Diess Eigenthum war Eigenthum des Clans, der Chef oder „grosse Mann“ nur Titulareigenthümer als Repräsentant des Clans, wie die Königin von England Titulareigenthümerin des englischen Grund und Bodens ist(FN 213). Diese Revolution, welche in Schottland nach der letzten Schilderhebung des Prätendenten begann, kann man in ihren ersten Phasen verfolgen bei Sir James Steuart(FN 214) und
James Anderson(FN 215). Im 18. Jahrh. wurde zugleich den vom Land verjagten Gaelen die Auswanderung verboten, um sie gewaltsam nach Glasgow und anderen Fabrikstädten zu treiben(FN 216). Als Beispiel der im 19. Jahrh. herrschenden Methode(FN 217) genügen hier die „ Lichtungen“ der Gräfin von Sutherland. Diese ökonomisch geschulte Person beschloss gleich bei ihrem Regierungsantritt eine ökonomische Radikalkur vorzunehmen und die ganze Grafschaft, deren Einwohnerschaft durch frühere, ähnliche Prozesse bereits auf 15,000 zusammengeschmolzen war, in Schaftriften zu verwandeln. Von 1814 bis 1820 wurden diese 15,000 Einwohner, ungefähr 3000 Familien, systematisch verjagt und ausgerottet. Alle ihre Dörfer wurden zerstört und niedergebrannt, alle ihre Felder in Weide ver-
wandelt. Britische Soldaten wurden zur Execution kommandirt und kamen zu Schlägen mit den Eingebornen. Eine alte Frau verbrannte in den Flammen der Hütte, die sie zu verlassen sich weigerte. So eignete sich diese Madame 794,000 Acres Land an, das seit undenklicher Zeit dem Clan gehörte. Den vertriebenen Eingebornen wies sie am Seegestad ungefähr 6000 Acres zu, 2 Acres per Familie. Die 6000 Acres hatten bisher wüst gelegen und den Eigenthümern kein Einkommen abgeworfen. Die Gräfin ging in ihrem Nobelgefühl so weit den Acre zu 2 sh. 6 d. Rente im Durchschnitt den Clanleuten zu verpachten, die seit Jahrhunderten ihr Blut für die Familie vergossen hatten. Das ganze geraubte Clanland theilte sie in 29 grosse Schafpachten, jede bewohnt von einer einzigen Familie, meist englische Pachtknechte. Im Jahr 1825 waren die 15,000 Gaelen bereits ersetzt durch 131,000 Schafe. Der an das Seegestad geworfne Theil der Aborigines suchte vom Fischfang zu leben. Sie wurden Amphibien, und lebten, wie ein englischer Schriftsteller sagt, halb auf dem Land und halb auf dem Wasser und lebten mit alledem nur halb von beiden(FN 218).
Aber die braven Gaelen sollten noch schwerer ihre bergromantische Idolatrie für die „grossen Männer“ des Clans abbüssen. Der Fischgeruch stieg den grossen Männern in die Nase. Sie witterten etwas Profitliches dahinter und verpachteten das Seegestade den grossen Fischhändlern von London. Die Gaelen wurden zum zweitenmal verjagt(FN 219).
Endlich aber wird ein Theil der Schaftriften rückverwandelt in Jagdrevier. Man weiss, dass es keine ernsthaften Wälder in England giebt. Das Wild in den Parks der Grossen ist konstitutionelles Haus-
vieh, fett wie Londoner Aldermen. Schottland ist daher das letzte Asyl der „noblen Passion“. „In den Hochlanden,“ sagt Somers, 1848, „sind die Waldungen sehr ausgedehnt worden. Hier auf der einen Seite von Gaick habt ihr den neuen Wald von Glenfeshie, und dort, auf der andern Seite, den neuen Wald von Ardverikie. In derselben Linie habt ihr den Bleak-Mount, eine ungeheure Wüste, neulich errichtet. Von Ost zu West, von der Nachbarschaft von Aberdeen bis zu den Klippen von Obon, habt ihr jetzt eine fortlaufende Waldlinie, während sich in andern Theilen der Hochlande die neuen Wälder von Loch Archaig, Glengarry, Glenmoriston u. s. w. befinden … Die Verwandlung ihres Landes in Schafweide trieb die Gaelen auf unfruchtbareren Boden. Jetzt fängt Rothwild an das Schaf zu ersetzen und treibt jene in noch zermalmenderes Elend … Die Wildwaldungen und das Volk können nicht neben einander existiren. Eins oder das andre muss jedenfalls den Platz räumen. Lasst die Jagden in Zahl und Umfang im nächsten Vierteljahrhundert wachsen wie im vergangenen, und ihr werdet keinen Gaelen mehr auf seiner heimischen Erde finden. Diese Bewegung unter den Hochlands-Eigenthümern ist theils der Mode geschuldet, aristokratischem Kitzel, Jagdliebhaberei u. s. w., theils aber betreiben sie den Wildhandel ausschliesslich mit einem Auge auf den Profit. Denn es ist Thatsache, dass ein Stück Bergland, in Jagdung angelegt, in vielen Fällen ungleich profitabler ist denn als Schaftrift … Der Liebhaber, der ein Jagdrevier sucht, beschränkt sein Angebot nur durch die Weite seiner Börse … Leiden sind über die Hochlande verhängt worden nicht minder grausam als die Politik normännischer Könige sie über England verhing. Rothwild hat freieren Spielraum erhalten, während die Menschen in engen und engeren Zirkel gehetzt wurden … Eine Freiheit des Volks nach der andern ward ihm geraubt … Und die Unterdrückung wächst noch täglich. Die Lichtung und Vertreibung des Volks werden von den Eigenthümern als festes Princip verfolgt, als eine agrikole Nothwendigkeit, ganz wie Bäume und Gesträuch in den Wildnissen Amerika’s und Australiens weggefegt werden, und die Operation geht ihren ruhigen, geschäftsmässigen Gang“(FN 220).
Der Raub der Kirchengüter, die fraudulente Veräusserung der Staatsdomänen, der Diebstahl des Gemeindeeigenthums, die usurpatorische und mit rücksichtslosem Terrorismus vollzogne Verwandlung von feudalem und Claneigenthum in modernes Privateigenthum, es waren ebenso viele idyllische Methoden der ursprünglichen Accumulation. Durch sie ward das Feld für die kapitalistische Agrikultur erobert, der Grund
und Boden dem Kapital einverleibt, der städtischen Industrie die nöthige Zufuhr von vogelfreiem Proletariat geschaffen.
Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch stossweise, gewaltsame Expropriation von Grund und Boden Verjagten, diess vogelfreie Proletariat konnte unmöglich eben so rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbirt werden als es auf die Welt gesetzt ward. Andrerseits konnten die plötzlich aus ihrer gewohnten Lebensbahn Herausgeschleuderten sich nicht eben so plötzlich in die Disciplin des neuen Zustandes finden. Sie verwandelten sich massenhaft in Bettler, Räuber, Vagabunden, zum Theil aus Neigung, in den meisten Fällen durch den Zwang der Umstände. Ende des 15. und während des ganzen 16. Jahrh. daher in ganz Westeuropa eine Blutgesetzgebung wider Vagabundage. Die Väter der jetzigen Arbeiterklasse wurden zunächst für die ihnen angethane Verwandlung in Vagabunden und Paupers gezüchtigt. Die Gesetzgebung behandelte sie als „ freiwillige“ Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existirenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten.
In England begann jene Gesetzgebung unter Heinrich VII.
Heinrich VIII., 1530: Alte und arbeitsunfähige Bettler erhalten eine Bettellicenz. Dagegen Auspeitschung und Einsperrung für handfeste Vagabunden. Sie sollen an einen Karren hinten angebunden und gegeisselt werden, bis das Blut von ihrem Körper strömt, dann einen Eid schwören, zu ihrem Geburtsplatz, oder dorthin, wo sie die letzten drei Jahre gewohnt, zurückzukehren und „sich an die Arbeit zu setzen“ (to put himself to labour). Welche grausame Ironie! 27 Heinrich VIII. wird das vorige Statut wiederholt, aber durch neue Zusätze verschärft. Bei zweiter Ertappung auf Vagabundage soll die Auspeitschung wiederholt und das halbe Ohr abgeschnitten, bei dritter Recidive aber der Betroffene als schwerer Verbrecher und Feind des Gemeinwesens hingerichtet werden.
Edward VI.: Ein Statut aus seinem ersten Regierungsjahr, 1547, verordnet, dass wenn Jemand zu arbeiten weigert, soll er als Sklave der Person zugeurtheilt werden, die ihn als Müssiggänger denuncirt hat. Der Meister soll seinen Sklaven mit Brod und Wasser nähren, schwachem Getränk und solchen Fleischabfällen, die er passend dünkt. Er hat das Recht, ihn zu jeder auch noch so eklen Arbeit durch Auspeitschung und
Ankettung zu treiben. Wenn sich der Sklave für 14 Tage entfernt, ist er zur Sklaverei auf Lebenszeit verurtheilt und soll auf Stirn oder Backen mit dem Buchstaben S gebrandmarkt, wenn er zum drittenmal fortläuft, als Staatsverräther hingerichtet werden. Der Meister kann ihn verkaufen, vermachen, als Sklaven ausdingen, ganz wie anderes bewegliches Gut und Vieh. Unternehmen die Sklaven etwas gegen die Herrschaft, so sollen sie ebenfalls hingerichtet werden. Friedensrichter sollen auf Information den Kerls nachspüren. Findet sich, dass ein Herumstreicher drei Tage gelungert hat, so soll er nach seinem Geburtsort gebracht, mit rothglühendem Eisen auf die Brust mit dem Zeichen V gebrandmarkt, und dort in Ketten auf der Strasse oder zu sonstigen Diensten verwandt werden. Giebt der Vagabund einen falschen Geburtsort an, so soll er zur Strafe der lebenslängliche Sklave dieses Orts, der Einwohner oder Korporation sein und mit S gebrandmarkt werden. Alle Personen haben das Recht, den Vagabunden ihre Kinder wegzunehmen und als Lehrlinge, Jungen bis zum 24. Jahr, Mädchen bis zum 20. Jahr, zu halten. Laufen sie weg, so sollen sie bis zu diesem Alter die Sklaven der Lehrmeister sein, die sie in Ketten legen, geisseln u. s. w. können, wie sie wollen. Jeder Meister darf einen eisernen Ring um Hals, Arme oder Beine seines Sklaven legen, damit er ihn besser kennt und seiner sichrer ist(FN 221). Der letzte Theil dieses Statuts sieht vor, dass gewisse Arme von dem Ort oder den Individuen beschäftigt werden sollen, die ihnen zu essen und zu trinken geben und Arbeit für sie finden wollen. Diese Sorte Pfarreisklaven hat sich bis tief ins 19. Jahrhundert in England erhalten unter dem Namen roundsmen (Umgeher).
Elisabeth, 1572: Bettler ohne Licenz und über 14 Jahre alt sollen hart gepeitscht und am linken Ohrlappen gebrandmarkt werden, falls sie keiner für zwei Jahre in Dienst nehmen will; im Wiederholungsfall, wenn über 18 Jahre alt, sollen sie — hingerichtet werden, falls sie Niemand für zwei Jahre in Dienst nehmen
will, bei dritter Recidive aber ohne Gnade als Staatsverräther hingerichtet werden. Aehnliche Statute: 18 Elisabeth c. 13 und 1597.
Jakob I.: Eine herumwandernde und bettelnde Person wird für einen Landstreicher und Vagabunden erklärt. Die Friedensrichter in den Petty Sessions sind bevollmächtigt, sie öffentlich auspeitschen zu lassen und bei erster Ertappung 6 Monate, bei zweiter 2 Jahre ins Gefängniss zu sperren. Während des Gefängnisses soll sie so oft und so viel gepeitscht werden, als die Friedensrichter für gut halten … Die unverbesserlichen und gefährlichen Landstreicher sollen auf der linken Schulter mit R gebrandmarkt und zur Zwangsarbeit gesetzt, und wenn man sie wieder auf dem Bettel ertappt, ohne Gnade und ohne geistlichen Beistand hingerichtet werden. Diese Anordnungen, gesetzg ültig bis in die erste Zeit des 18. Jahrhunderts, wurden erst aufgehoben durch 12 Anna 23.
Aehnliche Gesetze in Frankreich, wo sich Mitte des 17. Jahrhunderts ein Vagabundenkönigreich (truands) zu Paris etablirt hatte. Noch in der ersten Zeit Ludwig’s XVI. (Ordonnanz vom 13. Juli 1777) sollte jeder gesund gebaute Mensch vom 16. bis 60. Jahr, wenn ohne Existenzmittel und Ausübung einer Profession, auf die Galeeren geschickt werden. Aehnlich das Statut Karl’s V. für die Niederlande vom Oktober 1537, das erste Edikt der Staaten und Städte von Holland vom 19. März 1614, das Plakat der Vereinigten Provinzen vom 25. Juni 1649 u. s. w.
So wurde das von Grund und Boden gewaltsam expropriirte, verjagte und zum grossen Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit nothwendige Disciplin hineingepeitscht, gebrandmarkt, gefoltert.
Es ist nicht genug, dass die Arbeitsbedingungen auf den einen Pol als Kapital treten und auf den andern Pol Menschen, welche nichts zu verkaufen haben als ihre Arbeitskraft. Es genügt auch nicht sie zu zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. Im Fortgang der kapitalistischen Produktion entwickelt sich eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, Gewohnheit die Anforderungen jener Produktionsweise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand, die beständige Erzeugung einer relativen Uebervölkerung hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach Arbeit, und daher den Arbeitslohn, in einem den Verwerthungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden Gleise, der stumme Zwang
der ökonomischen Verhältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten über den Arbeiter. Ausserökonomische, unmittelbare Gewalt wird daher nur ausnahmsweise angewandt. Für den gewöhnlichen Gang der Dinge kann der Arbeiter den „ Naturgesetzen der Produktion“ überlassen werden, d. h. seiner aus den Produktionsbedingungen selbst entspringenden, durch sie garantirten und verewigten Abhängigkeit vom Kapital. Anders während der historischen Genesis der kapitalistischen Produktion. Die aufkommende Bourgeoisie braucht und verwendet die Staatsgewalt, um den Arbeitslohn zu „ reguliren“, d. h. innerhalb der Plusmacherei zusagender Schranken zu zwängen, um den Arbeitstag zu verlängern, und den Arbeiter selbst im normalen Abhängigkeitsgrad zu erhalten. Es ist diess ein wesentliches Moment der s. g. ursprünglichen Accumulation.
Die Klasse der Lohnarbeiter, die in der letzten Hälfte des 14. Jahrh. entstand, bildete damals und im folgenden Jahrhundert nur einen sehr geringen Volksbestandtheil, der in seiner Stellung stark beschützt war durch die selbstständige Bauernwirthschaft auf dem Land und die Zunftorganisation der städtischen Industrie. In Land und Stadt standen sich Meister und Arbeiter social nahe. Die Subsumtion der Arbeit unter das Kapital war nur formell, d. h. die Produktionsweise selbst besass noch keinen specifisch kapitalistischen Charakter. Das variable Element des Kapitals wog sehr vor über sein constantes. Die Nachfrage nach Lohnarbeit wuchs daher rasch mit jeder Accumulation des Kapitals, während die Zufuhr von Lohnarbeit nur langsam nachfolgte. Ein grosser Theil des nationalen Produkts, später in Accumulationsfonds des Kapitals verwandelt, ging damals noch in den Konsumtionsfonds des Arbeiters ein.
Die Gesetzgebung über die Lohnarbeit, von Haus aus auf Exploitation des Arbeiters gemünzt und ihm in ihrem Fortgang stets gleich feindlich(FN 222), wird in England eröffnet durch das Statute of Labourers Edward’s III., 1349. Ihm entspricht in Frankreich die Ordonnanz von 1350, erlassen im Namen des Königs Jean. Die englische und die französische Gesetzgebung laufen parallel und sind dem Inhalt nach iden-
tisch. Soweit die Arbeitsstatuten Verlängerung des Arbeitstags zu erzwingen suchen, komme ich nicht auf sie zurück, da dieser Punkt früher (III. Kapitel, 4. Abschnitt) erörtert.
Das Statute of Labourers wurde erlassen auf dringende Klage des Hauses der Gemeinen. „Früher“, sagt naiv ein Tory, „verlangten die Armen so hohen Arbeitslohn, dass sie Industrie und Reichthum bedrohten. Jetzt ist ihr Lohn so niedrig, dass er ebenfalls Industrie und Reichthum bedroht und vielleicht gefährlicher als damals“(FN 223). Ein gesetzlicher Lohntarif ward festgesetzt für Stadt und Land, für Stückwerk und Tagwerk. Die ländlichen Arbeiter sollen sich aufs Jahr, die städtischen „auf offnem Markt“ verdingen. Es wird bei Gefängnissstrafe untersagt, höheren als den statutarischen Lohn zu zahlen, aber der Empfang höheren Lohns wird stärker bestraft als seine Zahlung. So wird auch noch in Sect. 18 und 19 des Lehrlingsstatuts von Elisabeth zehntägige Gefängnissstrafe über den verhängt, der höheren Lohn zahlt, dagegen einundzwanzigtägige Gefängnissstrafe über den, der ihn nimmt. Das Statut von 1360 verschärft die Strafen und ermächtigt den Meister sogar, durch körperlichen Zwang Arbeit zum gesetzlichen Lohntarif zu erpressen. Alle Kombination, Verträge, Eide u. s. w., wodurch sich Maurer und Zimmerleute wechselseitig banden, werden für null und nichtig erklärt. Arbeiterkoalition wird als schweres Verbrechen behandelt vom 14. Jahrhundert bis 1825, dem Jahr der Abschaffung der Antikoalitionsgesetze. Der Geist des Arbeiterstatuts von 1349 und seiner Nachgeburten leuchtet hell daraus hervor, dass zwar ein Maximum des Arbeitslohns von Staatswegen diktirt wird, aber bei Leibe kein Minimum.
Im 16. Jahrhundert hatte sich, wie man weiss, die Lage der Arbeiter sehr verschlechtert. Der Geldlohn stieg, aber nicht im Verhältniss zur Depreciation des Geldes und dem entsprechenden Steigen der Waarenpreise. Der Lohn fiel also in der That. Dennoch dauerten die Gesetze zum Behuf seiner Herabdrückung fort zugleich mit dem Ohrenabschneiden und Brandmarken derjenigen, „ die Niemand in Dienst nehmen wollte“. Durch das Lehrlingsstatut 5 Elisabeth 3 wurden die Friedensrichter
ermächtigt, gewisse Löhne festzusetzen und nach Jahreszeiten und Waarenpreisen zu modificiren. Jakob I. dehnte diese Arbeitsregulation auch auf Weber, Spinner und alle möglichen Arbeiterkategorieen aus(FN 224), Georg II. die Gesetze gegen Arbeiterkoalition auf alle Manufakturen. In der eigentlichen Manufakturperiode war die kapitalistische Produktionsweise hinreichend erstarkt, um alle gesetzliche Regulation des Arbeitslohns eben so unausführbar als überflüssig zu machen, aber man liebte für den Nothfall das alte Arsenal offen zu halten. Noch 8 George II. verbot für Schneidergesellen in London und Umgegend mehr als 2 sh. 7½ d. Taglohn, ausser in Fällen allgemeiner Trauer, noch 13 George III. c. 68 überwies die Reglung des Arbeitslohns der Seidenwirker den Friedensrichtern, noch 1796 bedurfte es zweier Urtheile der höheren Gerichtshöfe zur Entscheidung, ob friedensrichterliche Befehle über Arbeitslohn auch für NichtAgrikulturarbeiter gültig seien, noch 1799 bestätigte ein Parlamentsakt, dass der Lohn der Grubenarbeiter von Schottland durch ein Statut der Elisabeth und zwei schottische Akte von 1661 und 1671 regulirt sei. Wie sehr unterdess die Verhältnisse revolutionirt waren, bewies ein im
englischen Unterhaus unerhörter Vorfall. Hier, wo man seit mehr als 400 Jahren ausschliesslich Gesetze fabricirt hatte über das Maximum, welches der Arbeitslohn platterdings nicht übersteigen dürfe, schlug Whitbread 1796 ein gesetzliches Lohnminimum für Agrikulturarbeiter vor … Obgleich Pitt sich widersetzte, gab er zu, dass die „Lage der Armen grausam (cruel) sei“. Endlich, 1813, wurden die Gesetze über Lohnregulation abgeschafft. Sie waren eine lächerliche Anomalie, seitdem der Kapitalist durch seine Privatgesetzgebung die Fabrik regulirte und durch die Armensteuer den Lohn des Landarbeiters zum unentbehrlichen Minimum ergänzen liess. Die Bestimmungen der Arbeiterstatute über Kontrakte zwischen Meister und Lohnarbeiter, über Terminkündigung u. dergl., welche nur eine Civilklage gegen den kontraktbrüchigen Meister, aber Kriminalklage gegen den kontraktbrüchigen Arbeiter erlauben, stehn bis zur Stunde in voller Blüthe. Die grausamen Gesetze gegen Koalition fielen 1825 vor der drohenden Haltung des Proletariats. Das Parlament gab sie nur widerwillig auf(FN 225), dasselbe Parlament, welches Jahrhunderte durch mit der cynischsten Unverschämtheit als permanente Koalition der Kapitalisten gegen die Arbeiter funktionirt hatte.
Gleich im Beginn des Revolutionssturms wagte die französische Bourgeoisie das eben erst eroberte Associationsrecht den Arbeitern wieder zu entziehn. Durch Dekret vom 14. Juni 1791 erklärte sie alle Arbeiter koalition für ein „ Attentat auf die Freiheit und die Erklärung der Menschenrechte“, strafbar mit 500 Livres nebst einjähriger Entziehung der aktiven Bürgerrechte(FN 226). Diess Gesetz,
welches den Konkurrenzkampf zwischen Kapital und Arbeit staatspolizeilich innerhalb der dem Kapital bequemen Schranken einzwängt, überlebte Revolutionen und Dynastiewechsel. Selbst die Schreckensregierung liess es unangetastet. Es ward erst ganz neulich aus dem Code Pénal gestrichen. Nichts charakteristischer als der Vorwand dieses bürgerlichen Staatsstreichs. „Obgleich“, sagt Chapelier, der Berichterstatter, „es wünschenswerth, dass der Arbeitslohn höher steige als er jetzt steht, damit der, der ihn empfängt, ausserhalb der absoluten Abhängigkeit sei, welche die Entbehrung der nothwendigen Lebensmittel producirt, und welche fast die Abhängigkeit der Sklaverei ist“, dürfen dennoch die Arbeiter sich nicht über ihre Interessen verständigen, gemeinsam handeln und dadurch ihre „absolute Abhängigkeit, welche fast Sklaverei ist“, mässigen, weil sie eben dadurch „ die Freiheit ihrer ci-devant maîtres, der jetzigen Unternehmer“, verletzen (die Freiheit, die Arbeiter in der Sklaverei zu erhalten!), und weil eine Koalition gegen die Despotie der ehemaligen Meister der Corporationen — man rathe! — eine Herstellung der durch die französische Konstitution abgeschafften Corporationen ist!(FN 227)
Nachdem wir die gewaltsame Schöpfung vogelfreier Proletarier betrachtet, die blutige Disciplin, welche sie in Lohnarbeiter verwandelt, die schmutzige Hauptund Staatsaktion, die mit dem Exploitationsgrad der Arbeit die Accumulation des Kapitals polizeilich steigert, fragt sich, wo kommen die Kapitalisten ursprünglich her? Denn die Expropriation des Landvolks schafft unmittelbar nur grosse Grundeigenthümer. Was die Genesis des Pächters betrifft, so können wir sie so zu sagen mit der Hand betappen, weil sie ein langsamer, über viele Jahrhunderte sich fortwälzender Prozess ist. Die Leibeignen selbst, woneben auch freie kleine Landeigner, befanden sich in sehr verschiednen Besitzverhältnissen und wurden daher auch unter sehr verschiednen ökonomischen Bedingungen emancipirt. In England ist die erste Form des Pächters der selbst leibeigne Bailiff. Seine Stellung ist ähnlich der des altrömischen Villicus, nur in engerer Wirkungssphäre. Während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird er ersetzt durch einen freien Pächter, den der Landlord mit Samen, Vieh und Ackerwerkzeug versieht. Seine Lage ist nicht sehr verschieden von
der des Bauern. Nur beutet er mehr Lohnarbeit aus. Er wird bald Metair, Halbpächter. Er stellt einen Theil des Ackerbaukapitals, der Landlord den andern. Beide theilen das Gesammtprodukt in kontraktlich bestimmter Proportion. Diese Form verschwindet in England rasch, um der des eigentlichen Pächters Platz zu machen, welcher sein eignes Kapital durch Anwendung von Lohnarbeitern verwerthet und einen Theil des Surplusprodukts, in Geld oder in natura, dem Landlord als Grundrente zahlt. So lange, während des 15. Jahrhunderts, der unabhängige Bauer und der neben dem Lohndienst zugleich selbstwirthschaftende Ackerknecht sich selbst durch ihre Arbeit bereichern, bleiben die Umstände des Pächters und sein Produktionsfeld gleich mittelmässig. Die Agrikulturrevolution im letzten Drittheil des 15. Jahrhunderts, die fast während des ganzen 16. Jahrhunderts (jedoch mit Ausnahme seiner letzten Decennien) fortwährt, bereichert ihn eben so rasch als sie das Landvolk verarmt(FN 228). Die Usurpation von Gemeindeweiden u. s. w. erlaubt ihm grosse Vermehrung seines Viehstands fast ohne Kosten, während ihm das Vieh reichlichere Düngungsmittel zur Bestellung des Bodens liefert. Im 16. Jahrh. kommt ein entscheidend wichtiges Moment hinzu. Damals waren die Pachtkontrakte lang, oft für 99 Jahre laufend. Die kontinuirliche Depreciation der edlen Metalle und daher des Geldes trug dem Pächter goldne Früchte. Von allen andren, früher erörterten Umständen abgesehn, senkte sie den Arbeitslohn. Ein Bruchstück desselben wurde dem Pachtprofit annexirt. Das fortwährende Steigen der Preise von Korn, Wolle, Fleisch, kurz sämmtlicher Agrikulturprodukte, schwellte das Geldkapital des Pächters ohne sein Zuthun, während die Grundrente, die er zu zahlen hatte, im veralteten Geldwerth kontrahirt war. So bereicherte er sich gleichzeitig auf Kosten seiner Lohnarbeiter und seines Landlords. Kein Wunder also, wenn England Ende des 16. Jahrhunderts eine Klasse für die damaligen Verhältnisse reicher „Kapitalpächter“ besass(FN 229).
Die stossweise und stets erneuerte Expropriation und Verjagung des Landvolks lieferte, wie man sah, der städtischen Industrie wieder und wieder Massen ganz ausserhalb der Zunftverhältnisse stehender Proletarier, ein weiser Umstand, der den alten Anderson (nicht zu verwechseln mit James Anderson) in seiner Handelsgeschichte an direkte Intervention der Vorsehung glauben lässt. Wir müssen noch einen Augenblick bei diesem Element der ursprünglichen Accumulation verweilen. Der Verdünnung des unabhängigen, selbstwirthschaftenden Landvolks entsprach nicht nur die Verdichtung des industriellen Proletariats, wie Geoffroy Saint-Hilaire die Verdichtung der Weltmaterie hier durch ihre Verdünnung dort erklärt(FN 230). Trotz der verminderten Zahl seiner Bebauer trug der Boden nach wie vor gleich viel oder mehr Produkt, weil die Revolution in den Grundeigenthumsverhältnissen von verbesserten Methoden der Kultur, grösserer Cooperation, Koncentration der Produktionsmittel u. s. w. begleitet war, und weil die ländlichen Lohnarbeiter nicht nur intensiver angespannt wurden(FN 231), sondern auch das Produktionsfeld, worauf sie für sich
selbst arbeiteten, mehr und mehr zusammenschmolz. Mit dem freigesetzten Theil des Landvolks werden also auch seine früheren Nahrungsmittel freigesetzt. Sie verwandeln sich jetzt in stoffliches Element des variablen Kapitals. Der an die Luft gesetzte Bauer muss ihren Werth von seinem neuen Herrn, dem industriellen Kapitalisten, in der Form des Arbeitslohns erkaufen. Wie mit den Lebensmitteln, verhielt es sich mit dem heimischen agrikolen Rohmaterial der Industrie. Es verwandelte sich in ein Element des constanten Kapitals. Man unterstelle z. B. einen Theil der westphälischen Bauern, die zu Friedrich’s II. Zeit alle Flachs, wenn auch keine Seide spannen, gewaltsam expropriirt und von Grund und Boden verjagt, den andern zurückbleibenden Theil aber in Taglöhner grosser Pächter verwandelt. Gleichzeitig erheben sich grosse Flachsspinnereien und Webereien, worin die „Freigesetzten“ nun lohnarbeiten. Der Flachs sieht grad aus wie vorher. Keine Fiber an ihm ist verändert, aber eine neue sociale Seele ist ihm in den Leib gefahren. Er bildet jetzt einen Theil des constanten Kapitals der Manufakturherrn. Früher vertheilt unter eine Unmasse kleiner Producenten, die ihn selbst bauten und in kleinen Portionen mit ihren Familien verspannen, ist er jetzt koncentrirt in der Hand eines Kapitalisten, der andre für sich spinnen und weben lässt. Die in der Flachsspinnerei verausgabte Extraarbeit realisirte sich früher in Extraeinkommen zahlloser Bauernfamilien oder auch, zu Friedrich’s II. Zeit, in Steuern pour le roi de Prusse. Sie realisirt sich jetzt im Profit weniger Kapitalisten. Die Spindeln und Webstühle, früher vertheilt über das flache Land, sind jetzt in wenigen grossen Arbeitskasernen zusammengerückt, wie die Arbeiter, wie das Rohmaterial. Und Spindeln und Webstühle und Rohmaterial sind aus Mitteln unabhängiger Existenz für Spinner und Weber selbst verwandelt in Mittel sie zu kommandiren(FN 232) und ihnen unbezahlte Arbeit auszusaugen. Den grossen Manufakturen sieht man es nicht an, wie den grossen Pachten, dass sie aus vielen kleinen Produktionsstätten zusammengeschlagen und durch die Expropriation vieler kleiner unabhängiger
Producenten gebildet sind. Jedoch lässt sich die unbefangne Anschauung nicht beirren. Zur Zeit Mirabeau’s, des Revolutionslöwen, hiessen die grossen Manufakturen noch manufactures réunies, zusammengeschlagene Werkstätten, wie wir von zusammengeschlagenen Aeckern sprechen. „Man sieht nur“, sagt Mirabeau, „die grossen Manufakturen, wo Hunderte von Menschen unter einem Direktor arbeiten, und die man gewöhnlich vereinigte Manufakturen (manufactures réunies) nennt. Diejenigen dagegen, wo eine sehr grosse Anzahl Arbeiter zersplittert und jeder für seine eigne Rechnung arbeitet, werden kaum eines Blicks gewürdigt. Man stellt sie ganz in den Hintergrund. Diess ist ein sehr grosser Irrthum, denn sie allein bilden einen wirklich wichtigen Bestandtheil des Volksreichthums … Die vereinigte Fabrik (fabrique réunie) wird einen oder zwei Unternehmer wunderbar bereichern, aber die Arbeiter sind nur besser oder schlechter bezahlte Taglöhner und nehmen in Nichts am Wohlsein des Unternehmers Theil. In der getrennten Fabrik (fabrique séparée) dagegen wird Niemand reich, aber eine Menge Arbeiter befindet sich im Wohlstand … Die Zahl der fleissigen und wirthschaftlichen Arbeiter wird wachsen, weil sie in weiser Lebensart, in Thätigkeit ein Mittel erblicken, ihre Lage wesentlich zu verbessern, statt eine kleine Lohnerhöhung zu gewinnen, die niemals ein wichtiger Gegenstand für die Zukunft sein kann, sondern die Leute höchstens befähigt etwas besser von der Hand in den Mund zu leben. Die getrennten individuellen Manufakturen, meist mit kleiner Landwirthschaft verbunden, sind die freien“(FN 233). Die Expropriation und Verjagung eines Theils des Landvolks setzt mit den Arbeitern nicht nur ihre Lebensmittel und ihr Arbeitsmaterial für das industrielle Kapital frei, sie schafft den inneren Markt(FN 234). Der Pächter verkauft nun als Waare und massenhaft Lebens-
mittel und Rohmaterial, die früher grossentheils von ihren ländlichen Producenten und Verarbeitern als unmittelbare Subsistenzmittel verzehrt wurden. Die Manufakturen liefern ihm den Markt. Andrerseits koncentriren sich nicht nur die vielen zerstreuten Kunden, die von den vielen kleinen Producenten ihre lokale Detailzufuhr bezogen, in einen grossen Markt für das industrielle Kapital; ein grosser Theil der früher auf dem Land selbst producirten Artikel wird in Manufakturartikel verwandelt, und das Land selbst in einen Markt für ihren Verkauf. Hand in Hand mit der Expropriation und Losscheidung früher selbstwirthschaftender Bauern von ihren Produktionsmitteln geht so die Vernichtung der ländlichen Nebenindustrie, der Scheidungsprocess von Manufaktur und Agrikultur. Jedoch bringt es die eigentliche Manufakturperiode zu keiner radikalen Umgestaltung. Man erinnert sich, dass sie sich der nationalen Produktion nur sehr stückweis bemächtigt und immer auf städtischem Handwerk und häuslich-ländlicher Nebenindustrie als breitem Hintergrund ruht. Wenn sie letztere unter einer Form, in besondern Geschäftszweigen, auf gewissen Punkten vernichtet, ruft sie dieselbe auf andern wieder hervor, weil sie derselben zur Bearbeitung des Rohmaterials bis zu einem bestimmten Grad hedarf. Sie producirt daher eine neue Klasse kleiner Landleute, welche die Bodenbestellung als Nebenzweig und die industrielle Arbeit zum Verkauf des Produkts an die Manufaktur, direkt, oder auf dem Umweg des Kaufmanns, als Hauptgeschäft treiben. Diess ist ein Grund, wenn auch nicht der Hauptgrund, eines Phänomens, welches den Forscher der englischen Geschichte zunächst verwirrt. Vom letzten Drittheil des 15. Jahrhunderts an findet er fortlaufende, nur in gewissen Intervallen unterbrochne Klage über die zunehmende Kapitalwirthschaft auf dem Land und die progressive Vernichtung der Bauernschaft. Andrerseits findet er sie stets wieder von neuem vor, wenn auch in verminderter Zahl und unter stets verschlechterter
Form(FN 235). Der Hauptgrund ist: England ist vorzugsweise bald Kornbauer, bald Viehzüchter, in Wechselperioden, und mit diesen Schwankungen, die bald nach mehr als halben Jahrhunderten zählen, bald nach wenigen Decennien, schwankt der Umfang des bäuerlichen Betriebs. Erst die grosse Industrie liefert der kapitalistischen Agrikultur mit der Maschinerie die constante Grundlage, expropriirt radikal die ungeheure Mehrzahl des Landvolks und vollendet die Scheidung des Ackerbaus von der häuslich ländlichen Industrie, deren Wurzel sie ausreisst — Spinnerei und Weberei(FN 236). Sie erobert daher auch erst dem industriellen Kapital den ganzen inneren Markt(FN 237).
Die Genesis des industriellen(FN 238) Kapitalisten ging nicht in derselben allmählichen Weise vor wie die des Pächters. Zweifelsohne verwandelten sich manche kleine Zunftmeister und noch mehr selbstständige kleine Handwerker oder auch Lohnarbeiter in kleine Kapitalisten und durch allmählich ausgedehntere Exploitation von Lohnarbeit und entsprechende Accumulation in Kapitalisten sans phrase. In der Kindheitsperiode der kapitalistischen Produktion ging’s vielfach zu wie in der Kindheitsperiode des mittelaltrigen Städtewesens, wo die Frage, wer von den entlaufenen Leibeigenen soll Meister sein und wer Diener, grossentheils durch das frühere oder spätere Datum ihrer Flucht entschieden wurde. Indess entsprach der Schneckengang dieser Methode in keiner Weise den Handelsbedürfnissen des neuen Weltmarkts, welchen die grossen Entdeckungen Ende des 15. Jahrh. geschaffen hatten. Aber das Mittelalter hatte zwei verschiedne Formen des Kapitals überliefert, die in den verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen reifen und, vor der Aera der kapitalistischen Produktionsweise, als Kapital quand même gelten — das Wucherkapital(FN 239) und das Kaufmannskapital. Das durch Wucher und Handel gebildete Geldkapital wurde durch die Feudalverfassung auf dem Land, durch die Zunftverfassung in den Städten an
seiner Verwandlung in industrielles Kapital behindert(FN 240). Diese Schranken fielen mit der Auflösung der feudalen Gefolgschaften, mit der Expropriation und theilweisen Verjagung des Landvolks. Die neue Manufaktur ward in See-Exporthäfen errichtet oder auf Punkten des flachen Landes, ausserhalb der Kontrole des alten Städtewesens und seiner Zunftverfassung. In England daher erbitterter Kampf der incorporated towns gegen diese neuen industriellen Pflanzschulen.
Die Entdeckung der Goldund Silberländer in Amerika, die Ausrottung, Versklavung, und Vergrabung der eingebornen Bevölkerung in die Bergwerke, die Eroberung und Ausplünderung von Ostindien, die Verwandlung von Afrika in ein Geheg zur Handelsjagd auf Schwarzhäute, bezeichnen die Morgenröthe der kapitalistischen Produktionsära. Diese idyllischen Prozesse sind Hauptmomente der ursprünglichen Accumulation. Auf dem Fuss folgt der Handelskrieg der europäischen Nationen, mit dem Erdrund als Schauplatz. Er beginnt mit dem Abfall der Niederlande von Spanien, nimmt Riesendimensionen an in Englands Antijakobinerkrieg, spielt noch fort in den Opiumkriegen gegen China u. s. w.
Diese Methoden der ursprünglichen Accumulation vertheilen sich mehr oder minder, in zeitlicher Reihenfolge, namentlich auf Spanien, Portugal, Holland, Frankreich und England. In England werden sie Ende des 17. Jahrh. systematisch zusammengefasst im Kolonialsystem, Staatsschuldensystem, modernen Steuersystem und Protektionssystem. Diese Methoden beruhn zum Theil auf brutalster Gewalt, wie das Kolonialsystem. Alle aber benutzen die Staatsmacht, die koncentrirte und organisirte Gewalt der Gesellschaft, um den Verwandlungsprozess der feudalen in die kapitalistische Produktionsweise treibhausmässig zu beschleunigen und die Uebergänge abzukürzen. Die Gewalt ist der Geburtshelfer jeder alten Gesellschaft, die mit einer neuen schwanger geht. Sie ist selbst eine ökonomische Potenz.
Von dem christlichen Kolonialsystem sagt ein Mann, der aus dem Christenthum eine Specialität macht, W. Howitt: „Die Barbareien und ruchlosen Greuelthaten der s. g. christlichen Racen, in jeder Region der
Welt und gegen jedes Volk, das sie unterjochen konnten, finden keine Parallele in irgend einer Aera der Weltgeschichte, bei irgend einer Race, ob noch so wild, ungebildet, mitleidslos und schamlos“(FN 241). Die Geschichte der holländischen Kolonialwirthschaft — und Holland war die kapitalistische Musternation des 17. Jahrhunderts — „entrollt ein unübertreffbares Gemälde von Verrath, Bestechung, Meuchelmord und Niedertracht“(FN 242). Nichts charakteristischer als ihr System des Menschendiebstahls in Celebes, um Sklaven für Java zu erhalten. Die Menschenstehler wurden zu diesem Zweck abgerichtet. Der Dieb, der Dolmetscher und der Verkäufer waren die Hauptagenten in diesem Handel, eingeborne Prinzen die Hauptverkäufer. Die weggestohlne Jugend wurde in den Geheimgefängnissen von Celebes versteckt, bis reif zur Verschickung auf die Sklavenschiffe. Ein officieller Bericht sagt: „Diese eine Stadt von Makassar z. B. ist voll von geheimen Gefängnissen, eins schauderhafter als das andre, gepfropft mit Elenden, Opfern der Habsucht und Tyrannei, in Ketten gefesselt, ihren Familien gewaltsam entrissen.“ Um sich Malacca’s zu bemächtigen, bestachen die Holländer den portugiesischen Gouverneur. Er liess sie 1641 in die Stadt ein. Sie eilten sofort zu seinem Hause und meuchelmordeten ihn, um auf die Zahlung der Bestechungssumme von 21,875 Pfd. St. zu „ entsagen“. Wo sie die Füsse hinsetzten, folgte Verödung und Entvölkerung. Die Population einer Provinz von Java, Baniyuawngy, zählte 1750 über 80,000 Einwohner, 1811 nur noch 8000. Das ist der doux commerce!
Die englisch-ostindische Kompagnie erhielt bekanntlich, ausser der politischen Herrschaft in Ostindien, das exklusive Monopol des Theehandels, wie des chinesischen Handels überhaupt und des Gütertransports von und zu Europa. Aber die Küstenschifffahrt von Indien und zwischen
den Inseln, wie der Handel im Innern Indiens wurden Monopol der höhern Beamten der Kompagnie. Die Monopole von Salz, Opium, Betel und andern Waaren waren unerschöpfliche Minen des Reichthums. Die Beamten selbst setzten die Preise fest und schindeten nach Belieben den unglücklichen Hindu. Der Generalgouverneur nahm Theil an diesem Privathandel. Seine Günstlinge erhielten Kontrakte unter Bedingungen, wodurch sie, klüger als die Alchymisten, aus Nichts Gold machten. Grosse Vermögen sprangen wie die Pilze an einem Tage auf, die ursprüngliche Accumulation ging von Statten ohne Vorschuss eines Schillings. Die gerichtliche Verfolgung des Warren Hastings wimmelt von solchen Beispielen. Hier ein Fall. Ein Opiumkontrakt wird einem gewissen Sullivan zugetheilt, obgleich er in öffentlichem Auftrag zu einem von den Opiumdistrikten ganz entlegenen Theil Indiens reiste. Sullivan verkauft seinen Kontrakt für 40,000 Pfd. St. an einen gewissen Binn, Binn verkauft ihn seinerseits denselben Tag für 60,000 Pfd. St., und der schliessliche Käufer und Ausführer des Kontrakts erklärt, dass er hinterher noch einen ungeheuren Gewinn herausschlug. Nach einer dem Parlament vorgelegten Liste liessen sich die Kompagnie und ihre Beamten von 1757—1766 von den Indiern 6 Millionen Pfd. St. schenken! Zwischen 1769 und 1770 fabricirten die Engländer eine Hungersnoth durch den Aufkauf von allem Reis und durch Weigerung des Wiederverkaufs ausser zu fabelhaften Preisen(FN 243).
Die Behandlung der Eingeborenen war natürlich am tollsten in den nur zum Exporthandel bestimmten Pflanzungen, wie Westindien, und in den dem Raubmord preisgegebnen reichen und dichtbevölkerten Ländern, wie Mexico und Ostindien. Jedoch auch in den eigentlichen Kolonien verläugnete sich der christliche Charakter der ursprünglichen Accumulation nicht. Jene nüchternen Virtuosen des Protestantismus, die Puritaner, setzten durch Beschlüsse ihrer Assembly 1703 eine Prämie von 40 Pfd. St. auf jedes indianische Scalp und jede gefangne Rothhaut, 1720 Prämie von 100 Pfd. St. auf jedes Scalp, 1744, nachdem MassachussetsBay einen gewissen Tribus zum Rebellen erklärt hatte, folgende Preise:
für männliches Scalp, 12 Jahre und drüber, 100 Pfd. St. neuer Währung, für männliche Gefangene 105 Pfd. St., für gefangene Weiber und Kinder 55 Pfd. St., für Scalps von Weibern und Kindern 50 Pfd. St.! Einige Decennien später rächte sich das Kolonialsystem an der unterdess aufrührisch gewordenen Nachkommenschaft der frommen pilgrim fathers. Unter englischem Antrieb und Sold wurden sie tomahawked. Das britische Parlament erklärte Bluthunde und Scalpiren für „Mittel, welche Gott und die Natur in seine Hand gegeben.“
Das Kolonialsystem reifte treibhausmässig Handel und Schifffahrt. Die „Gesellschaften Monopolia“ (Luther) waren gewaltige Hebel der Kapital-Koncentration. Den aufschiessenden Manufakturen sicherte die Kolonie Absatzmarkt und eine durch das Marktmonopol potenzirte Accumulation. Der ausserhalb Europa direkt erplünderte, herausgesklavte und herausgemordete Schatz floss ins Mutterland zurück und verwandelte sich hier in Kapital. Holland, welches das Kolonialsystem zuerst völlig entwickelte, stand schon 1648 im Brennpunkt seiner Handelsgrösse. Es war „in fast ausschliesslichem Besitz des ostindischen Handels und des Verkehrs zwischen dem europäischen Südwesten und Nordosten. Seine Fischereien, Seewesen, Manufakturen übertrafen die eines jeden anderen Landes. Die Kapitalien der Republik waren vielleicht bedeutender als die des übrigen Europa insgesammt.“ Jülich vergisst hinzuzusetzen: Hollands Volksmasse war schon 1648 mehr überarbeitet, verarmter und brutaler unterdrückt als die des übrigen Europa’s insgesammt. Das Kolonialsystem warf mit einem Schub und Bautz alle alten Götzen über Haufen. Es proklamirte die Plusmacherei als letzten und einzigen Zweck der Menschheit. Es war die Geburtsstätte des modernen Staatsschuldenund Kreditsystems.
Die auffallende Rolle des Staatsschuldenund modernen Steuersystems bei der Verwandlung des gesellschaftlichen Reichthums in Kapital, der Expropriation selbstständiger Arbeiter, und der Herunterdrückung der Lohnarbeiter, hat manche Schriftsteller, wie W. Cobbett, Doubleday u. s. w. verleitet dort den Grund alles modernen Volkselends zu suchen. Mit den Staatsschulden entsprang zugleich ein internationales Kreditwesen, welches oft die Quelle der ursprünglichen Accumulation in einem bestimmten Land versteckt. Die Gemeinheiten des venetianischen Raubsystems z. B. bilden eine verborgne Grundlage des Kapitalreichthums
von Holland, dem das verfallende Venedig grosse Geldsummen lieh. Ebenso verhält es sich zwischen Holland und England. Schon im Anfang des 18. Jahrhunderts sind die Manufakturen Hollands weit überflügelt und hat es aufgehört, herrschende Industrieund Handelsnation zu sein. Eins seiner Hauptgeschäfte von 1701—1776 wird daher das Ausleihn ungeheurer Kapitalien, speziell an seinen übermächtigen Konkurrenten England. Aehnliches gilt jetzt von England und den Vereinigten Staaten. Manch Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten ohne Geburtsschein auftritt, ist erst gestern in England kapitalisirtes Kinderblut.
Das Protektions system war ein Kunstmittel Fabrikanten zu fabriciren, unabhängige Arbeiter zu expropriiren, die nationalen Produktionsund Lebensmittel zu kapitalisiren, den Uebergangaus der alterthümlichen in die moderne Produktionsweise gewaltsam abzukürzen. Die europäischen Staaten rissen sich um das Patent dieser Erfindung, und einmal in den Dienst der Plusmacher eingetreten, brandschatzten sie zu jenem Behuf nicht nur das eigne Volk, indirekt durch Schutzzölle, direkt durch Exportprämien u. s. w. In den abhängigen Nebenlanden wurde alle Industrie gewaltsam ausgerodet, wie z. B. die irische Wollmanufaktur von England. Auf dem europäischen Kontinent ward nach Colbert’s Vorgang der Prozess noch sehr vereinfacht. Das ursprüngliche Kapital des Industriellen fliesst hier zum Theil direkt aus dem Staatsschatz. „Warum,“ ruft Mirabeau, „so weit die Ursache des Manufakturglanzes Sachsens vor dem siebenjährigen Krieg suchen gehn? 180 Millionen Staatsschulden“(FN 244)!
Kolonialsystem, Staatsschulden, Steuerwucht, Protektion, Handelskriege u. s. w., diese Sprösslinge der eigentlichen Manufakturperiode, schwellen riesenhaft während der Kinderperiode der grossen Industrie. Die Geburt der letzteren wird gefeiert durch den grossen herodischen Kinderraub. So blasirt Sir F. M. Eden ist über die Greuel der Expropriation des Landvolks von Grund und Boden seit dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts bis zu seiner Zeit, dem Ende des 18. Jahrhunderts; so selbstgefällig er gratulirt zu diesem Prozess, „nothwendig“, um die kapi-
talistische Agrikultur und „das wahre Verhältniss von Ackerland und Viehweide herzustellen“, beweist er dagegen nicht dieselbe ökonomische Einsicht in die Nothwendigkeit des Kinderraubs und der Kindersklaverei für die Verwandlung des Manufakturbetriebs in den Fabrikbetrieb und die Herstellung des wahren Verhältnisses von Kapital und Arbeitskraft. Er sagt: „Es mag vielleicht der Erwägung des Publikums werth sein, ob irgend eine Manufaktur, die zu ihrer erfolgreichen Ausführung Cottages und Workhouses von armen Kindern ausplündern muss, damit sie, truppweis sich ablösend, den grössten Theil der Nacht durch abgerackert und der Ruhe beraubt werden, eine Manufaktur, die ausserdem Haufen beiderlei Geschlechts, von verschiednen Altersstufen und Neigungen, so zusammenhudelt, dass die Ansteckung des Beispiels zu Verworfenheit und Liederlichkeit führen muss, ob solch eine Manufaktur die Summe des nationalen und individuellen Glücks vermehren kann“(FN 245)? „In Derbyshire, Nottinghamshire und besonders Lancashire,“ sagt Fielden, „wurde die jüngst erfundne Maschinerie angewandt in grossen Fabriken, dicht bei Strömen fähig das Wasserrad zu drehn. Tausende von Händen waren plötzlich erheischt an diesen Plätzen, fern von den Städten; und Lancashire namentlich, bis zu jener Zeit vergleichungsweis dünn bevölkert und unfruchtbar, bedurfte jetzt vor allem einer Population. Die kleinen und flinken Finger waren vor allen in Requisition. Sofort sprang die Gewohnheit auf, Lehrlinge(!) aus den verschiedenen Pfarrei-Workhouses von London, Birmingham und sonstwo zu beziehn. Tausende dieser kleinen hilflosen Kreaturen wurden so nach dem Norden spedirt, vom 7. — 13. oder 14. Jahr. Es war die Gewohnheit für den Meister (d. h. den Kinderdieb), seine Lehrlinge zu kleiden, nähren und logiren in einem Lehrlingshaus nah bei der Fabrik. Aufseher wurden bestellt um ihre Arbeit zu überwachen. Es war das Interesse dieser Sklaventreiber die Kinder aufs Aeusserste abzuarbeiten, denn ihre Zahlung stand im Verhältniss zur Quantität Produkt, die aus dem Kind erpresst werden konnte. Grausamkeit war natürliche Folge . . . . In vielen Fabrikdistrikten, besonders Lancashire’s, wurden die herzzerreissendsten Torturen prakticirt an diesen harmlosen und freundlosen Kreaturen, die den Fabrikherrn consignirt waren. Sie wurden zu Tod gehetzt durch Arbeitsexcesse; sie wurden gepeitscht, gekettet und gefoltert mit
dem ausgesuchtesten Raffinement von Grausamkeit; sie wurden in vielen Fällen bis zu den Knochen ausgehungert, während die Peitsche sie an der Arbeit hielt. Ja in einigen Fällen wurden sie zum Selbstmord getrieben! … Die schönen und romantischen Thäler von Derbyshire, Nottinghamshire und Lancashire, abgeschlossen vom öffentlichen Auge, wurden grause Einöden von Tortur und — oft von Mord! … Die Profite der Fabrikanten waren enorm. Das wetzte nur ihren Wehrwolfsheisshunger. Sie begannen die Praxis der Nachtarbeit, d. h. nachdem sie eine Gruppe Hände durch das Tagwerk gelähmt, hatten sie eine andre Gruppe für das Nachtwerk zur Hand; die Tagesgruppe wanderte in die Betten, welche die Nachtgruppe grade verlassen hatte und vice versa. Es ist Volksüberlieferung in Lancashire, dass die Betten nie abkühlten“(FN 246).
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktion während der Manufakturperiode hatte die öffentliche Meinung von Europa den letzten Rest von Schamgefühl und Gewissen eingebüsst. Die Nationen renommirten cynisch mit jeder Infamie, die Mittel zu Kapitalaccumulation. Man lese z. B. die naiven Handelsannalen des Biedermanns Anderson. Hier wird es als Triumph englischer Staatsweisheit ausposaunt, dass Eng-
land im Frieden von Utrecht den Spaniern durch den Asientovertrag das Privilegium abzwang, den Negerhandel, den es bisher nur zwischen Afrika und dem englischen Westindien betrieb, nun auch zwischen Afrika und dem spanischen Amerika betreiben zu dürfen. England erhielt das Recht, das spanische Amerika bis 1743 jährlich mit 4800 Negern zu versorgen. Diess gewährte zugleich einen officiellen Deckmantel für den britischen Schmuggel. Liverpool wuchs gross auf der Basis des Sklavenhandels. Er bildet seine Methode der ursprünglichen Accumulation. Und bis heutzutag blieb die Liverpooler „Ehrbarkeit“ Pindar des Sklavenhandels, welcher — vgl. die citirte Schrift des Dr. Aikin von 1795 — „den commerciellen Unternehmungsgeist bis zur Leidenschaft steigere, famose Seeleute bilde, und enormes Geld einbringe.“ Liverpool beschäftigte 1730 im Sklavenhandel 15 Schiffe, 1751: 53, 1760: 74, 1770: 96 und 1792: 132.
Während sie die Kindersklaverei in England einführte, gab die Baumwollindustrie zugleich den Anstoss zur Verwandlung der früher mehr oder minder patriarchalischen Sklavenwirthschaft der Vereinigten Staaten in ein commercielles Exploitationssystem. Ueberhaupt bedurfte die verhüllte Sklaverei der Lohnarbeiter in Europa zum Piedestal die Sklaverei sans phrase in der neuen Welt(FN 247).
Tantae molis erat, die „ ewigen Naturgesetze“ der kapitalistischen Produktionsweise zu entbinden, den Scheidungsprozess zwischen Arbeitern und Arbeitsbedingungen zu vollziehn, auf dem einen Pol die gesellschaftlichen Produktionsund Lebensmittel in Kapital zu verwandeln, auf dem Gegenpol die Volksmasse in Lohnarbeiter, in freie „ arbeitende Arme“, diess Kunstprodukt der modernen Geschichte(FN 248). Wenn
das Geld, nach Augier, „mit natürlichen Blutflecken auf einer Backe zur Welt kömmt“(FN 249), so das Kapital von Kopf bis Zeh, aus allen Poren, blutund schmutztriefend(FN 250).
Worauf kömmt die ursprüngliche Accumulation des Kapitals, d. h. seine historische Genesis, hinaus? Soweit sie nicht unmittelbare Verwandlung von Sklaven und Leibeigenen in Lohnarbeiter, also blosser Formwechsel ist, bedeutet sie nur die Expropriation der unmittelbaren Producenten, d. h. die Auflösung des auf eigner Arbeit beruhenden Privateigenthums. Das Privateigenthum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln ist die Grundlage des Kleinbetriebs, der Kleinbetrieb eine nothwendige Bedingung für die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion und der freien Individualität des Arbeiters selbst. Allerdings existirt diese Produktionsweise auch
innerhalb der Sklaverei, Leibeigenschaft und anderer Abhängigkeitsverhältnisse. Aber sie blüht nur, schnellt nur ihre ganze Energie, erobert nur die adäquate klassische Form, wo der Arbeiter freier Privateigenthümer seiner von ihm selbst gehandhabten Arbeitsbedingungen ist, der Bauer des Ackers, den er bestellt, der Handwerker des Instruments, womit er als Virtuose spielt. Diese Produktionsweise unterstellt Zersplitterung des Bodens und der übrigen Produktionsmittel. Mit der Koncentration der letztern schliesst sie die Cooperation, Theilung der Arbeit innerhalb derselben Produktionsprozesse, gesellschaftliche Beherrschung und Reglung der Natur, Entwicklung gesellschaftlicher Produktivkraft aus. Sie ist nur verträglich mit engen naturwüchsigen Schranken der Produktion und der Gesellschaft. Auf einem gewissen Höhegrad bringt sie die materiellen Mittel ihrer eignen Vernichtung zur Welt. Von diesem Augenblick regen sich Kräfte und Leidenschaften im Gesellschaftsschoose, welche sich von ihr gefesselt fühlen. Sie muss vernichtet werden, sie wird vernichtet. Ihre Vernichtung, die Verwandlung der individuellen und zersplitterten Produktionsmittel in gesellschaftlich concentrirte, daher des zwerghaften Eigenthums Vieler in das massenhafte Eigenthum Weniger, daher die Expropriation der grossen Volksmasse von Grund und Boden und Lebensmitteln und Arbeitsinstrumenten, diese furchtbare und schwierige Expropriation der Volksmasse bildet die Vorgeschichte des Kapitals. Sie umfasst eine Reihe gewaltsamer Methoden, wovon wir nur die epochemachenden als Methoden derursprünglichen Accumulation des Kapitals Revue passiren liessen. Die Expropriation der unmittelbaren Producenten wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften vollbracht. Das selbst erarbeitete, sozusagen auf Verwachsung des isolirten, unabhängigen Arbeitsindividuums mit seinen Arbeitsbedingungen beruhende Privateigenthum wird verdrängt durch das kapitalistische Privateigenthum, welches auf Exploitation fremder, aber formell freier Arbeit beruht(FN 251). Sobald dieser Umwand
lungsprozess nach Tiefe und Umfang die alte Gesellschaft hinreichend zersetzt hat, sobald die Arbeiter in Proletarier, ihre Arbeitsbeding ungen in Kapital verwandelt sind, sobald die kapitalistische Produktionsweise auf eignen Füssen steht, gewinnt die weitere Vergesellschaftung der Arbeit und weitere Verwandlung der Erde und andrer Produktionsmittel in gesellschaftlich ausgebeutete, also gemeinschaftliche Produktionsmittel, daher die weitere Expropriation der Privateigenthümer, eine neue Form. Was jetzt zu expropriiren ist, ist nicht länger der selbstwirthschaftende Arbeiter, sondern der viele Arbeiter exploitirende Kapitalist. Diese Expropriation vollzieht sich durch das Spiel der immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion selbst, durch die Koncentration der Kapitalien. Je ein Kapitalist schlägt viele todt. Hand in Hand mit dieser Koncentration oder der Expropriation vieler Kapitalisten durch Wenige entwickelt sich die cooperative Form des Arbeitsprozesses auf stets wachsender Stufenleiter, die bewusste technologische Anwendung der Wissenschaft, die planmässig gemeinsame Ausbeutung der Erde, die Verwandlung der Arbeitsmittel in nur gemeinsam verwendbare Arbeitsmittel, und die Oekonomisirung aller Produktionsmittel durch ihren Gebrauch als gemeinsame Produktionsmittel kombinirter, gesellschaftlicher Arbeit. Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vortheile dieses Umwandlungsprozesses usurpiren und monopolisiren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtung, der Degradation, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisirten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Koncentration der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigenthums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriirt.
Die kapitalistische Produktionsund Aneignungsweise, daher das kapitalistische Privateigenthum, ist die erste Negation des individuellen, aufeigne Arbeit gegründeten Privateigenthums. Die Negation der kapitalistischen Produktion wird durch
sie selbst, mit der Nothwendigkeit eines Naturprozesses, producirt. Es ist Negation der Negation. Diese stellt das individuelle Eigenthum wieder her, aber auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Aera, der Cooperation freier Arbeiter und ihrem Gemeineigenthum an der Erde und den durch die Arbeit selbst producirten Produktionsmitteln.
Die Verwandlung des zersplitterten, auf eigner Arbeit der Individuen beruhenden Privateigenthums in kapitalistisches ist natürlich ein ungleich mehr langwieriger, harter und schwieriger Prozess als die Verwandlung des faktisch bereits auf gesellschaftlicher Exploitation der Produktionsmittel beruhenden kapitalistischen Privateigenthums in gesellschaftliches Eigenthum. Dort handelte es sich um die Expropriation der Volksmasse durch wenige Usurpatoren, hier handelt es sich um die Expropriation weniger Usurpatoren durch die Volksmasse(FN 252).
3) Die moderne Kolonisationstheorie(FN 253).↑Die politische Oekonomie sucht principiell die angenehmste Verwechslung aufrecht zu erhalten zwischen dem auf eigner Arbeit beruhenden Privateigenthum und dem diametral entgegengesetzten, auf Vernichtung dieser Art Eigenthums beruhenden kapita
listischen Privateigenthum. Im Westen von Europa, dem Heimathsland der politischen Oekonomie, ist der Prozess der ursprünglichen Accumulation vollbracht. Die kapitalistische Produktionsweise hat hier entweder die ganze nationale Produktion direkt unterworfen, oder, wo die Verhältnisse minder entwickelt sind, kontrolirt sie indirekt die noch neben ihr fortexistirenden, verkommenden, der veralteten Produktionsweise angehörigen Gesellschaftsschichten. Auf diese fertige Welt des Kapitals wendet der politische Oekonom mit desto ängstlicherem Eifer und desto grösserer Salbung die Rechtsund Eigenthumsvorstellungen der vorkapitalistischen Welt an, je lauter die Thatsachen seiner Ideologie ins Gesicht schreien. Anders in den Kolonien. Die kapitalistische Produktionsund Aneignungsweise stösst hier überall auf das Hinderniss des selbsterarbeiteten Eigenthums, des Producenten, der als Privateigenthümer seiner eignen Arbeitsbedingungen durch seine Arbeit sich selbst statt den Kapitalisten bereichert. Der Widerspruch dieser zwei diametral entgegengesetzten Produktionsund Aneignungs weisen existirt hier praktisch. Wo der Kapitalist die Macht des Mutterlandes im Rücken hat, sucht er die auf eigner Arbeit beruhende Produktionsund Aneignungsweise gewaltsam aus dem Weg zu räumen. Dasselbe Interesse, welches den Sykophanten des Kapitals, den politischen Oekonomen, im Mutterland bestimmt, die kapitalistische Produktionsweise theoretisch für ihr eignes Gegentheil zu erklären, dasselbe Interesse treibt ihn hier „to make a clear breast of it“ und den Gegensatz beider Produktionsweisen zu proklamiren. Zu diesem Behuf weist er nach, wie die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit, Cooperation, Arbeitstheilung, Anwendung der Maschinerie im Grossen u. s. w. unmöglich sind ohne die Expropriation der Arbeiter und entsprechende Verwandlung ihrer Produktionsmittel in Kapital. Im Interesse des s. g. Nationalreichthums sucht er nach Kunstmitteln zur Herstellung der Volksarmuth. Sein apologetischer Panzer zerbröckelt hier Stück für Stück wie mürber Zunder. Es ist das grosse Verdienst E. G. Wakefield’s, nicht irgend etwas neues über die Kolonien(FN 254), aber in den
Kolonien die Wahrheit über die kapitalistischen Verhältnisse des Mutterlands entdeckt zu haben. Wie das Protektionssystem in seinen Ursprüngen(FN 255) die Fabrikation von Kapitalisten im Mutterland, so erstrebt Wakefield’s Kolonisationstheorie, welche England eine Zeit lang gesetzlich ins Werk zu setzen suchte, die Fabrikation von Lohnarbeitern in den Kolonien. Das nennt er „ systematic colonization“ (systematische Kolonisation).
Zunächst entdeckte Wakefield in den Kolonien, dass das Eigenthum an Geld, Lebensmitteln, Maschinen und andern Produktionsmitteln einen Menschen noch nicht zum Kapitalisten stempelt, wenn die Ergänzung fehlt, der Lohnarbeiter, der andre Mensch, der sich selbst freiwillig zu verkaufen gezwungen ist. Er entdeckte, dass das Kapital nicht eine Sache ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes gesellschaftliches Verhältniss zwischen Personen(FN 256). Herr Peel, jammert er uns vor, nahm Lebensmittel und Produktionsmittel zum Belauf von 50,000 Pfd. St. aus England nach dem Swan River, Neuholland, mit. Herr Peel war so vorsichtig, ausserdem 3000 Personen der arbeitenden Klasse, Männer, Weiber und Kinder mitzubringen. Einmal am Bestimmungsplatz angelangt, „blieb Herr Peel ohne einen Diener sein Bett zu machen oder ihm Wasser aus dem Fluss zu schöpfen“(FN 257). Unglücklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht den Export der englischen Produktionsverhältnisse nach dem Swan River!
Zum Verständniss der folgenden Entdeckungen Wakefield’s zwei Vorbemerkungen. Man weiss: Produktionsund Lebensmittel als Eigenthum des unmittelbaren Producenten, des Arbeiters selbst, sind kein
Kapital. Sie werden Kapital nur unter Bedingungen, worin sie zugleich als Exploitationsund Beherrschungsmittel des Arbeiters dienen. Diese ihre kapitalistische Seele ist aber im Kopfe des politischen Oekonomen so innig mit ihrer stofflichen Substanz vermählt, dass er sie unter allen Umständen Kapital tauft, auch wo sie das grade Gegentheil sind. So bei Wakefield. Ferner: die Zersplitterung der Produktionsmittel als individuelles Eigenthum vieler von einander unabhängiger, selbstwirthschaftender Arbeiter nennt er gleiche Theilung des Kapitals. Es geht dem politischen Oekonomen, wie dem feudalen Juristen. Letzterer klebte auch auf reine Geldverhältnisse seine feudalen Rechtsetiquetten.
„Wäre“, sagt Wakefield, „das Kapital unter alle Mitglieder der Gesellschaft in gleiche Portionen getheilt, so hätte kein Mensch ein Interesse mehr Kapital zu accumuliren als er mit seinen eignen Händen anwenden kann. Diess ist in gewissem Grad der Fall in neuen amerikanischen Kolonien, wo die Leidenschaft für Grundeigenthum die Existenz einer Klasse von Lohnarbeitern verhindert“(FN 258). So lange also der Arbeiter für sich selbst accumuliren kann, und das kann er, so lange er Eigenthümer seiner Produktionsmittel bleibt, ist die kapitalistische Accumulation und die kapitalistische Produktionsweise unmöglich. Die dazu unentbehrliche Klasse der Lohnarbeiter fehlt. Wie wurde nun im alten Europa die Expropriation des Arbeiters von seinen Arbeitsbedingungen, daher Kapital und Lohnarbeit, hergestellt? Durch einen contrat social ganz origineller Art. „Die Menschheit adoptirte eine einfache Methode zur Förderung der Accumulation des Kapitals“, die ihr natürlich seit Adams Zeiten als letzter und einziger Zweck ihres Daseins vorschwebte; „ sie theilte sich in Eigner von Kapital und Eigner von Arbeit … diese Theilung war das Resultat freiwilliger Verständigung und Kombination“(FN 259). Mit einem Wort: die Masse der Menschheit expropriirte sich selbst zu Ehren der „Accumulation des Kapitals“. Nun sollte man glauben, der Instinkt dieses selbstentsagenden
Fanatismus müsse sich namentlich in Kolonien den Zügel frei schiessen lassen, wo allein Menschen und Umstände existiren, welche einen contrat social aus dem Traumreich in das der Wirklichkeit übersetzen könnten. Aber wozu dann überhaupt die „ systematische Kolonisation“ im Gegensatz zur naturwüchsigen Kolonisation? Aber, aber „in den nördlichen Staaten der amerikanischen Union ist es zweifelhaft, ob ein Zehntel der Bevölkerung der Kategorie der Lohnarbeiter angehört … In England besteht die grosse Volksmasse aus Lohnarbeitern“(FN 260). Ja der Selbstexpropriationstrieb der arbeitenden Menschheit zu Ehren des Kapitals existirt so wenig, dass nach Wakefield selbst Sklaverei die einzige naturwüchsige Grundlage des Kolonialreichthums ist. Seine systematische Kolonisation ist ein blosses pis aller, da er nun einmal mit Freien, statt mit Sklaven zu operiren hat. „ Ohne Sklaverei wäre das Kapital in den spanischen Niederlassungen kaput gegangen oder wenigstens auf die kleinen Massen zusammengeschrumpft, worin jedes Individuum es mit seinen eignen Händen anwenden kann. Diess fand wirklich statt in der letzten von den Engländern gegründeten Kolonie, wo ein grosses Kapital in Samen, Vieh und Instrumenten unterging am Mangel von Lohnarbeitern und wo kein Ansiedler viel mehr Kapital besitzt als er mit seinen eignen Händen anwenden kann“(FN 261).
Man sah: die Expropriation der Volksmasse von Grund und Boden bildet die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Das Wesen einer freien Kolonie besteht umgekehrt darin, dass die Masse des Bodens noch Volkseigenthum ist und jeder Ansiedler daher einen Theil davon in sein Privateigenthum und individuelles Produktionsmittel verwandeln kann, ohne den spätern Ansiedler an derselben Operation zu verhindern(FN 262). Diess ist das Geheimniss, sowohl der Blüthe der Kolonien, als ihres Krebswurms — ihres Widerstands wider die Ansiedlung des Kapitals. „ Wo Land sehr wohlfeil ist und alle Menschen frei sind, wo jeder nach Wunsch ein Stück Land für sich selbst erhalten kann, ist Arbeit nicht nur sehr theuer,
was den Antheil des Arbeiters an seinem Produkt angeht, sondern die Schwierigkeit ist, kombinirte Arbeit zu irgend einem Preis zu erhalten“(FN 263).
Da in den Kolonien die Scheidung des Arbeiters von den Arbeitsbedingungen und ihrer Wurzel, dem Grund und Boden, noch nicht existirt, oder nur sporadisch, oder auf zu beschränktem Spielraum, existirt auch noch nicht die Losscheidung der Agrikultur von der Industrie, noch nicht die Vernichtung der ländlich häuslichen Industrie, und wo soll da der innere Markt für das Kapital herkommen? „Kein Theil der Bevölkerung Amerikas ist ausschliesslich agrikol, mit Ausnahme der Sklaven und ihrer Anwender, die Kapital und Arbeit für grosse Werke kombiniren. Freie Amerikaner, die den Boden selbst bauen, treiben zugleich viele andre Beschäftigungen. Ein Theil der von ihnen gebrauchten Möbel und Werkzeuge wird gewöhnlich von ihnen selbst gemacht. Sie bauen häufig ihre eignen Häuser und bringen das Produkt ihrer eignen Industrie zu noch so fernem Markt. Sie sind Spinner und Weber, sie fabriciren Seife und Kerzen, Schuhe und Kleider für ihren eignen Gebrauch. In Amerika bildet der Landbau oft das Nebengeschäft eines Grobschmidts, Müllers oder Krämers“(FN 264). Wo bleibt unter solchen Käuzen das „Entsagungsfeld“ für den Kapitalisten?
Die grosse Schönheit der kapitalistischen Produktion besteht darin, dass sie den Lohnarbeiter nicht nur als Lohnarbeiter beständig reproducirt, sondern im Verhältniss zur Accumulation des Kapitals stets eine relative Uebervölkerung von Lohnarbeitern producirt. So wird das Gesetz von Arbeits nach frage und Zufuhr im richtigen Gleis gehalten, die Lohnschwankung innerhalb der kapitalistischen Exploitation konvenabler Schranken gebannt, und endlich die so unentbehrliche sociale Abhängigkeit des Arbeiters vom Kapitalisten garantirt, ein absolutes Abhängigkeitsverhältniss, das der politische Oekonom zu Haus, im Mutterland, breimäulig in ein freies Kontraktverhältniss von Käufer und Verkäufer, von gleich unabhängigen Waaren besitzern, Besitzern der Waare Kapital und der Waare Arbeit, nach Belieben umlügen kann. Aber in den Kolonien reisst der schöne Wahn entzwei.
Die absolute Arbeiterbevölkerung wächst hier viel rascher als im Mutterland, indem viele Arbeiter erwachsen auf die Welt kommen, und dennoch ist der Arbeitsmarkt stets untervoll. Das Gesetz der Arbeitsnachfrage und Zufuhr geräth in die Brüche, wie Taylor’s Formel in einem Fall des Differentialkalkuls. Einerseits wirft die alte Welt fortwährend exploitationslustiges, entsagungsbedürftiges Kapital ein; andrerseits stösst die regelmässige Reproduktion des Lohnarbeiters als Lohnarbeiter und daher noch mehr die Produktion einer SurplusArbeiterbevölkerung im Verhältniss zur Accumulation des Kapitals auf die unartigsten und theilweis unüberwindlichen Hindernisse. Der Lohnarbeiter von heute wird morgen unabhängiger, selbst wirthschaftender Bauer oder Handwerker. Er verschwindet vom Arbeitsmarkt, aber nicht ins — Workhouse. Diese beständige Verwandlung der Lohnarbeiter in unabhängige Producenten, die statt für das Kapital, für sich selbst arbeiten, und statt den Herrn Kapitalisten sich selbst bereichern, wirkt ihrerseits durchaus schadhaft auf die Zustände des Lohnarbeitsmarkts zurück. Nicht nur bleibt der Exploitationsgrad des Lohnarbeiters unanständig niedrig. Der letztre verliert mit dem Abhängigkeitsverhältniss auch das Abhängigkeitsgefühl vom entsagenden Kapitalisten. Daher alle die Missstände, die unser E. G. Wakefield so brav, so beredt und so rührend schildert.
Die Zufuhr des Lohnarbeitsmarkts, klagt er, ist weder beständig, noch regelmässig, noch genügend. „Sie ist stets nicht nur zu klein, sondern unsicher“(FN 265). „Obgleich das zwischen Arbeiter und Kapitalist zu theilende Produkt gross ist, nimmt der Arbeiter einen so grossen Theil, dasser rasch ein Kapitalist wird … Dagegen können Wenige, selbst wenn sie ungewöhnlich lang leben, grosse Reichthummassen accumuliren“(FN 266). Die Arbeiter erlauben dem Kapitalisten platterdings nicht auf Zahlung des grössten Theils ihrer Arbeit zu entsagen. Es hilft ihm nichts, wenn er so schlau ist, mit seinem eignen Kapital auch seine eignen Lohnarbeiter aus Europa zu importiren. „Sie hören bald auf Lohnarbeiter zu sein, sie verwandeln sich bald in unabhängige Bauern oder gar in Konkurrenten ihrer alten Meister auf dem
Lohnarbeitsmarkt selbst“(FN 267). Man begreife den Greuel! Der brave Kapitalist hat seine eignen leibhaftigen Konkurrenten selbst aus Europa für sein eignes gutes Geld importirt! Da hört denn doch alles auf! Kein Wunder, wenn Wakefield klagt über mangelndes Abhängigkeitsverhältniss und -Gefühl der Lohnarbeiter in den Kolonien. „Wegen der hohen Löhne“, sagt sein Schüler Merivale, „existirt in den Kolonien der leidenschaftliche Drang nach wohlfeilerer und unterwürfigerer Arbeit, nach einer Klasse, welcher der Kapitalist die Bedingungen diktiren kann, statt sie von ihr diktirt zu erhalten … In altcivilisirten Ländern ist der Arbeiter, obgleich frei, naturgesetzlich abhängig vom Kapitalisten, in Kolonien muss diese Abhängigkeit durch künstliche Mittel geschaffen werden“(FN 268).
Was ist nun das Resultat des in den Kolonien herrschenden Systems des auf eigner Arbeit, statt auf der Exploita
tion fremder Arbeit beruhenden Privateigenthums? Ein „ barbarisirendes System der Zerstreuung der Producenten und des Nationalvermögens“(FN 269). Die Zerstreuung der Produktionsmittel unter unzählige, sie eignende und mit ihnen selbst arbeitende Producenten vernichtet mit der kapitalistischen Koncentration die kapitalistische Grundlage aller kombinirten Arbeit. Alle langathmigen Kapitalunternehmungen, die sich über Jahre ausdehnen und Anlage von viel fixem Kapital erheischen, werden problematisch. In Europa zögert das Kapital keinen Augenblick, denn die Arbeiterklasse bildet seinen stets überfliessenden, disponiblen, lebendigen Zubehör. Aber in den Kolonialländern! Wakefield erzählt eine äusserst schmerzensreiche Anekdote. Er unterhielt sich mit einigen Kapitalisten von Kanada und dem Staat New-York, wo zudem die Einwanderungswogen oft stagniren und einen Bodensatz „überzähliger“ Arbeiter niederschlagen. „Unser Kapital,“ seufzt eine der Personen des Melodramas, „unser Kapital lag bereit für viele Operationen, die eine beträchtliche Zeitperiode zu ihrer Vollendung brauchen; aber konnten wir solche Operationen beginnen mit einer Arbeit, welche, wir wussten es, uns bald den Rücken wenden würde? Wären wir sicher gewesen die Arbeit solcher Einwandrer festhalten zu können, wir hätten sie mit Freude sofort engagirt und zu hohem Preis. Trotz der Sicherheit ihres Verlustes würden wir sie dennoch engagirt haben, wären wir einer frischen Zufuhr je nach unsrem Bedürfniss sicher gewesen“(FN 270).
Nachdem Wakefield die englische kapitalistische Agrikultur und ihre „kombinirte“ Arbeit prunkvoll kontrastirt hat mit der zerstrenten amerikanischen Bauernwirthschaft, entschlüpft ihm auch die Kehrseite der Medaille. Er schildert die amerikanische Volksmasse als wohlhabend, unabhängig, unternehmend, und relativ gebildet, während „der englische Agrikulturarbeiter ein elender Lump (a miserable wretch) ist, ein Pauper … In welchem Land ausser Nordamerika und einigen neuen Kolonien übersteigen die Löhne der auf dem Land angewandten freien Arbeit nennenswerth die unentbehrlichsten Subsistenzmittel des Arbeiters? … Zweifelsohne, Ackerpferde in England, da sie ein werthvolles Eigenthum sind, werden viel besser genährt als der englische Landbebauer“(FN 271). Aber,
never mind, Nationalreichthum ist nun einmal von Natur identisch mit Volkselend.
Wie nun den antikapitalistischen Krebsschaden der Kolonien kuriren? Wollte man allen Grund und Boden mit einem Schlag aus Volkseigenthum in Privateigenthum verwandeln, so zerstörte man zwar die Wurzel des Uebels, aber auch — die Kolonie. Die Kunst ist zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Man gebe von Regierungswegen der jungfräulichen Erde einen vom Gesetz der Nachfrage und Zufuhr unabhängigen, einen künstlichen Preis, welcher den Einwanderer zwingt längere Zeit zu lohnarbeiten, bevor er genug Geld verdient hat, um Grund und Boden zu kaufen(FN 272) und sich in einen unabhängigen Bauern zu verwandeln. Den Fonds, der aus diesem Verkauf der Ländereien zu einem für den Lohnarbeiter relativ prohibitorischen Preis fliesst, also diesen aus dem Arbeitslohn durch Verletzung des heiligen Gesetzes von Nachfrage und Zufuhr erpressten Geldfonds verwende die Regierung andrerseits, um im selben Mass, wie er wächst, Habenichtse aus Europa in die Kolonien zu importiren und so dem Herrn Kapitalisten seinen Lohnarbeitsmarkt vollzuhalten. Unter diesen Umständen „tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.“ Diess ist das grosse Geheimniss der „ systematischen Kolonisation“. „Nach diesem Plan,“ ruft Wakefield triumphirend aus, „muss die Zufuhr von Arbeit constant und regelmässig sein; denn erstens, da kein Arbeiter fähig ist sich Land zu verschaffen, bevor er für Geld gearbeitet hat, würden alle einwandernden Arbeiter dadurch, dass sie für Lohn kombinirt arbeiten, ihrem Anwender Kapital zur Anwendung von mehr Arbeit produciren; zweitens jeder, der die Lohnarbeit an den Nagel hinge und Grundeigner würde, würde grade durch den Ankauf des Landes einen Fonds zur Herüber
bringung frischer Arbeit nach den Kolonien sichern“(FN 273). Der von Staatswegen oktroyirte Bodenpreis muss natürlich „ genügend“ ( sufficient price) sein, d. h. so hoch, „dass er die Arbeiter verhindert, unabhängige Bauern zu werden, bis andre da sind, um ihren Platz auf dem Lohnarbeitsmarkt einzunehmen“(FN 274). Dieser genügende „ Bodenpreis“ ist nichts als eine euphemistische Umschreibung des Lösegelds, welches der Arbeiter dem Kapitalisten zahlt für die Erlaubniss, sich vom Lohnarbeitsmarkt auf’s Land zurückzuziehn. Erst muss er dem Herrn Kapitalisten „ Kapital“ produciren, damit der mehr Arbeiter exploitiren könne, und dann auf dem Arbeitsmarkt einen „ Ersatzmann“ stellen, den die Regierung auf seine Kosten seinem ehemaligen Herrn Kapitalisten über die See spedirt.
Es ist höchst charakteristisch, dass die englische Regierung diese von Herrn Wakefield eigens zum Gebrauch in Kolonialländern verschriebene Methode der „ ursprünglichen Accumulation“ Jahre lang ausgeführt hat. Das Fiasko war natürlich ebenso schmählich als das des Peelschen Bankakts. Der Emigrationsstrom wurde nur von den englischen Kolonien nach den Vereinigten Staaten abgelenkt. Unterdess hat der Fortschritt der kapitalistischen Produktion in Europa zusammen mit dem wachsenden Regierungsdruck Wakefield’s Recept überflüssig gemacht. Der ungeheure und continuirliche Menschenstrom, Jahr aus Jahr ein nach Amerika getrieben, lässt theils stagnirende Niederschläge im Osten der Vereinigten Staaten zurück, theils wirft die Emigrationswelle von Europa die Menschen rascher auf den Arbeitsmarkt als die Emigrationswelle nach dem far West sie abspülen kann. Die kapitalistische Produktion gedeiht daher in den Oststaaten, obgleich Lohntiefe und Abhängigkeit des Lohnarbeiters noch lange nicht auf das europäische Normalniveau gefallen sind. Die von Wakefield selbst so laut denuncirte, schamlose Verschleuderung des unbebauten Kolonialbodens an Aristokraten und Kapitalisten Seitens der englischen Regierung hat namentlich in Australien(FN 275), zusammen mit
dem Menschenstrom, den die Diggings hinziehn, und der Konkurrenz, welche der Import englischer Waaren selbst dem kleinsten Handwerker macht, eine hinreichende „relative Arbeiterübervölkerung“ erzeugt, so dass fast jedes Postdampfschiff die Hiobspost eines „glut of the Australian labour-market“ bringt, und die Prostitution dort stellenweis so üppig gedeiht wie auf dem Haymarket von London.
Jedoch beschäftigt uns hier nicht der Zustand der Kolonien. Was uns allein interessirt, ist das in der neuen Welt von der politischen Oekonomie der alten Welt entdeckte und laut proklamirte Geheimniss, dass die kapitalistische Produktionsund Accumulationsweise, also auch das kapitalistische Privateigenthum die Vernichtung des auf eigner Arbeit beruhenden Privateigenthums, d. h. die Expropriation des Arbeiters voraussetzt.
Zum Schluss müssen wir noch einen Augenblick den Faden wieder da aufnehmen, wo wir ihn beim Uebergang zur Betrachtung der Accumulation fallen liessen. Gesetzt der Kapitalist habe 5000 Pfd. St. vorgeschossen und im Produktionsprozess aufgezehrt, 4000 Pfd. St. in Produktionsmitteln, 1000 Pfd. St. in Arbeitskraft, mit einem Exploitationsgrad der Arbeit von 100 %. So beträgt der Werth des Produkts, von x Tonnen Eisen z. B. 6000 Pfd. St. Verkauft der Kapitalist das Eisen zu seinem Werth, so realisirt er einen Mehrwerth von 1000 Pfd. St., d. h. die im Eisenwerth materialisirte unbezahlte Arbeit. Aber das Eisen muss verkauft werden. Das unmittelbare Resultat der kapitalistischen Produktion ist Waare, wenn auch mit Mehrwerth geschwängerte Waare. Wir sind also zu unserm Ausgangspunkt, der Waare, zurückgeschleudert und mit ihr zur Sphäre der Cirkulation. Was wir jedoch im folgenden Buch zu betrachten haben, ist nicht mehr die einfache Waarencirkulation, sondern der Cirkulationsprozess des Kapitals.
Nachtrag zu den Noten des ersten Buchs.↑
I) ad Kapitel III, n. 86. In einem der unterdrücktesten Agrikulturdistrikte Englands, in Buckinghamshire haben die Lohnarbeiter, März 1867, einen grossen Strike zur Erhöhung des Wochenlohns von 9—10 auf 12 sh. gemacht.
II) ad Kapitel III, n. 87. Durch einen Strike erzwangen die Heizer, Lokomotivenführer u. s. w. der Brighton Eisenbahn, Ende März 1867, die Beschränkung des Normalarbeitstags auf 10 Stunden, nebst anderen Koncessionen. Dieselbe Bewegung hat in diesem Augenblicke (6. April 1867) fast alle anderen englischen Eisenbahnen ergriffen.
III) ad Kapitel IV, n. 175. Die Gesetze zum Schutz gegen gefährliche Maschinerie haben wohlthätig gewirkt. „Aber … es existiren jetzt neue Quellen von Unglücksfällen, die vor 20 Jahren nicht existirt haben, namentlich die vermehrte Geschwindigkeit der Maschinerie. Räder, Walzen, Spindeln und Webstühle werden jetzt mit vermehrter und stets noch wachsender Gewalt getrieben; die Finger müssen rascher und kühner den gebrochnen Faden anpacken, denn, wenn mit Zaudern oder Unvorsicht angelegt, sind sie geopfert … Eine grosse Anzahl Unglücksfälle wird verursacht durch den Eifer der Arbeiter ihr Werk rasch auszuführen. Man muss sich erinnern, dass es für die Fabrikanten von der höchsten Wichtigkeit ist ihre Maschinerie ununterbrochen in Bewegung zu halten, d. h. Garn und Geweb zu produciren. Jeder Stillstand von einer Minute ist nicht nur ein Verlust an Triebkraft, sondern an Produktion. Die Arbeiter werden daher durch Arbeitsaufseher, interessirt in der Quantität des Machwerks, dazu gehetzt, die Maschinerie in Bewegung zu halten; und es ist diess nicht minder wichtig für Arbeiter, die nach Gewicht oder Stück gezahlt werden. Obgleich es daher in den meisten Fabriken formell verboten ist, Maschinerie während ihrer Bewegung zu reinigen, ist diese Praxis allgemein. Diese Ursache allein hat während der letzten 6 Monate 906 Unglücksfälle producirt … Obgleich das Reinigungsgeschäft Tag aus Tag ein vorgeht, ist der Sonnabend jedoch meist der für gründliche
Reinigung der Maschinerie festgesetzte Tag, und sie wird grossentheils verrichtet während der Bewegung der Maschinerie … Es ist eine unbezahlte Operation, und die Arbeiter suchen daher so rasch als möglich damit fertig zu werden. Daher ist die Anzahl der Unglücksfälle Freitags und ganz besonders Samstags viel grösser als an den übrigen Wochentagen. Freitags beträgt der Ueberschuss über die Durchschnittszahl der ersten 4 Wochentage ungefähr 12 %, Sonnabends der Ueberschuss von Unglücksfällen über den Durchschnitt der vorhergehenden 5 Tage 25 %, oder, wenn man in Rechnung zieht, dass der Fabriktag Samstags nur 7½ Stunden, an den übrigen Wochentagen 10½ Stunden zählt — schwillt der Ueberschuss über 65 %.“ („ Reports of Insp. of Factories for etc. 31st October 1866. London 1867“, p. 9, 15, 16, 17.)
IV) ad Kapitel IV, n. 184. „Die self-acting mules sind vielleicht eine so gefährliche Maschinerie als irgend eine andere. Die meisten Unglücksfälle begegnen kleinen Kindern und zwar in Folge ihres Kriechens unter den Mules, um den Boden zu fegen, während die Mules in Bewegung sind. Verschiedne „minders“ (Arbeiter an der Mule) wurden (von den Fabrikinspektoren) gerichtlich verfolgt und zu Geldstrafen verurtheilt wegen dieses Vergehns, aber ohne irgend welchen allgemeinen Vortheil. Wenn Maschinenmacher nur einen Selbstfeger erfinden wollten, durch dessen Gebrauch die Nothwendigkeit für diese kleinen Kinder unter die Maschinerie zu kriechen, wegfiele, so wäre das ein glücklicher Beitrag zu unseren Protektionsmassregeln.“ („ Reports of Insp. of Factories for 31st October 1866“, p. 63.)
V) ad Kapitel IV, n. 234. Auf Antrieb des Herrn Gladstone verordnete das Haus der Gemeinen am 17. Februar 1867 eine Statistik über alle von 1831—1866 in das Vereinigte Königreich eingeführte und ausgeführte Kornfrucht, Getreide und Mehl aller Art. Ich gebe nachstehend das zusammenfassende Resultat. Das Mehl ist auf Quarters Korn reducirt.
Fünfjährige Perioden und Jahr 1866.
VI) ad Kapitel IV, n. 319. Der Factory Acts Extension Act ging durch 12. August 1867. Er regulirt alle Metallgiessereien, -Schmieden und -Manufakturen, mit Einschluss der Maschinenfabriken, ferner Glas-, Papier-, Guttapercha-, Indiarubber-, Tabakmanufakturen, Buchdruckereien, Buchbindereien, endlich alle Werkstätten, worin mehr als 50 Personen beschäftigt sind. — Der Hours of Labour Regulation Act, passirt 17. August 1867, regulirt die kleineren Werkstätten und die s. g. Hausarbeit.
VII) ad Kapitel V, n. 66. Der englische Fabrikinspektor Alexander Redgrave weist im vorletzten Fabrikbericht (nominell bis zum 31. Oktober 1866, in der That aber bis 31. December 1866 gehend) durch vergleichende Statistik mit den Kontinentalstaaten nach, dass trotz niedrigerem Lohn und viel längerer Arbeitszeit die kontinentale Arbeit, verhältnissmässig zum Produkt, theurer ist als die englische. „Ein englischer Direktor (manager) in einer Baumwollfabrik in Oldenburg erklärt, dass dort die Arbeitszeit von 5.30 Morgens bis 8 Uhr Abends, Samstage eingeschlossen, und dass die dortigen Arbeiter, wenn unter englischen Arbeitsaufsehern, während dieser Zeit fast so viel Produkt liefern wie Engländer in 10 Stunden, unter deutschen Arbeitsaufsehern aber noch viel weniger. Der Lohn stehe viel tiefer als in England, in vielen Fällen um 50 %, aber die Zahl der Hände im Verhältniss zur Maschinerie sei viel grösser, in verschiedenen Departements im Verhältniss von 5 : 3.“ Herr Redgrave giebt sehr genaue Details über die russischen Baumwollfabriken. Die Data sind ihm geliefert durch einen dort noch kürzlich beschäftigten englischen manager. Auf diesem russischen Boden, an allen Infamien so überfruchtbar, stehn auch die alten Greuel aus der Kindheitsperiode der englischen factories in vollster Blüthe. Die Dirigenten sind natürlich Engländer, da der eingeborne russische Kapitalist zu dumm für das Fabrikgeschäft ist. Trotz aller Ueberarbeit, fortlaufender Tagund Nachtarbeit, und schmählichster Unterzahlung der Arbeiter, vegetirt das russische Fabrikat nur durch Prohibition des ausländischen. — Ich gebe schliesslich noch eine vergleichende Uebersicht des Herrn Redgrave über die Durchschnitts-Spindelzahl per Fabrik und per Spinner in verschiedenen Ländern Europas. Herr Redgrave bemerkt selbst, dass er diese Zahlen vor einigen Jahren gesammelt hat, und dass seit der Zeit die Grösse der Fabriken und die Spindelzahl
per Arbeiter in England gewachsen seien. Er unterstellt aber verhältnissmässig gleich grossen Fortschritt in den aufgezählten Kontinentalländern, so dass die Zahlenangaben ihren komparativen Werth behalten hätten.
Durchschnittsanzahl von Spindeln per Fabrik.
Durchschnittsanzahl von Spindeln per Kopf.
„Diese Vergleichung,“ sagt Herr Redgrave, „ist, ausser anderen Gründen, besonders auch desswegen für Grossbritanien ungünstig, weil dort eine sehr grosse Zahl Fabriken existirt, worin die Maschinenweberei mit der Spinnerei verbunden ist, während die Rechnung keinen Kopf für die Webstühle abzieht. Die auswärtigen Fabriken sind dagegen meist blosse Spinnereien. Könnten wir genau Gleiches mit Gleichem vergleichen, so könnte ich viele Baumwollspinnereien in meinem Distrikt aufzählen, worin Mules mit 2200 Spindeln von einem einzigen Mann (minder) und zwei Handlangerinnen überwacht und täglich 220 Pfund Garn, 400 (englische) Meilen in Länge, fabricirt werden.“ („ Reports of Insp. of Fact. 31st Oct. 1866, p. 31—37 passim.)
VIII) ad Kapitel VI, n. 137. Ueber die noch fortdauernden Nachwehen der Krise von 1866 folgender Auszug aus einer ministeriellen (torystischen) Zeitung. Man muss nicht vergessen, dass der Osttheil Londons, um den es sich hier handelt, nicht nur Sitz der im Text des Kapitels erwähnten eisernen Schiffsbauer, sondern auch einer stets unter dem Minimum bezahlten s. g. „ Hausarbeit“ ist. „Ein entsetzliches Schauspiel entrollte sich gestern in einem Theil der Metropole. Obgleich die arbeitslosen Tausende des Ostendes mit schwarzen Trauerflaggen nicht in Masse paradirten, war der Menschenstrom imposant genug. Erinnern wir uns, was diese Bevölkerung leidet. Sie stirbt vor Hunger. Das ist die einfache und furchtbare Thatsache. Es sind ihrer 40,000 . . . . In unserer Gegenwart, in einem Viertel dieser wundervollen Metropole, dicht neben der enormsten Accumulation von Reichthum, welche die Welt je sah, dicht dabei 40,000 hilflos verhungernd! Diese Tausende brechen jetzt ein in die andern Viertel; sie, in allen Zeiten halbverhungert, schreien uns ihr Weh ins Ohr, sie schreien es zum Himmel, sie erzählen uns von ihren elendgeschlagenen Wohnungen, dass es unmöglich für sie ist Arbeit zu finden und nutzlos zu betteln. Die lokalen Armensteuerpflichtigen sind durch die Forderungen der Pfarreien selbst an den Rand des Pauperismus getrieben.“ Standard, 5. April, 1867.
IX) Schlussnote zum ersten Abschnitt des VI. Kapitels. Die englischen Malthusianer zeigen auf Frankreich als das „glückliche“ Land, wo die Bevölkerung sich principiell „untervoll“ halte. Sie sind natürlich eben so unwissend über französische Zustände, wie die in Deutschland fauchenden Freihandelshausirburschen über englische Zustände. Aus der letzten officiellen enquête agricole kann man sehn, woran das französische „ Prolétariat foncier“, und aus dem letzten Werk des Herrn Pierre Vinçard, woran das französische Industrieproletariat ist. In den Zustand der französischen Volksmasse überhaupt gewährt der Bericht des Generals Allard über die beabsichtigte Armeereform eigne Lichtblicke. Von den jungen Franzosen, die das Alter zum Looseziehn bei der Konskription erreicht haben, sind nur 198,000 fähig im 21. Jahr zu heirathen. Diese 198,000 Franzosen, denen es von Polizei wegen erlaubt ist eine Familie zu gründen, bestehn aus folgenden Elementen: 12,000 Dispensirte, 20,000 Entlastete oder
Remplacirte, und 166,000 Ausgenommene. Von den letztern sind mehr als 100,000 ausgenommen wegen mangelnder Grösse und andern Schwächen, die sie mit keiner sonderlichen Specialität für die Ehe ausrüsten. Mehr als die Hälfte dieser jungen Leute zählt zur Kategorie der Verkrüppelten und Rhachitischen, welche die Lacedämonier vom Taygetus gestürzt hätten. Die andre Hälfte besteht zu einem guten Viertel aus älteren Söhnen von Wittwen, welchen ihre Familienverhältnisse die Ehe beinahe untersagen, zu einem andern Viertel aus Entlasteten, d. h. Mitgliedern der reichen Klassen. Ueber diese Kategorie heisst es in der „ Liberté“, dem Organ Emil Girardin’s, vom 18. März, 1867: „Die reiche Klasse ist die schlechteste mit Bezug auf die Reproduktion der Race. In der That, die Statistik beweist, dass die Aristokratien von selbst erlöschen, und dass nach Verlauf weniger Jahrhunderte die königlichen Racen selbst oft beim Kretinismus und erblicher Narrheit anlangen.“ Wenn auf dem Kontinent von Europa der Einfluss der kapitalistischen Produktion, welche die Menschenrace unterwühlt durch Ueberarbeit, Theilung der Arbeit, Unterjochung unter die Maschine, Verkrüpplung des unreifen und weiblichen Körpers, schlechtes Leben u. s. w., sich, wie bisher, Hand in Hand entwickelt mit der Konkurrenz in Grösse der nationalen Soldateska, Staatsschulden, Steuern, eleganter Kriegsführung u. s. w., möchte die vom Halbrussen und ganzen Moskowiter Herzen (dieser Belletrist hat nebenbei bemerkt seine Entdeckungen über den „russischen“ Kommunismus nicht in Russland gemacht, sondern in dem Werke des preussischen Regierungsraths Haxthausen) so ernst prophezeite Verjüngung Europa’s durch die Knute und obligate Infusion von Kalmückenblut schliesslich doch unvermeidlich werden.
Anhang zu Kapitel I, 1. Die Werthform.↑
Die Analyse der Waare hat gezeigt, dass sie ein Doppeltes ist, Gebrauchswerth und Werth. Damit ein Ding daher Waarenform besitze, muss es Doppelform besitzen, die Form eines Gebrauchswerths und die Form des Werths. Die Form des Gebrauchswerths ist die Form des Waare nkörpers selbst, Eisen, Leinwand u. s. w., seine handgreiflich sinnliche Daseinsform. Es ist diess die Naturalform der Waare. Die Werthform der Waare ist dagegen ihre gesellschaftliche Form.
Wie wird der Werth einer Waare nun ausgedrückt? Wie gewinnt er also eigne Erscheinungsform? Durch das Verhältniss verschiedner Waaren. Um die in solchem Verhältniss enthaltene Form richtig zu analysiren, müssen wir von ihrer einfachsten, unentwickeltsten Gestalt ausgehn. Das einfachste Verhältniss einer Waare ist offenbar ihr Verhältniss zu einer einzigen, andren Waare, gleichgültig welcher. Das Verhältniss zweier Waaren liefert daher den einfachsten Werthausdruck für eine Waare.
20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth.
Das Geheimniss aller Werthform muss in dieser einfachen Werthform stecken. Ihre Analyse bietet daher die eigentliche Schwierigkeit.
§. 1. Die beiden Pole des Werthausdrucks: Relative Werthform und Aequivalentform.
In dem einfachen Werthausdruck spielen die zwei Waarenarten Leinwand und Rock offenbar zwei verschiedne Rollen. Die Leinwand ist die Waare, welcheihren Werth in einem von ihrverschiedenartigen Waarenkörper, dem Rock, ausdrückt. Andrerseits dient die Waarenart Rock als das Material, worin Werth ausgedrückt wird. Die eine Waare spielt eine aktive, die andre eine passive Rolle. Von der Waare nun, welche ihren
Werth in einer andren Waare ausdrückt, sagen wir: Ihr Werth ist als relativer Werth dargestellt, oder sie befindet sich in relativer Werthform. Von der andern Waare dagegen, hier dem Rock, die zum Material des Werthausdrucks dient, sagen wir: Sie funktionirt als Aequivalent der ersten Waare, oder befindet sich in der Aequivalentform.
Ohne nun noch tiefer zu analysiren, sind von vorn herein folgende Punkte klar:
a) Die Unzertrennlich keit der beiden Formen.
Relative Werthform und Aequivalentform sind zu einander gehörige, sich wechselseitig bedingende, unzertrennliche Momente desselben Werthausdrucks.
b) Die Polarität der beiden Formen.
Andrerseits sind diese beiden Formen einander ausschliessende oder entgegengesetzte Extreme, d. h. Pole, desselben Werthausdrucks. Sie vertheilen sich stets auf die verschiedenen Waaren, die der Werthausdruck auf einander bezieht. Ich kann z. B. den Werth der Leinwand nicht in Leinwand ausdrücken. 20 Ellen Leinwand = 20 Ellen Leinwand ist kein Werthausdruck, sondern drückt nur ein bestimmtes Quantum des Gebrauchsgegenstands Leinwand aus. Der Werth der Leinwand kann also nur in andrer Waare, d. h. nur relativ ausgedrückt werden. Die relative Werthform der Leinwand unterstellt also, dass irgend eine andre Waare sich ihr gegenüber in der Aequivalentform befindet. Andrerseits, diese andre Waare, hier der Rock, die als Aequivalent der Leinwand figurirt, sich also in Aequivalentform befindet, kann sich nicht gleichzeitig in relativer Werthform befinden. Nicht sie drückt ihren Werth aus. Sie liefert nur dem Werthausdruck andrer Waare das Material.
Allerdings schliesst der Ausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth, auch die Rückbeziehung ein: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand oder: 1 Rock ist 20 Ellen Leinwand werth. Aber so muss ich doch die Gleichung umkehren, um den Werth des Rocks relativ auszudrücken, und sobald ich das thue, wird die Leinwand Aequivalent statt des Rockes. Dieselbe Waare kann also in demselben Werthausdruck nicht gleichzeitig in beiden Formen auftreten. Diese schliessen sich vielmehr polarisch aus.
Denken wir uns Tauschhandel zwischen Leinwandproducent A und Rockproducent B. Bevor sie Handels einig werden, sagt A: 20 Ellen Leinwand sind 2 Röcke werth (20 Ellen Leinwand = 2 Röcke), B dagegen: 1 Rock ist 22 Ellen Leinwand werth (1 Rock = 22 Ellen Leinwand). Endlich, nachdem sie lang gemarktet, stimmen sie überein. A sagt: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth, und B sagt: 1 Rock ist 20 Ellen Leinwand werth. Hier befinden sich beide, Leinwand und Rock, gleichzeitig in relativer Werthform und in Aequivalentform. Aber, notabene, für zwei verschiedene Personen und in zwei verschiedenen Werthaus
drücken, welche nur gleichzeitig ins Leben treten. Für A befindet sich seine Leinwand, — denn für ihn geht die Initiative von seiner Waare aus — in relativer Werthform, die Waare des Andren, der Rock dagegen, in Aequivalentform. Umgekehrt vom Standpunkt des B. Dieselbe Waare besitzt also niemals, auch nicht in diesem Fall, die beiden Formen gleichzeitig in demselben Werthausdruck.
c) Relativer Werth und Aequivalent sind nur Formen des Werths.
Relativer Werth und Aequivalent sind beide nur Formen des Waaren werths. Ob eine Waare sich nun in der einen Form befindet oder in der polarisch entgegengesetzten, hängt ausschliesslich von ihrer Stelle im Werthausdruck ab. Diess tritt schlagend hervor in der von uns hier zunächst betrachteten einfachen Werthform. Dem Inhalt nach sind die beiden Ausdrücke:
1) 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth,
2) 1 Rock = 20 Ellen Leinwand oder: 1 Rock ist 20 Ellen Leinwand werth, durchaus nicht verschieden. Der Form nach sind sie nicht nur verschieden, sondern entgegengesetzt. In dem Ausdruck 1) wird der Werth der Leinwand relativ ausgedrückt. Sie befindet sich daher in der relativen Werthform, während gleichzeitig der Werth des Rocks als Aequivalent ausgedrückt ist. Er befindet sich daher in der Aequivalentform. Drehe ich nun den Ausdruck 1) um, so erhalte ich den Ausdruck 2). Die Waaren wechseln die Stellen, und sofort befindet sich der Rock in relativer Werthform, die Leinwand dagegen in Aequivalentform. Weil sie die respektiven Stellen in demselben Werthausdruck gewechselt, haben sie die Werthform gewechselt.
§. 2. Die relative Werthform.
a) Gleichheitsverhältniss.
Da es die Leinwand ist, welche ihren Werth ausdrücken soll, geht von ihr die Initiative aus. Sie tritt in ein Verhältniss zum Rock, d. h. zu irgend einer andren, von ihr selbst verschiedenartigen Waare. Diess Verhältniss ist Verhältniss der Gleichsetzung. Die Basis des Ausdrucks: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock ist in der That: Leinwand = Rock, was in Worten ausgedrückt nur heisst: die Waarenart Rock ist gleicher Natur, gleicher Substanz mit der von ihr verschiedenen Waarenart Leinwand. Man übersieht das meist, weil die Aufmerksamkeit durch das quantitative Verhältniss absorbirt wird, d. h. durch die bestimmte Proportion, worin die eine Waarenart der andern gleichgesetzt ist. Man vergisst, dass die Grössen verschiedner Dinge erst quantitativ vergleichbar sind nach ihrer Reduktion auf dieselbe Einheit. Nur als Ausdrücke derselben Einheit sind sie gleichnamige, daher kommensurable Grössen. In obigem Ausdruck verhält sich also die
Leinwand zum Rock als Ihresgleichen, oder der Rock wird auf die Leinwand bezogen als Ding von derselben Substanz, Wesensgleiches. Er wird ihr also qualitativ gleichgesetzt.
b) Werthverhältniss.
Der Rock ist nur dasselbe wie die Leinwand, soweit beide Werthe sind. Dass also die Leinwand sich zum Rock als ihresgleichen verhält, oder dass der Rock als Ding von derselben Substanz der Leinwand gleichgesetzt wird, drückt aus, dass der Rock in diesem Verhältniss als Werth gilt. Er wird der Leinwand gleichgesetzt, sofern sie ebenfalls Werth ist. Das Gleichheitsverhältniss ist also Werthverhältniss, das Werthverhältniss aber vor allem Ausdruck des Werths oder des Werthseins der Waare, welche ihren Werth ausdrückt. Als Gebrauchswerth oder Waarenkörper unterscheidet sich die Leinwand vom Rock. Ihr Werthsein kommt dagegen zum Vorschein, drückt sich aus in einem Verhältniss, worin eine andre Waarenart, der Rock, ihr gleichgesetzt wird oder als ihr Wesensgleiches gilt.
c) Qualitativer Gehalt der im Werthverhältniss enthaltenen relativen Werthform.
Werth ist der Rock nur, so weit er dinglicher Ausdruck der in seiner Produktion verausgabten menschlichen Arbeitskraft ist, also Gallerte abstrakter menschlicher Arbeit — abstrakter Arbeit, weil von dem bestimmten, nützlichen, konkreten Charakter der in ihm enthaltenen Arbeit abstrahirt wird, menschlicher Arbeit, weil die Arbeit hier nur als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt zählt. Die Leinwand kann sich also nicht zum Rock als einem Werthding verhalten oder nicht auf den Rock als Werth bezogen werden, ohne auf ihn als einen Körper bezogen zu werden, dessen einziger Stoff aus menschlicher Arbeit besteht. Aber als Werth ist die Leinwand Gallerte derselben menschlichen Arbeit. Innerhalb dieses Verhältnisses repräsentirt also der Körper Rock die der Leinwand mit ihm gemeinschaftliche Werthsubstanz, d. h. menschliche Arbeit. Innerhalb dieses Verhältnisses gilt also der Rock nur als Gestalt von Werth, daher auch als Werthgestalt der Leinwand, als sinnliche Erscheinungsform des Leinwandwerths. So wird, vermittelst des Werthverhältnisses, der Werth einer Waare im Gebrauchswerth einer andern Waare ausgedrückt, d. h. in einem andern, von ihm selbst verschiedenartigen Waarenkörper.
d) Quantitative Bestimmtheit der im Werthverhältniss enthaltenen relativen Werthform.
Die 20 Ellen Leinwand sind jedoch nicht nur Werth überhaupt, d. h. Gallerte menschlicher Arbeit, sondern sie sind Werth von bestimmter Grösse, d. h. in ihnen ist ein bestimmtes Quantum menschlicher Arbeit vergegenständlicht. Im Werthverhältniss der Leinwand zum Rock
wird daher die Waarenart Rock nicht nur als Werthkörper überhaupt, d. h. als Verkörperung menschlicher Arbeit, der Leinwand qualitativ gleichgesetzt, sondern ein bestimmtes Quantum dieses Werthkörpers, 1 Rock, nicht 1 Dutzend u. s. w., soweit in 1 Rock grade so viel Werthsubstanz oder menschliche Arbeit steckt als in 20 Ellen Leinwand.
e) Das Ganze der relativen Werthform.
Durch den relativen Werthausdruck erhält also erstens der Werth der Waare eine von ihrem eignen Gebrauchswerth unterschiedne Form. Die Gebrauchsform dieser Waare ist z. B. Leinwand. Ihre Werthform besitzt sie dagegen in ihrem Gleichheitsverhältniss zum Rock. Durch diess Verhältniss der Gleichheit wird ein andrer sinnlich von ihr unterschiedner Waarenkörper zum Spiegel ihres eignen Werthseins, zu ihrer eignen Werthgestalt. So gewinnt sie eine von ihrer Naturalform unterschiedene, unabhängige und selbstständige Werthform. Zweitens aber, als Werth von bestimmter Grösse, als bestimmte Werthgrösse, ist sie quantitativ gemessen durch das quantitativ bestimmte Verhältniss oder die Proportion, worin ihr der andre Waarenkörper gleichgesetzt ist.
§. 3. Die Aequivalentform.
a) Die Form der unmittelbaren Austauschbarkeit.
Als Werthe sind alle Waaren gleichgeltende, durch einander ersetzbare oder vertauschbare Ausdrücke derselben Einheit, der menschlichen Arbeit. Eine Waare ist daher überhaupt mit andrer Waare austauschbar, sofern sie eine Form besitzt, worin sie als Werth erscheint. Ein Waarenkörper ist unmittelbar austauschbar mit andrer Waare, soweit seine unmittelbare Form, d. h. seine eigne Körper- oder Naturalform andrer Waare gegenüber Werth vorstellt oder als Werthgestalt gilt. Diese Eigenschaft besitzt der Rock im Werthverhältniss der Leinwand zu ihm. Der Werth der Leinwand wäre sonst nicht ausdrückbar in dem Ding Rock. Dass eine Waare also überhaupt Aequivalentform hat, heisst nur: durch ihren Platz im Werthausdruck gilt ihre eigne Naturalform als Werthform für andre Waare oder besitzt sie die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andrer Waare. Sie braucht also nicht erst eine von ihrer unmittelbaren Naturalform unterschiedne Form anzunehmen, um andrer Waare als Werth zu erscheinen, als Werth zu gelten und aufsie als Werth zu wirken.
b) Quantitative Bestimmtheit ist nicht enthalten in der Aequivalentform.
Dass ein Ding, welches die Form Rock hat, unmittelbar austauschbar mit Leinwand, oder ein Ding, welches die Form Gold hat, unmittelbar austauschbar mit allen andren Waaren ist, — diese Aequivalentform eines Dings enthält durchaus keine quantitative Bestimmtheit. Die entgegengesetzte irrige Ansicht entspringt aus folgenden Ursachen:
Erstens: Die Waare Rock z. B., welche zum Material für den Werthaus-
druck der Leinwand dient, ist innerhalb eines solchen Ausdrucks auch stets quantitativ bestimmt, wie 1 Rock, nicht 12 Röcke u. s. w. Aber warum? Weil die 20 Ellen Leinwand in ihrem relativen Werthausdruck nicht nur als Werth überhaupt ausgedrückt, sondern zugleich als bestimmtes Werthquantum gemessen sind. Dass aber 1 Rock, nicht 12 Röcke, so viel Arbeit enthält als 20 Ellen Leinwand, daher den 20 Ellen Leinwand gleichgesetzt wird, hat durchaus nichts zu schaffen mit der charakteristischen Eigenschaft der Waarenart Rock unmittelbar austauschbar mit der Waarenart Leinwand zu sein.
Zweitens: Wenn 20 Ellen Leinwand als Werth von bestimmter Grösse in 1 Rock ausgedrückt sind, ist rückbezüglich auch die Werthgrösse von 1 Rock in 20 Ellen Leinwand ausgedrückt, also ebenfalls quantitativ gemessen, aber nur indirekt, durch Umkehrung des Ausdrucks, nicht soweit der Rock die Rolle des Aequivalents spielt, sondern vielmehr seinen eignen Werth relativ in der Leinwand darstellt.
Drittens: Wir können die Formel: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth auch so ausdrücken: 20 Ellen Leinwand und 1 Rock sind Aequivalente oder beide sind gleichgrosse Werthe. Hier drücken wir nicht den Werth irgend einer der beiden Waaren in dem Gebrauchswerth der andern aus. Keine der beiden Waaren wird daher in Aequivalentform gesetzt. Aequivalent bedeutet hier nur Grössengleiches, nachdem beide Dinge vorher in unsrem Kopf stillschweigend auf die Abstraktion Werth reducirt worden sind.
c) Die Eigenthümlichkeiten der Aequivalentform.
α) Erste Eigenthümlichkeit der Aequivalentform: Gebrauchswerth wird zur Erscheinungsform seines Gegentheils, des Werths.
Die Naturalform der Waare wird zur Werthform. Aber, notabene, diess quid pro quo ereignet sich für eine Waare B (Rock oder Weizen oder Eisen u. s. w.) nur innerhalb des Werthverhältnisses, worin eine beliebige andre Waare A (Leinwand etc.) zu ihr tritt, nur innerhalb dieser Beziehung. Für sich, isolirt betrachtet, ist z. B. der Rock nur nützliches Ding, Gebrauchswerth, ganz wie die Leinwand, seine Rockform daher nur Form von Gebrauchswerth oder Naturalform einer bestimmten Waarenart. Da aber keine Waare sich auf sich selbst als Aequivalent beziehn, also auch nichtihre eigne Naturalhautzum Ausdruck ihres eignen Werths machen kann, muss sie sich auf andre Waare als Aequivalent beziehn oder die Naturalhaut eines andren Waarenkörpers zu ihrer eignen Werthform machen.
Diess veranschauliche uns das Beispiel eines Masses, welches den Waarenkörpern als Waarenkörpern zukommt, d. h. als Gebrauchswerthen. Ein Zuckerhut, weil Körper, ist schwer, und hat daher Gewicht, aber man kann keinem Zuckerhut seine Schwere ansehn oder anfühlen. Wir nehmen nun verschiedne
Stücke Eisen, deren Gewicht vorher bestimmt ist. Die Körperform des Eisens, für sich betrachtet, ist eben so wenig Erscheinungsform der Schwere als die des Zuckerhuts. Dennoch, um den Zuckerhut als Schwere oder Gewicht auszudrücken, setzen wir ihn in ein Gewichtsverhältniss zum Eisen. In diesem Verhältniss gilt das Eisen als ein Körper, der nichts darstellt ausser Schwere oder Gewicht. Eisenquanta dienen daher zum Gewichtmass des Zuckers und repräsentiren dem Zuckerkörper gegenüber blosse Schweregestalt, Erscheinungsform von Schwere. Diese Rolle spielt das Eisen nur innerhalb des Verhältnisses, worin der Zucker, oder irgend ein andrer Körper, dessen Gewicht gefunden werden soll, zu ihm tritt. Wären beide Dinge nichtschwer, so könnten sie nicht in diess Verhältniss treten und das Eine daher nicht zum Ausdruck der Schwere des Andren dienen. Werfen wir beide auf die Wagschale, so sehn wir in der That, dass sie als Schwere dasselbe und daher in bestimmter Proportion auch von demselben Gewicht sind. Wie hier der Eisenkörper dem Zuckerhut gegenüber nur Schwere, so vertritt in unsrem Werthausdruck der Rockkörper der Leinwand gegenüber nur Werth.
β) Zweite Eigenthümlichkeit der Aequivalentform: Konkrete Arbeit wird zur Erscheinungsform ihres Gegentheils, abstrakt menschlicher Arbeit.
Der Rock gilt im Werthausdruck der Leinwand als Werthkörper, seine Körper- oder Naturalform daher als Werthform, d. h. also als Verkörperung unterschiedsloser menschlicher Arbeit, menschlicher Arbeit schlechthin. Die Arbeit aber, wodurch das nützliche Ding Rock gemacht wird und seine bestimmte Form erhält, ist nicht abstrakt menschliche Arbeit, menschliche Arbeit schlechthin, sondern eine bestimmte, nützliche, konkrete Arbeitsart — Schneiderarbeit. Die einfache relative Werthform erheischt, dass der Werth einer Waare, der Leinwand z. B., nur in einer einzigen andern Waarenart ausgedrückt werde. Welches die andre Waarenart ist, ist aber für die einfache Werthform durchaus gleichgültig. Statt in der Waarenart Rock, hätte der Leinwan dwerth in der Waarenart Weizen, oder statt in der Waarenart Weizen, in der Waarenart Eisen u. s. w. ausgedrückt werden können. Ob aber Rock, Weizen oder Eisen, stets gälte das Aequivalent der Leinwand ihr als Werthkörper, daher als Verkörperung menschlicher Arbeit schlechthin. Und stets bliebe die bestimmte Körperform des Aequivalents, ob Rock oder Weizen oder Eisen, nicht Verkörperung abstrakt menschlicher Arbeit, sondern einer bestimmten, konkreten, nützlichen Arbeitsart, sei es der Schneiderarbeit oder der Bauernarbeit oder der Minenarbeit. Die bestimmte, konkrete, nützliche Arbeit, die den Waaren körper des Aequivalents producirt, muss also im Werthausdruck stets nothwendig als bestimmte Verwirklichungsform oder Erscheinungsform menschlicher Arbeit schlechthin, d. h. abstrakt menschlicher Arbeit gelten. Der Rock z. B. kann nur
als Werthkörper, daher als Verkörperung menschlicher Arbeit schlechthin gelten, soweit Schneiderarbeit als bestimmte Form gilt, worin menschliche Arbeitskraft verausgabt wird oder worin abstrakt menschliche Arbeit sich verwirklicht.
Innerhalb des Werthverhältnisses und des darin einbegriffenen Werthausdrucks gilt das abstrakt Allgemeine nicht als Eigenschaft des Konkreten, Sinnlich-Wirklichen, sondern umgekehrt das Sinnlich Konkrete als blosse Erscheinungsoder bestimmte Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen. Die Schneiderarbeit, die z. B. in dem Aequivalent Rock steckt, besitzt, innerhalb des Werthausdrucks der Leinwand, nicht die allgemeine Eigenschaft, auch menschliche Arbeit zu sein. Umgekehrt. Menschliche Arbeit zu sein gilt als ihr Wesen, Schneiderarbeit zu sein nur als Erscheinungsform oder bestimmte Verwirklichungsform dieses ihres Wesens. Diess quid pro quo ist unvermeidlich, weil die in dem Arbeitsprodukte dargestellte Arbeit nur werthbildend ist, soweit sie unterschiedslose menschliche Arbeit ist, so dass die in dem Werth eines Produkts vergegenständlichte Arbeit sich durchaus nicht unterscheidet von der im Werth eines verschiedenartigen Produkts vergegenständlichten Arbeit.
Diese Verkehrung, wodurch das Sinnlich-Konkrete nur als Erscheinungsform des Abstrakt-Allgemeinen, nicht das Abstrakt-Allgemeine umgekehrt als Eigenschaft des Konkreten gilt, charakterisirt den Werthausdruck. Sie macht zugleich sein Verständniss schwierig. Sage ich: Römisches Recht und deutsches Recht sind beide Rechte, so ist das selbstverständlich. Sage ich dagegen: Das Recht, dieses Abstraktum, verwirklicht sich im römischen Recht und im deutschen Recht, diesen konkreten Rechten, so wird der Zusammenhang mystisch.
γ) Dritte Eigenthümlichkeit der Aequivalentform: Privatarbeit wird zur Form ihres Gegentheils, zu Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form.
Arbeitsprodukte würden nicht zu Waaren, wären sie nicht Produkte unabhängig von einander betriebener, selbstständiger Privatarbeiten. Der gesellschaftliche Zusammenhang dieser Privatarbeiten existirt stofflich, soweit sie Glieder einer naturwüchsigen, gesellschaftlichen Theilung der Arbeit sind, und daher durch ihre Produkte die verschiedenartigen Bedürfnisse befriedigen, aus deren Gesammtheit das ebenfalls naturwüchsige System der gesellschaftlichen Bedürfnisse besteht. Dieser stoffliche gesellschaftliche Zusammenhang der von einander unabhängig betriebenen Privatarbeiten wird aber nur vermittelt, verwirklicht sich daher nur durch den Austausch ihrer Produkte. Das Produkt der Privatarbeit hat daher nur gesellschaftliche Form, soweit es Werthform und daher die Form der Austauschbarkeit mit andren Arbeitsprodukten hat. Un mittelbar gesellschaftliche Form hat es, soweit seine eigne Körperoder aturalform zugleich die Form seiner Austauschbarkeit mit andrer Waare
ist, oder andrer Waare als Werthform gilt. Diess findet jedoch, wie wir gesehn, nur dann für ein Arbeitsprodukt statt, wenn es, durch das Werthverhältniss andrer Waare zuihm, sich in Aequivalentform befindet oder andrer Waare gegenüber die Rolle des Aequivalents spielt.
Das Aequivalent hat unmittelbar gesellschaftliche Form, sofern es die Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit andrer Waare hat, und es hat diese Form unmittelbarer Austauschbarkeit, sofern es für andre Waare als Werthkörper gilt, daher als Gleiches. Also gilt auch die in ihm enthaltene bestimmte nützliche Arbeit als Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form, d. h. als Arbeit, welche die Form der Gleichheit mit der in andrer Waare enthaltenen Arbeit besitzt. Eine bestimmte, konkrete Arbeit, wie Schneiderarbeit, kann nur die Form der Gleichheit mit der in verschiedenartigen Waare, z. B. der Leinwand, enthaltenen verschiedenartigen Arbeit besitzen, soweitihre bestimmte Form als Ausdruck von Etwas gilt, was wirklich die Gleichheit der verschiedenartigen Arbeiten oder das Gleiche in denselben bildet. Gleich sind sie aber nur, soweit sie menschliche Arbeit überhaupt, abstrakt menschliche Arbeit sind, d. h. Verausgabung menschlicher Arbeitskraft. Weil also, wie bereits gezeigt, die im Aequivalent enthaltene bestimmte konkrete Arbeit als bestimmte Verwirklichungsform oder Erscheinungsform abstrakt menschlicher Arbeit gilt, besitzt sie die Form der Gleichheit mit andrer Arbeit, und ist daher, obgleich Privatarbeit, wie alle andre, Waaren producirende Arbeit, dennoch Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Eben desshalb stellt sie sich dar in einem Produkt, das unmittelbar austauschbar mit andrer Waare ist.
Die beiden zuletzt entwickelten Eigenthümlichkeiten der Aequivalentform werden noch fassbarer, wenn wir zu dem grossen Forscher zurückgehn, der die Werthform, wie so viele Denkformen, Gesellschaftsformen und Naturformen zuerst analysirt hat, und meist glücklicher als seine modernen Nachfolger. Es ist diess Aristoteles.
Zunächst spricht Aristoteles klar aus, dass die Geldform der Waare nur die weiter entwickelte Gestalt der einfachen Werthform ist, d. h. des Ausdrucks des Werths einer Waare in irgend einer beliebigen andern Waare, denn er sagt: „5 Polster = 1 Haus“ („Κλίναι πέντε ἀντὶ οἰϰίας“) „unterscheidet sich nicht“ von: „5 Polster = so und so viel Geld“ („Κλίναι πέντε ἀντὶ… ὅσου αἱ πέντε ϰλίναι“).
Er sieht ferner ein, dass das Werthverhältniss, worin dieser Werthausdruck steckt, seinerseits bedingt, dass das Haus dem Polster qualitativ gleichgesetzt wird, und dass diese sinnlich verschiednen Dinge ohnesolche Wesensgleichheit nicht als kommensurable Grössen auf einander
beziehbar wären. „Der Austausch“, sagt er, „kann nicht sein ohne die Gleichheit, die Gleichheit aber nicht ohne die Kommensurabilität“ („οὔτ᾽ ἰσότης μὴ οὔσης συμμετϱίας“). Hier aber stutzt er und giebt die weitere Analyse der Werthform auf. „Es ist aber in Wahrheit unmöglich („τῇ μὲν οἶν ἀληδείᾳ ἀδυνατον“), dass so verschiedenartige Dinge kommensurabel“, d. h. qualitativ gleich seien. Diese Gleichsetzung kann nur etwas der wahren Natur der Dinge Fremdes sein, also nur „Nothbehelf für das praktische Bedürfniss.“
Aristoteles sagt uns also selbst, woran seine weitere Analyse scheitert, nämlich am Mangel des Werthbegriffs. Was ist das Gleiche, d. h. die gemeinschaftliche Substanz, die das Haus für den Polster im Werthausdruck des Polsters vorstellt? So etwas kann „ in Wahrheit nicht existiren“, sagt Aristoteles. Warum? Das Haus stellt dem Polster gegenüber ein Gleiches vor, soweit es das in Beiden, dem Polster und dem Haus, wirklich Gleiche vorstellt. Und das ist — menschliche Arbeit.
Dass aber in der Form der Waare nwerthe alle Arbeiten als gleiche menschliche Arbeit und daher als gleichgeltend ausgedrückt sind, konnte Aristoteles nicht aus der Werthform der Waaren herauslesen, weil die griechische Gesellschaft auf der Sklavenarbeit beruhte, daher die Ungleichheit der Menschen und ihrer Arbeiten zur Naturbasis hatte. Das Geheimniss des Werthausdrucks, die Gleichheit und gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil und insofern sie menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert werden, sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Festigkeit eines Volksvorurtheils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Gesellschaft, worin die Waarenform die allgemeine Form des Arbeitsprodukts ist, also auch das Verhältniss der Menschen zu einander als Waarenbesitzer das herrschende gesellschaftliche Verhältniss ist. Das Genie des Aristoteles glänzt grade darin, dass er im Werthausdruck der Waaren ein Gleichheitsverhältniss entdeckt. Nur die historische Schranke der Gesellschaft, worin er lebte, verhindert ihn herauszufinden, worin denn „in Wahrheit“ diess Gleichheitsverhältniss besteht.
δ) Vierte Eigenthümlichkeit der Aequivalentform: Der Fetischismus der Waarenform ist frappanter in der Aequivalentform als in der relativen Werthform.
Dass Arbeitsprodukte, solche nützlichen Dinge wie Rock, Leinwand, Weizen, Eisen u. s. w., Werthe, bestimmte Werthgrössen und überhaupt Waaren sind, sind Eigenschaften, die ihnen natürlich nur in unsrem Verkehr zukommen, nicht von Natur, wie etwa die Eigenschaft schwer zu sein oder warm zu halten oder zu nähren. Aber innerhalb unsres Verkehrs verhalten sich diese Dinge als Waaren zu einander. Sie sind Werthe, sie sind messbar als Werthgrössen und ihre gemeinsame Wertheigenschaft setzt sie in ein Werthverhältniss zu einander. Dass nun z. B. 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder 20 Ellen Leinwand 1 Rock werth sind, drückt nur aus,
dass 1) die verschiedenartigen zur Produktion dieser Dinge nöthigen Arbeiten als menschliche Arbeit gleichgelten; 2) dass das in ihrer Produktion verausgabte Quantum Arbeit nach bestimmten gesellschaftlichen Gesetzen gemessen wird, und 3) dass Schneider und Weber in ein bestimmtes gesellschaftliches Produktionsverhältniss treten. Es ist eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung der Producenten, worin sie ihre verschiedenen nützlichen Arbeitsarten als menschliche Arbeit gleichsetzen. Es ist nicht minder eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung der Producenten, worin sie die Grösse ihrer Arbeiten durch die Zeitdauer der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft messen. Aber innerhalb unsres Verkehrs erscheinen ihnen diese gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeiten als gesellschaftliche Natureigenschaften, als gegenständliche Bestimmungen der Arbeitsprodukte selbst, die Gleichheit dermenschlichen Arbeiten als Wertheigenschaft der Arbeitsprodukte, das Mass der Arbeit durch die gesellschaftlich nothwendige Arbeitszeit als Werthgrösse der Arbeitsprodukte, endlich die gesellschaftliche Beziehung der Producenten durch ihre Arbeiten als Werthverhältniss oder gesellschaftliches Verhältniss dieser Dinge, der Arbeitsprodukte. Eben desshalb erscheinen ihnen die Arbeitsprodukte als Waaren, sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. So stellt sich der Lichteindruck eines Dings auf den Sehnerv nicht als subjektiver Reiz des Sehnervs selbst, sondern als gegenständliche Form eines Dings ausserhalb des Auges dar. Aber beim Sehn wird wirklich Licht von einem Ding, dem äusseren Gegenstand, auf ein andres Ding, das Auge, geworfen. Es ist ein physisches Verhältniss zwischen physischen Dingen. Dagegen hat die Waarenform und das Werthverhältniss der Arbeitsprodukte mit ihrer physischen Natur und den daraus entspringenden dinglichen Beziehungen absolut nichts zu schaffen. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältniss der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier erscheinen die Produkte des menschlichen Kopfes als mit eignem Leben begabte, unter einander und mit den Menschen in Verhältniss stehende selbstständige Gestalten. So in der Waarenwelt die Produkte der menschlichen Hand. Diess nenne ich den Fetischismus, der sich an die Arbeitsprodukte anklebt, sobald sie als Waaren producirt werden, der also von der Waarenproduktion unzertrennlich ist.
Dieser Fetischcharakter nun tritt schlagender an der Aequivalentform als an der relativen Werthform hervor. Die relative Werthform einer Waare ist vermittelt, nämlich durch ihr Verhältniss zu andrer Waare. Durch diese Werthform ist der Werth der Waare als etwas von ihrem eignen sinnlichen Dasein durchaus Unterschiednes ausgedrückt. Es liegt darin zugleich, dass das Werthsein eine dem Ding selbst fremde Be
ziehung, sein Werthverhältniss zu einem andern Ding daher nur die Erscheinungsform eines dahinter versteckten gesellschaftlichen Verhältnisses sein kann. Umgekehrt mit der Aequivalentform. Sie besteht grade darin, dass die Körperoder Naturalform einer Waare unmittelbar als gesellschaftliche Form gilt, als Werthform für andre Waare. Innerhalb unseres Verkehrs erscheint es also als gesellschaftliche Natureigenschaft eines Dings, als eine ihm von Natur zukommende Eigenschaft, Aequivalentform zu besitzen, daher so wie es sinnlich da ist, unmittelbar austauschbar mit andern Dingen zu sein. Weil aber innerhalb des Werthausdrucks der Waare A die Aequivalentform von Natur der Waare B zukommt, scheint sie letztrer auch ausserhalb dieses Verhältnisses von Natur anzugehören. Daher z. B. das Räthselhafte des Goldes, das neben seinen andren Natureigenschaften, seiner Lichtfarbe, seinem specifischen Gewicht, seiner NichtOxydirbarkeit an der Luft u. s. w., auch die Aequivalentform von Natur zu besitzen scheint oder die gesellschaftliche Qualität mit allen andern Waaren unmittelbar austauschbar zu sein.
§. 4. Sobald der Werth selbstständig erscheint, hat er die Form von Tauschwerth.
Der Werthausdruck hat zwei Pole, relative Werthform und Aequivalentform. Was zunächst die als Aequivalent funktionirende Waare betrifft, so gilt sie für andre Waare als Werthgestalt, Körper in unmittelbar austauschbarer Form — Tauschwerth. Die Waare aber, deren Werth relativ ausgedrückt ist, besitzt die Form von Tauschwerth, indem 1) ihr Werthsein durch die Austanschbarkeit eines andern Waarenkörpers mit ihr offenbart wird, 2) ihre Werthgrösse ausgedrückt wird durch die Proportion, worin die andre Waare mit ihr austauschbar ist. — Der Tauschwerth ist daher überhaupt die selbstständige Erscheinungsform des Waarenwerths.
§. 5. Die einfache Werthform der Waare ist die einfache Erscheinungsform der in ihr enthaltenen Gegensätze von Gebrauchswerth und Tauschwerth.
In dem Werthverhältniss der Leinwand zum Rock gilt die Naturalform der Leinwand nur als Gestalt von Gebrauchswerth, die Naturalform des Rocks nur als Werthform oder Gestalt von Tauschwerth. Der in der Waare enthaltene innere Gegensatz von Gebrauchswerth und Werth wird also dargestellt durch einen äussern Gegensatz, d. h. das Verhältniss zweier Waaren, wovon die eine unmittelbar nur als Gebrauchswerth, die andere unmittelbar nur als Tauschwerth gilt, oder worin die beiden gegensätzlichen Bestimmungen von Gebrauchswerth und Tauschwerth polarisch unter die Waaren vertheilt sind. — Wenn ich sage: Als Waare ist die Leinwand Gebrauchswerth und Tauschwerth, so ist das mein durch Analyse gewonnenes Urtheil über die Natur der Waare. Dagegen im Ausdruck: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder: 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth, sagt die
Leinwand selbst, dass sie 1) Gebrauchswerth (Leinwand), 2) davon unterschiedner Tauschwerth (Rock-Gleiches) und 3) Einheit dieser beiden Unterschiede, also Waare ist.
§. 6. Die einfache Werthform der Waare ist die einfache Waarenform des Arbeitsprodukts.
Die Form eines Gebrauchswerths bringt das Arbeitsprodukt in seiner Naturalform mit auf die Welt. Es bedarf also nur noch der Werthform, damit es die Waarenform besitze, d. h. damit es erscheine als Einheit der Gegensätze Gebrauchswerth und Tauschwerth. Die Entwicklung der Werthform ist daher identisch mit der Entwicklung der Waarenform.
§. 7. Verhältniss von Waarenform und Geldform.
Setzt man an die Stelle von: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder 20 Ellen Leinwand sind 1 Rock werth, die Form: 20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. St. oder 20 Ellen Leinwand sind 2 Pfd. St. werth, so zeigt der erste Blick, dass die Geldform durchaus nichts ist als die weiter entwickelte Gestalt der einfachen Werthform der Waare, also der einfachen Waarenform des Arbeitsprodukts. Weil die Geldform nur die entwickelte Waarenform, entspringt sie offenbar aus der einfachen Waarenform. Sobald letztre daher begriffen ist, bleibt nur noch die Reihe der Metamorphosen zu betrachten, welche die einfache Waarenform: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock durchlaufen muss, um die Gestalt: 20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. St. anzunehmen.
§. 8. Einfache relative Werthform und Einzelne Aequivalentform.
Der Werthausdruck im Rock giebt der Leinwand eine Werthform, wodurch sie nur als Werth von sich selbst als Gebrauchswerth unterschieden wird. Diese Form setzt sie auch nur in Verhältniss zum Rock, d. h. zu irgend einer einzelnen, von ihr selbst verschiedenen Waarenart. Aber als Werth ist sie dasselbe wie alle andren Waaren. Ihre Werthform muss daher auch eine Form sein, welche sie in ein Verhältniss qualitativer Gleichheit und quantitativer Proportionalität zu allen andren Waaren setzt. — Der einfachen relativen Werthform einer Waare entspricht die einzelne Aequivalentform einer andren Waare. Oder die Waare, worin Werth ausgedrückt wird, funktionirt hier nur als einzelnes Aequivalent. So besitzt der Rock, im relativen Werthausdruck der Leinwand, nur Aequivalentform oder Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit Bezug auf diese einzelne Waarenart Leinwand.
§. 9. Uebergang aus der einfachen Werthform in die entfaltete Werthform.
Die einfache Werthform bedingt, dass der Werth einer Waare in nur einer, aber gleichgültig welcher, Waare von andrer Art ausgedrückt werde. Es ist also ebensowohl einfacher relativer Werthausdruck der Leinwand,
wenn ihr Werth in Eisen oder in Weizen u. s. w., als wenn er in der Waarenart Rock ausgedrückt wird. Je nachdem sie also mit dieser oder jener andern Waarenart in ein Werthverhältniss tritt, entstehn verschiedne einfache relative Werthausdrücke der Leinwand. Der Möglichkeit nach hat sie eben so viele verschiedne einfache Werthausdrücke als von ihr verschiedenartige Waaren existiren. In der That besteht also ihr vollständiger relativer Werthausdruck nicht in einem vereinzelten einfachen relativen Werthausdruck, sondern in der Summe ihrer einfachen relativen Werthausdrücke. So erhalten wir:
20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = 10 Pfd. Thee oder = 40 Pfd. Kaffee oder = 1 Quarter Weizen oder = 2 Unzen Gold oder = ½ Tonne Eisen oder = u. s. w.
§. 1. Endlosigkeit der Reihe.
Diese Reihe einfacher relativer Werthausdrücke ist ihrer Natur nach stets verlängerbar oder schliesst nie ab. Denn es treten stets neue Waarenarten auf, und jede neue Waarenart bildet das Material eines neuen Werthausdrucks.
§. 2. Die entfaltete relative Werthform.
Der Werth einer Waare, der Leinwand z. B., ist jetzt dargestellt in allen andren Elementen der Waarenwelt. Jeder andre Waarenkörper wird zum Spiegel des Leinwan dwerths. So erscheint dieser Werth selbst erst wahrhaft als Gallerte unterschiedsloser menschlicher Arbeit. Denn die den Leinwan dwerth bildende Arbeit ist nun ausdrücklich als Arbeit dargestellt, der jede andre menschliche Arbeit, welche Naturalform sie immer besitze, und ob sie sich daher in Rock oder Weizen oder Eisen oder Gold u. s. w. vergegenständliche, gleichgilt. Durch ihre Werthform steht die Leinwand daher jetzt auch in gesellschaftlichem Verhältniss nicht mehr zu nur einer einzelnen andren Waarenart, sondern zur Waarenwelt. Als Waare ist sie Bürger dieser Welt. Zugleich liegt in der endlosen Reihe seiner Ausdrücke, dass der Waare nwerth gleichgültig ist gegen jede besondre Form des Gebrauchswerths, worin er erscheint.
§. 3. Die besondre Aequivalentform.
Jede Waare, Rock, Thee, Weizen, Eisen u. s. w. gilt im Werthausdruck der Leinwand als Aequivalent und daher als Werthkörper. Die bestimmte Naturalform jeder dieser Waaren ist jetzt eine besondre Aequivalentform neben vielen andern. Ebenso gelten die mannigfaltigen in den verschiedenen Waarenkörpern enthaltenen bestimmten, konkreten, nützlichen Arbeitsarten jetzt als eben so viele besondre Verwirklichungsoder Erscheinungsformen menschlicher Arbeit schlechthin.
§. 4. Mängel der entfalteten oder totalen Werthform.
Erstens ist der relative Werthausdruck der Leinwand unfertig, weil seine Darstellungsreihe nie abschliesst. Zweitens besteht er aus einer bunten Mosaik auseinanderfallender und verschiedenartiger Werthausdrücke. Wird endlich, wie diess geschehn muss, der relative Werth jeder Waare in dieser entfalteten Form ausgedrückt, so ist die relative Werthform jeder Waare eine von der relativen Werthform jeder andren Waaren verschiedne endlose Reihe von Werthausdrücken. — Die Mängel der entfalteten relativen Werthform reflektiren sich in der ihr entsprechenden Aequivalentform. Da die Naturalform jeder einzelnen Waarenart hier eine besondre Aequivalentform neben unzähligen andren besondren Aequivalentformen ist, existiren überhaupt nur beschränkte Aequivalentformen, von denen jede die andre ausschliesst. Ebenso ist die in jedem besondern Waarenäquivalent enthaltene bestimmte, konkrete, nützliche Arbeitsart nur besondre, also nicht erschöpfende Erscheinungsform der menschlichen Arbeit. Diese besitzt ihre vollständige oder totale Erscheinungsform zwar in dem Gesammtumkreis jener besondren Erscheinungsformen. Aber so besitzt sie keine einheitliche Erscheinungsform.
§. 5. Uebergang aus der totalen Werthform in die allgemeine Werthform.
Die totale oder entfaltete relative Werthform besteht jedoch nur aus einer Summe einfacher relativer Werthausdrücke oder Gleichungen der ersten Form, wie: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock 20 Ellen Leinwand = 10 Pfd. Thee u. s. w.
Jede dieser Gleichungen enthält aber rückbezüglich auch die identische Gleichung: 1 Rock = 20 Ellen Leinwand 10 Pfd. Thee = 20 Ellen Leinwand u. s. w.
In der That: Tauscht der Besitzer der Leinwand seine Waare mit vielen andren Waaren aus und drückt daher den Werth seiner Waare in einer Reihe von andren Waaren aus, so müssen nothwendig auch die vielen andren Waarenbesitzer ihre Waaren mit Leinwand austauschen und daher die Werthe ihrer verschiedenen Waaren in derselben dritten Waare, der Leinwand, ausdrücken. — Kehren wir also die Reihe: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder = 10 Pfd. Thee oder = u. s. w. um, d. h. drücken wir die an sich, implicite, schon in der Reihe enthaltene Rückbeziehung aus, so erhalten wir:
§. 1. Veränderte Gestalt der relativen Werthform.
Die relative Werthform besitzt jetzt eine ganz veränderte Gestalt. Alle Waaren drücken ihren Werth 1) einfach aus, nämlich in einem einzigen andren Waarenkörper, 2) einheitlich, d. h. in demselben andren Waarenkörper. Ihre Werthform ist einfach und gemeinschaftlich, d. h. allgemein. Allen verschiedenartigen Waarenkörpern gilt jetzt die Leinwand als ihre gemeinschaftliche und allgemeine Werthgestalt. Die Werthform einer Waare, d. h. der Ausdruck ihres Werths in Leinwand, unterscheidet sie jetzt nicht nur als Werth von ihrem eignen Dasein als Gebrauchsgegenstand, d. h. von ihrer eignen Naturalform, sondern bezieht sie zugleich als Werth auf alle andren Waaren, auf alle Waaren als Ihresgleichen. Sie besitzt daher in dieser Werthform allgemein gesellschaftliche Form.
Erst durch ihren allgemeinen Charakter entspricht die Werthform dem Werthbegriff. Die Werthform musste eine Form sein, worin die Waaren als blosse Gallerte unterschiedsloser, gleichartiger, menschlicher Arbeit, d. h. als dingliche Ausdrücke derselben Arbeitssubstanz für einander erscheinen. Diess ist jetzt erreicht. Denn sie alle sind ausgedrückt als Materiatur derselben Arbeit, der in der Leinwand enthaltenen Arbeit, oder als dieselbe Materiatur der Arbeit, nämlich als Leinwand. So sind sie qualitativ gleichgesetzt.
Zugleich sind sie quantitativ verglichen oder als bestimmte Werthgrössen für einander dargestellt. Z. B. 10 Pfd. Thee = 20 Ellen Leinwand, und 40 Pfd. Kaffee = 20 Ellen Leinwand. Also: 10 Pfd. Thee = 40 Pfd. Kaffee. Oder in 1 Pfd. Kaffee steckt nur ¼ so viel Werthsubstanz, Arbeit, als in 1 Pfd. Thee.
§. 2. Veränderte Gestalt der Aequivalentform.
Die besondere Aequivalentform ist jetzt fortentwickelt zur allgemeinen Aequivalentform. Oder die in Aequivalentform befindliche Waare ist jetzt — allgemeines Aequivalent. — Indem die Naturalform des Waarenkörpers Leinwand als Werthgestalt aller andren Waaren gilt, ist sie die Form ihrer Gleichgültigkeit oder unmittelbaren Austausch
barkeit mit allen Elementen der Waarenwelt. Ihre Naturalform ist also zugleich ihre allgemeine gesellschaftliche Form.
Für alle andren Waaren, obgleich sie die Produkte der verschiedenartigsten Arbeiten sind, gilt die Leinwand als Erscheinungsform der in ihnen selbst enthaltenen Arbeiten, daher als Verkörperung gleichartiger, unterschiedsloser, menschlicher Arbeit. Die Weberei, diese besondre konkrete Arbeitsart, gilt also jetzt, durch das Werthverhältniss der Waarenwelt zur Leinwand, als allgemeine und unmittelbar erschöpfende Verwirklichungsform abstrakt menschlicher Arbeit, d. h. der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft überhaupt.
Die in der Leinwand enthaltene Privatarbeit gilt eben desshalb auch als Arbeit, welche sich unmittelbar in allgemein gesellschaftlicher Form oder der Form der Gleichheit mit allen andren Arbeiten befindet.
Wenn eine Waare also die allgemeine Aequivalentform besitzt oder als allgemeines Aequivalent funktionirt, gilt ihre Naturaloder Körperform als die sichtbare Inkarnation, die allgemeine gesellschaftliche Verpuppung aller menschlichen Arbeit.
§. 3. Gleichmässiges Entwicklungsverhältniss von relativer Werthform und Aequivalentform.
Dem Entwicklungsgrad der relativen Werthform entspricht der Entwicklungsgrad der Aequivalentform. Aber, und diess ist wohl zu merken, die Entwicklung der Aequivalentform ist nur Ausdruck und Resultat der Entwicklung der relativen Werthform. Von der letzteren geht die Initiative aus.
Die einfache relative Werthform drückt den Werth einer Waare nur in einer einzigen andren Waarenart aus, gleichgültig in welcher. Die Waare erhält so nur Werthform im Unterschied zu ihrer eignen Gebrauchswerthsoder Naturalform. Ihr Aequivalent erhält auch nur die einzelne Aequivalentform. Die entfaltete relative Werthform drückt den Werth einer Waare in allen andren Waaren aus. Letztre erhalten daher die Form vieler besondren Acquivalente oder besondre Aequivalentform. Endlich giebt sich die Waarenwelt eine einheitliche, allgemeine, relative Werthform, indem sie eine einzige Waarenart von sich ausschliesst, worin alle andren Waaren ihren Werth gemeinschaftlich ausdrücken. Dadurch wird die ausgeschlossene Waare allgemeines Aequivalent oder wird die Aequivalentform zur allgemeine Aequivalentform.
§. 4. Entwicklung der Polarität von relativer Werthform und Aequivalentform.
Der polarische Gegensatz, oder die unzertrennliche Zusammengehörigkeit und ebenso beständige Ausschliessung von relativer Werthform und Aequivalentform, so dass 1) eine Waare sich nicht in der einen Form befinden kann, ohne dass andre Waare sich in der entgegengesetzten Form befindet, und
2) dass sobald eine Waare sich in der einen Form befindet, sie sich nicht gleichzeitig innerhalb desselben Werthausdrucks in der andren Form befinden kann, — dieser polarische Gegensatz beider Momente des Werthausdrucks entwickelt und verhärtet sich in demselben Masse, worin sich die Werthform überhaupt entwickelt oder ausgebildet wird.
In der Form I schliessen sich schon die beiden Formen aus, aber nur formell. Je nachdem dieselbe Gleichung vorwärts oder rückwärts gelesen wird, befindet sich jedes der beiden Waarenextreme, wie Leinwand und Rock, gleichmässig bald in der relativen Werthform, bald in der Aequivalentform. Es kostet hier noch Mühe, den polarischen Gegensatz festzuhalten.
In der Form II kann immer nur je eine Waarenart ihren relativen Werth total entfalten oder besitzt sie selbst nur entfaltete relative Werthform, weil und sofern alle andren Waaren sich ihr gegenüber in der Aequivalentform befinden.
In der Form III endlich besitzt die Waarenwelt nur allgemein-gesellschaftliche relative Werthform, weil und sofern alle ihr angehörigen Waaren von der Aequivalentform oder der Form unmittelbarer Austauschbarkeit ausgeschlossen sind. Umgekehrt ist die Waare, die sich in der allgemeinen Aequivalentform befindet oder als allgemeines Aequivalent figurirt, von der einheitlichen und daher allgemeinen relativen Werthform der Waarenwelt ausgeschlossen. Sollte die Leinwand, d. h. irgend eine in allgemeiner Aequivalentform befindliche Waare, auch zugleich an der allgemeinen relativen Werthform theilnehmen, so müsste sie auf sich selbst als Aequivalent bezogen werden. Wir erhalten dann: 20 Ellen Leinwand = 20 Ellen Leinwand, eine Tautologie, worin weder Werth, noch Werthgrösse ausgedrückt ist. Um den relativen Werth des allgemeinen Aequivalents auszudrücken, müssen wir die Form III umkehren. Es besitzt keine mit den andren Waaren gemeinschaftliche relative Werthform, sondern sein Werth drückt sich relativ aus in der endlosen Reihe aller andren Waarenkörper. So erscheint jetzt die entfaltete relative Werthform oder Form II als die specifische relative Werthform der Waare, welche die Rolle des allgemeinen Aequivalents spielt.
§. 5. Uebergang aus der allgemeinen Werthform zur Geldform.
Die allgemeine Aequivalentform ist eine Form des Werths überhaupt. Sie kann also jeder Waare zukommen, aber stets nur im Ausschluss von allen andren Waaren.
Indess zeigt schon der blosse Formunterschied zwischen Form II und Form III etwas Eigenthümliches, was die Formen I und II nicht unterscheidet. Nämlich in der entfalteten Werthform (Form II) schliesst eine Waare alle andren aus, um in ihnen den eignen Werth auszudrücken. Diese Ausschliessung kann ein rein subjektiver Prozess sein, z. B. ein
Prozess des Leinwandbesitzers, der den Werth seiner eignen Waare in vielen andren Waaren schätzt. Dagegen befindet sich eine Waare nur in allgemeiner Aequivalentform (Form III), weil und sofern sie selbst durch alle andren Waaren als Aequivalent ausgeschlossen wird. Die Ausschliessung ist hier ein von der ausgeschlossenen Waare unabhängiger, objektiver Prozess. In der historischen Entwicklung der Waarenform mag daher die allgemeine Aequivalentform bald dieser, bald jener Waare abwechselnd zukommen. Aber eine Waare funktionirt nie wirklich als allgemeines Aequivalent, ausser sofern ihre Ausschliessung und daher ihre Aequivalentform das Resultat eines objektiven gesellschaftlichen Prozessesist
Die allgemeine Werthform ist die entwickelte Werthform und daher die entwickelte Waarenform. Die stofflich ganz verschiedenen Arbeitsprodukte können nicht fertige Waarenform besitzen und daher auch nicht im Austauschprozess als Waare funktioniren, ohne als dingliche Ausdrücke derselben gleichen menschlichen Arbeit dargestellt zu sein. Das heisst, um fertige Waarenform zu erhalten, müssen sie einheitliche, allgemeine relative Werthform erhalten. Aber diese einheitliche relative Werthform können sie nur dadurch erwerben, dass sie eine bestimmte Waarenart als allgemeines Aequivalent aus ihrer eignen Reihe ausschliessen. Und erst von dem Augenblicke, wo diese Ausschliessung sich endgültig auf eine specifische Waarenart beschränkt, hat die einheitliche relative Werthform objektive Festigkeit und allgemein gesellschaftliche Gültigkeit gewonnen.
Die specifische Waarenart nun, mit deren Naturalform die Aequivalentform gesellschaftlich verwächst, wird zur Geldwaare oder funktionirt als Geld. Es wird ihre specifisch gesellschaftliche Funktion, und daher ihr gesellschaftliches Monopol, die Rolle des allgemeinen Aequivalents innerhalb der Waaren welt zu spielen. Diesen bevorzugten Platz hat unter den Waaren, welche in Form II als besondre Aequivalente der Leinwand figuriren, und in Form III ihren relativen Werth gemeinsam in Leinwand ausdrücken, eine bestimmte Waare historisch erobert, das Gold. Setzen wir daher in Form III die Waare Gold an die Stelle der Waare Leinwand, so erhalten wir:
§. 1. Verschiedenheit des Uebergangs der allgemeinen Werthform zur Geldform von den früheren Entwicklungsübergängen.
Es finden wesentliche Veränderungen statt beim Uebergang von Form I zu Form II, von Form II zu Form III. Dagegen unterscheidet Form IV sich durch nichts von Form III, ausser dass jetzt statt Leinwand Gold die allgemeine Aequivalentform besitzt. Gold bleibt in Form IV, was die Leinwand in Form III war — allgemeines Aequivalent. Der Fortschritt besteht nur darin, dass die Form unmittelbarer allgemeiner Austauschbarkeit oder die allgemeine Aequivalentform jetzt durch gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit der specifischen Naturalform des Waarenkörpers Gold verwachsen ist.
Gold tritt den andren Waaren nur als Geld gegenüber, weil es ihnen bereits zuvor als Waare gegenüberstand. Gleich allen andren Waaren funktionirte es auch als Aequivalent, sei es als einzelnes Aequivalent in vereinzelten Austauschakten, sei es als besondres Aequivalent neben andren Waarenäquivalenten. Nach und nach funktionirte es in engeren oder weiteren Kreisen als allgemeines Aequivalent. Sobald es das Monopol dieser Stelle im Werthausdruck der Waarenwelt erobert hat, wird es Geldwaare, und erst von dem Augenblick, woes bereits Geldwaare geworden ist, unterscheidet sich Form IV von Form III, oder ist die allgemeine Werthform verwandelt in die Geldform.
§. 2. Verwandlung der allgemeinen relativen Werthform in Preisform.
Der einfache relative Werthausdruck einer Waare, z. B. der Leinwand, in der bereits als Geldwaare funktionirenden Waare, z. B. dem Gold, ist Preisform. Die Preisform der Leinwand daher: 20 Ellen Leinwand = 2 Unzen Gold, oder, wenn 2 Pfd. St. der Münzname von 2 Unzen Gold, 20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. St.
§. 3. Die einfache Waarenform ist das Geheimniss der Geldform.
Man sieht, die eigentliche Geldform bietet an sich gar keine Schwierigkeit. Sobald einmal die allgemeine Aequivalentform durchschaut ist, macht es nicht das geringste Kopfbrechen zu begreifen, dass sich diese Aequivalentform an eine specifische Waarenart wie Gold festhaftet, um so weniger als die allgemeine Aequivalentform von Natur die gesellschaftliche Ausschliessung einer bestimmten Waarenart durch alle andren Waaren bedingt. Es handelt sich nur noch darum, dass diese Ausschliessung objektiv gesellschaftliche Konsistenz und allgemeine Gültigkeit gewinnt, daher weder abwechselnd verschiedne Waaren trifft, noch eine bloss lokale Tragweite in nur besondern Kreisen der Waarenwelt besitzt. Die Schwierigkeit im Begriff der Geldform beschränkt sich auf das Begreifen der allgemeinen Aequivalentform,
also der allgemeinen Werthform überhaupt, der Form III. Form III löst sich aber rückbezüglich auf in Form II, und das konstituirende Element der Form II ist Form I: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock oder x Waare A = y Waare B. Weiss man nun, was Gebrauchswerth und Tauschwerth sind, so findet man, dass diese Form I die einfachste, unentwickeltste Manier ist, ein beliebiges Arbeitsprodukt, wie die Leinwand z. B., als Waare darzustellen, d. h. als Einheit der Gegensätze Gebrauchswerth und Tauschwerth. Man findet dann zugleich leicht die Metamorphosenreihe, welche die einfache Waarenform: 20 Ellen Leinwand = 1 Rock durchlaufen muss, um ihre fertige Gestalt: 20 Ellen Leinwand = 2 Pfd. St., d. h. die Geldform zu gewinnen.
( Fortzufahren p. 35 im Text des Buchs.)
Druck von Otto Wigand in Leipzig.